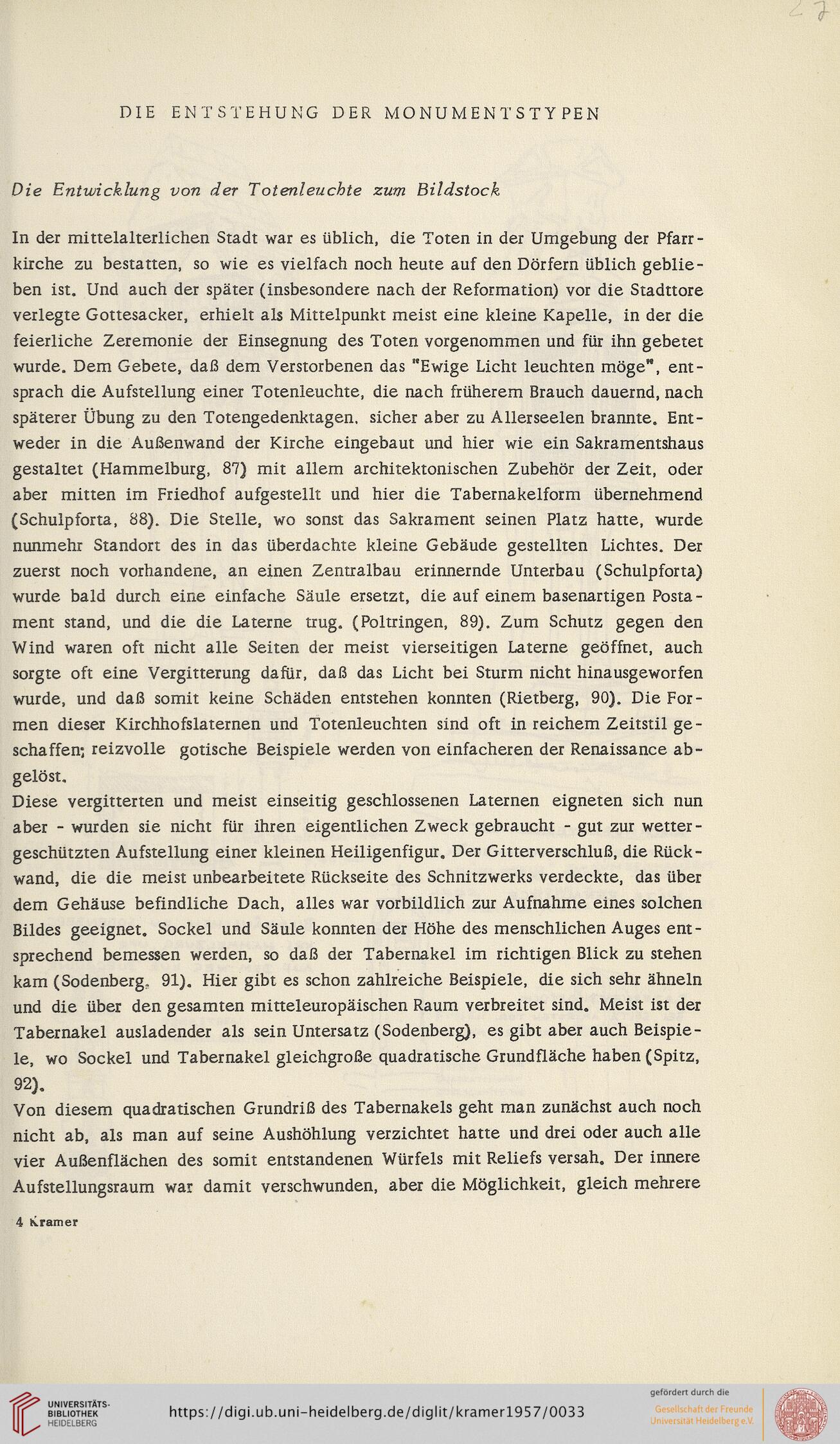DIE ENTSTEHUNG DER M O N U M E N T S T Y PE N
Die Entwicklung von der Totenleuchte zum Bildstock
In der mittelalterlichen Stadt war es üblich, die Toten in der Umgebung der Pfarr-
kirche zu bestatten, so wie es vielfach noch heute auf den Dörfern üblich geblie-
ben ist. Und auch der später (insbesondere nach der Reformation) vor die Stadttore
verlegte Gottesacker, erhielt als Mittelpunkt meist eine kleine Kapelle, in der die
feierliche Zeremonie der Einsegnung des Toten vorgenommen und für ihn gebetet
wurde. Dem Gebete, daß dem Verstorbenen das "Ewige Licht leuchten möge", ent-
sprach die Aufstellung einer Totenleuchte, die nach früherem Brauch dauernd, nach
späterer Übung zu den Totengedenktagen, sicher aber zu Allerseelen brannte. Ent-
weder in die Außenwand der Kirche eingebaut und hier wie ein Sakramentshaus
gestaltet (Hammelburg, 87) mit allem architektonischen Zubehör der Zeit, oder
aber mitten im Friedhof aufgestellt und hier die Tabernakelform übernehmend
(Schulpforta, 88). Die Stelle, wo sonst das Sakrament seinen Platz hatte, wurde
nunmehr Standort des in das überdachte kleine Gebäude gestellten Lichtes. Der
zuerst noch vorhandene, an einen Zentralbau erinnernde Unterbau (Schulpforta)
wurde bald durch eine einfache Säule ersetzt, die auf einem basenartigen Posta-
ment stand, und die die Laterne trug. (Poltringen, 89). Zum Schutz gegen den
Wind waren oft nicht alle Seiten der meist vierseitigen Laterne geöffnet, auch
sorgte oft eine Vergitterung dafür, daß das Licht bei Sturm nicht hinausgeworfen
wurde, und daß somit keine Schäden entstehen konnten (Rietberg, 90). Die For-
men dieser Kirchhofslaternen und Totenleuchten sind oft in reichem Zeitstil ge-
schaffen: reizvolle gotische Beispiele werden von einfacheren der Renaissance ab-
gelöst.
Diese vergitterten und meist einseitig geschlossenen Laternen eigneten sich nun
aber - wurden sie nicht für ihren eigentlichen Zweck gebraucht - gut zur wetter -
geschützten Aufstellung einer kleinen Heiligenfigur. Der Gitterverschluß, die Rück-
wand, die die meist unbearbeitete Rückseite des Schnitzwerks verdeckte, das über
dem Gehäuse befindliche Dach, alles war vorbildlich zur Aufnahme eines solchen
Bildes geeignet. Sockel und Säule konnten der Höhe des menschlichen Auges ent-
sprechend bemessen werden, so daß der Tabernakel im richtigen Blick zu stehen
kam (Sodenberg, 91). Hier gibt es schon zahlreiche Beispiele, die sich sehr ähneln
und die über den gesamten mitteleuropäischen Raum verbreitet sind. Meist ist der
Tabernakel ausladender als sein Untersatz (Sodenberg), es gibt aber auch Beispie-
le, wo Sockel und Tabernakel gleichgroße quadratische Grundfläche haben (Spitz,
92).
Von diesem quadratischen Grundriß des Tabernakels geht man zunächst auch noch
nicht ab, als man auf seine Aushöhlung verzichtet hatte und drei oder auch alle
vier Außenflächen des somit entstandenen Würfels mit Reliefs versah. Der innere
Aufstellungsraum war damit verschwunden, aber die Möglichkeit, gleich mehrere
4 Kramer
Die Entwicklung von der Totenleuchte zum Bildstock
In der mittelalterlichen Stadt war es üblich, die Toten in der Umgebung der Pfarr-
kirche zu bestatten, so wie es vielfach noch heute auf den Dörfern üblich geblie-
ben ist. Und auch der später (insbesondere nach der Reformation) vor die Stadttore
verlegte Gottesacker, erhielt als Mittelpunkt meist eine kleine Kapelle, in der die
feierliche Zeremonie der Einsegnung des Toten vorgenommen und für ihn gebetet
wurde. Dem Gebete, daß dem Verstorbenen das "Ewige Licht leuchten möge", ent-
sprach die Aufstellung einer Totenleuchte, die nach früherem Brauch dauernd, nach
späterer Übung zu den Totengedenktagen, sicher aber zu Allerseelen brannte. Ent-
weder in die Außenwand der Kirche eingebaut und hier wie ein Sakramentshaus
gestaltet (Hammelburg, 87) mit allem architektonischen Zubehör der Zeit, oder
aber mitten im Friedhof aufgestellt und hier die Tabernakelform übernehmend
(Schulpforta, 88). Die Stelle, wo sonst das Sakrament seinen Platz hatte, wurde
nunmehr Standort des in das überdachte kleine Gebäude gestellten Lichtes. Der
zuerst noch vorhandene, an einen Zentralbau erinnernde Unterbau (Schulpforta)
wurde bald durch eine einfache Säule ersetzt, die auf einem basenartigen Posta-
ment stand, und die die Laterne trug. (Poltringen, 89). Zum Schutz gegen den
Wind waren oft nicht alle Seiten der meist vierseitigen Laterne geöffnet, auch
sorgte oft eine Vergitterung dafür, daß das Licht bei Sturm nicht hinausgeworfen
wurde, und daß somit keine Schäden entstehen konnten (Rietberg, 90). Die For-
men dieser Kirchhofslaternen und Totenleuchten sind oft in reichem Zeitstil ge-
schaffen: reizvolle gotische Beispiele werden von einfacheren der Renaissance ab-
gelöst.
Diese vergitterten und meist einseitig geschlossenen Laternen eigneten sich nun
aber - wurden sie nicht für ihren eigentlichen Zweck gebraucht - gut zur wetter -
geschützten Aufstellung einer kleinen Heiligenfigur. Der Gitterverschluß, die Rück-
wand, die die meist unbearbeitete Rückseite des Schnitzwerks verdeckte, das über
dem Gehäuse befindliche Dach, alles war vorbildlich zur Aufnahme eines solchen
Bildes geeignet. Sockel und Säule konnten der Höhe des menschlichen Auges ent-
sprechend bemessen werden, so daß der Tabernakel im richtigen Blick zu stehen
kam (Sodenberg, 91). Hier gibt es schon zahlreiche Beispiele, die sich sehr ähneln
und die über den gesamten mitteleuropäischen Raum verbreitet sind. Meist ist der
Tabernakel ausladender als sein Untersatz (Sodenberg), es gibt aber auch Beispie-
le, wo Sockel und Tabernakel gleichgroße quadratische Grundfläche haben (Spitz,
92).
Von diesem quadratischen Grundriß des Tabernakels geht man zunächst auch noch
nicht ab, als man auf seine Aushöhlung verzichtet hatte und drei oder auch alle
vier Außenflächen des somit entstandenen Würfels mit Reliefs versah. Der innere
Aufstellungsraum war damit verschwunden, aber die Möglichkeit, gleich mehrere
4 Kramer