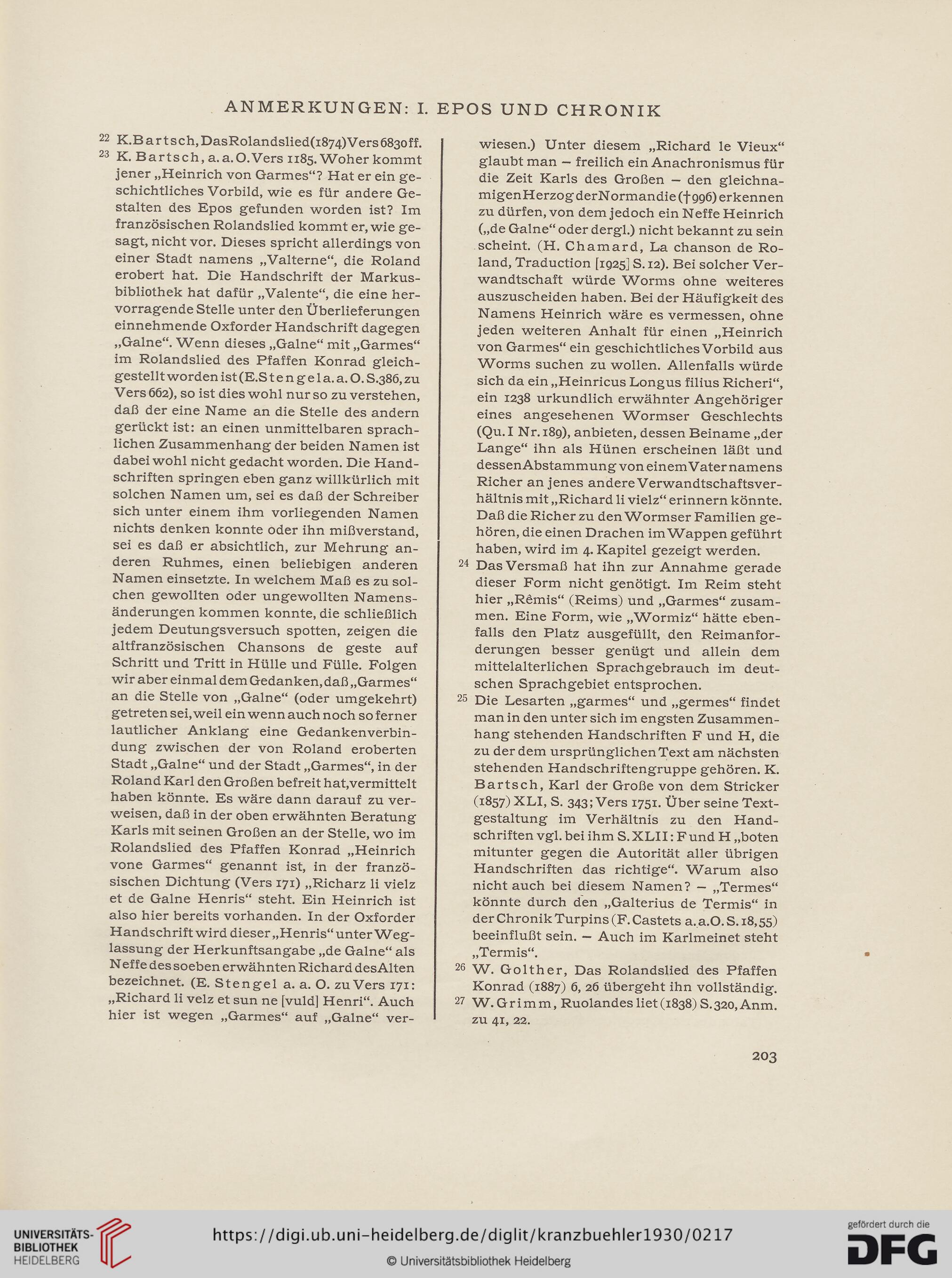ANMERKUNGEN: I. EPOS UND CHRONIK
22 K.Bartsch,DasRolandslied(i874)Vers683off.
23 K. Bartsch, a.a.O.Vers 1185. Woher kommt
jener „Heinrich von Garmes“? Hat er ein ge-
schichtliches Vorbild, wie es für andere Ge-
stalten des Epos gefunden worden ist? Im
französischen Rolandslied kommt er, wie ge-
sagt, nicht vor. Dieses spricht allerdings von
einer Stadt namens „Valterne“, die Roland
erobert hat. Die Handschrift der Markus-
bibliothek hat dafür „Valente“, die eine her-
vorragende Stelle unter den Überlieferungen
einnehmende Oxforder Handschrift dagegen
„Galne“. Wenn dieses „Galne“ mit „Garmes“
im Rolandslied des Pfaffen Konrad gleich-
gestellt worden ist (E.S t e n g e 1 a. a. O. S.386, zu
Vers 662), so ist dies wohl nur so zu verstehen,
daß der eine Name an die Stelle des andern
gerückt ist: an einen unmittelbaren sprach-
lichen Zusammenhang der beiden Namen ist
dabei wohl nicht gedacht worden. Die Hand-
schriften springen eben ganz willkürlich mit
solchen Namen um, sei es daß der Schreiber
sich unter einem ihm vorliegenden Namen
nichts denken konnte oder ihn mißverstand,
sei es daß er absichtlich, zur Mehrung an-
deren Ruhmes, einen beliebigen anderen
Namen einsetzte. In welchem Maß es zu sol-
chen gewollten oder ungewollten Namens-
änderungen kommen konnte, die schließlich
jedem Deutungsversuch spotten, zeigen die
altfranzösischen Chansons de geste auf
Schritt und Tritt in Hülle und Fülle. Folgen
wir aber einmal dem Gedanken, daß „Garmes“
an die Stelle von „Galne“ (oder umgekehrt)
getreten sei, weil ein wenn auch noch so ferner
lautlicher Anklang eine Gedankenverbin-
dung zwischen der von Roland eroberten
Stadt „Galne“ und der Stadt „Garmes“, in der
Roland Karl den Großen befreit hat,vermittelt
haben könnte. Es wäre dann darauf zu ver-
weisen, daß in der oben erwähnten Beratung
Karls mit seinen Großen an der Stelle, wo im
Rolandslied des Pfaffen Konrad „Heinrich
vone Garmes“ genannt ist, in der franzö-
sischen Dichtung (Vers 171) „Richarz li vielz
et de Galne Henris“ steht. Ein Heinrich ist
also hier bereits vorhanden. In der Oxforder
Handschrift wird dieser „Henris“ unter Weg-
lassung der Herkunftsangabe „de Galne“ als
N ef f e des soeben erwähnten Richard des Alten
bezeichnet. (E. Stengel a. a. O. zu Vers 171:
„Richard li velz et sun ne [vuld] Henri“. Auch
hier ist wegen „Garmes“ auf „Galne“ ver-
wiesen.) Unter diesem „Richard le Vieux“
glaubt man — freilich ein Anachronismus für
die Zeit Karls des Großen — den gleichna-
migenHerzogderNormandie(j-gg6)erkennen
zu dürfen, von dem jedoch ein Neffe Heinrich
(„de Galne“ oder dergl.) nicht bekannt zu sein
scheint. (H. Chamard, La chanson de Ro-
land, Traduction [rg25] S. 12). Bei solcher Ver-
wandtschaft würde Worms ohne weiteres
auszuscheiden haben. Bei der Häufigkeit des
Namens Heinrich wäre es vermessen, ohne
jeden weiteren Anhalt für einen „Heinrich
von Garmes“ ein geschichtliches Vorbild aus
Worms suchen zu wollen. Allenfalls würde
sich da ein „Heinricus Longus filius Richeri“,
ein 1238 urkundlich erwähnter Angehöriger
eines angesehenen Wormser Geschlechts
(Qu.I Nr.i8g), anbieten, dessen Beiname „der
Lange“ ihn als Hünen erscheinen läßt und
dessenAbstammung von einemVater namens
Richer an jenes andere Verwandtschaftsver-
hältnis mit „Richard li vielz“ erinnern könnte.
Daß die Richer zu den Wormser Familien ge-
hören, die einen Drachen im Wappen geführt
haben, wird im 4. Kapitel gezeigt werden.
24 Das Versmaß hat ihn zur Annahme gerade
dieser Form nicht genötigt. Im Reim steht
hier „Remis“ (Reims) und „Garmes“ zusam-
men. Eine Form, wie „Wormiz“ hätte eben-
falls den Platz ausgefüllt, den Reimanfor-
derungen besser genügt und allein dem
mittelalterlichen Sprachgebrauch im deut-
schen Sprachgebiet entsprochen.
25 Die Lesarten „garmes“ und „germes“ findet
man in den unter sich im engsten Zusammen-
hang stehenden Handschriften F und H, die
zu der dem ursprünglichen Text am nächsten
stehenden Handschriftengruppe gehören. K.
Bartsch, Karl der Große von dem Stricker
(1857) XLI, S. 343; Vers 1751. Über seine Text-
gestaltung im Verhältnis zu den Hand-
schriften vgl. bei ihm S. XLII: F und H „boten
mitunter gegen die Autorität aller übrigen
Handschriften das richtige“. Warum also
nicht auch bei diesem Namen? — „Termes“
könnte durch den „Galterius de Termis“ in
der Chronik Turpins (F. Castets a. a.O. S. 18,55)
beeinflußt sein. — Auch im Karlmeinet steht
„Termis“.
26 W. Golther, Das Rolandslied des Pfaffen
Konrad (1887) 6, 26 übergeht ihn vollständig.
27 W.Grimm, Ruolandesliet(i838) S.320,Anm.
zu 41, 22.
203
22 K.Bartsch,DasRolandslied(i874)Vers683off.
23 K. Bartsch, a.a.O.Vers 1185. Woher kommt
jener „Heinrich von Garmes“? Hat er ein ge-
schichtliches Vorbild, wie es für andere Ge-
stalten des Epos gefunden worden ist? Im
französischen Rolandslied kommt er, wie ge-
sagt, nicht vor. Dieses spricht allerdings von
einer Stadt namens „Valterne“, die Roland
erobert hat. Die Handschrift der Markus-
bibliothek hat dafür „Valente“, die eine her-
vorragende Stelle unter den Überlieferungen
einnehmende Oxforder Handschrift dagegen
„Galne“. Wenn dieses „Galne“ mit „Garmes“
im Rolandslied des Pfaffen Konrad gleich-
gestellt worden ist (E.S t e n g e 1 a. a. O. S.386, zu
Vers 662), so ist dies wohl nur so zu verstehen,
daß der eine Name an die Stelle des andern
gerückt ist: an einen unmittelbaren sprach-
lichen Zusammenhang der beiden Namen ist
dabei wohl nicht gedacht worden. Die Hand-
schriften springen eben ganz willkürlich mit
solchen Namen um, sei es daß der Schreiber
sich unter einem ihm vorliegenden Namen
nichts denken konnte oder ihn mißverstand,
sei es daß er absichtlich, zur Mehrung an-
deren Ruhmes, einen beliebigen anderen
Namen einsetzte. In welchem Maß es zu sol-
chen gewollten oder ungewollten Namens-
änderungen kommen konnte, die schließlich
jedem Deutungsversuch spotten, zeigen die
altfranzösischen Chansons de geste auf
Schritt und Tritt in Hülle und Fülle. Folgen
wir aber einmal dem Gedanken, daß „Garmes“
an die Stelle von „Galne“ (oder umgekehrt)
getreten sei, weil ein wenn auch noch so ferner
lautlicher Anklang eine Gedankenverbin-
dung zwischen der von Roland eroberten
Stadt „Galne“ und der Stadt „Garmes“, in der
Roland Karl den Großen befreit hat,vermittelt
haben könnte. Es wäre dann darauf zu ver-
weisen, daß in der oben erwähnten Beratung
Karls mit seinen Großen an der Stelle, wo im
Rolandslied des Pfaffen Konrad „Heinrich
vone Garmes“ genannt ist, in der franzö-
sischen Dichtung (Vers 171) „Richarz li vielz
et de Galne Henris“ steht. Ein Heinrich ist
also hier bereits vorhanden. In der Oxforder
Handschrift wird dieser „Henris“ unter Weg-
lassung der Herkunftsangabe „de Galne“ als
N ef f e des soeben erwähnten Richard des Alten
bezeichnet. (E. Stengel a. a. O. zu Vers 171:
„Richard li velz et sun ne [vuld] Henri“. Auch
hier ist wegen „Garmes“ auf „Galne“ ver-
wiesen.) Unter diesem „Richard le Vieux“
glaubt man — freilich ein Anachronismus für
die Zeit Karls des Großen — den gleichna-
migenHerzogderNormandie(j-gg6)erkennen
zu dürfen, von dem jedoch ein Neffe Heinrich
(„de Galne“ oder dergl.) nicht bekannt zu sein
scheint. (H. Chamard, La chanson de Ro-
land, Traduction [rg25] S. 12). Bei solcher Ver-
wandtschaft würde Worms ohne weiteres
auszuscheiden haben. Bei der Häufigkeit des
Namens Heinrich wäre es vermessen, ohne
jeden weiteren Anhalt für einen „Heinrich
von Garmes“ ein geschichtliches Vorbild aus
Worms suchen zu wollen. Allenfalls würde
sich da ein „Heinricus Longus filius Richeri“,
ein 1238 urkundlich erwähnter Angehöriger
eines angesehenen Wormser Geschlechts
(Qu.I Nr.i8g), anbieten, dessen Beiname „der
Lange“ ihn als Hünen erscheinen läßt und
dessenAbstammung von einemVater namens
Richer an jenes andere Verwandtschaftsver-
hältnis mit „Richard li vielz“ erinnern könnte.
Daß die Richer zu den Wormser Familien ge-
hören, die einen Drachen im Wappen geführt
haben, wird im 4. Kapitel gezeigt werden.
24 Das Versmaß hat ihn zur Annahme gerade
dieser Form nicht genötigt. Im Reim steht
hier „Remis“ (Reims) und „Garmes“ zusam-
men. Eine Form, wie „Wormiz“ hätte eben-
falls den Platz ausgefüllt, den Reimanfor-
derungen besser genügt und allein dem
mittelalterlichen Sprachgebrauch im deut-
schen Sprachgebiet entsprochen.
25 Die Lesarten „garmes“ und „germes“ findet
man in den unter sich im engsten Zusammen-
hang stehenden Handschriften F und H, die
zu der dem ursprünglichen Text am nächsten
stehenden Handschriftengruppe gehören. K.
Bartsch, Karl der Große von dem Stricker
(1857) XLI, S. 343; Vers 1751. Über seine Text-
gestaltung im Verhältnis zu den Hand-
schriften vgl. bei ihm S. XLII: F und H „boten
mitunter gegen die Autorität aller übrigen
Handschriften das richtige“. Warum also
nicht auch bei diesem Namen? — „Termes“
könnte durch den „Galterius de Termis“ in
der Chronik Turpins (F. Castets a. a.O. S. 18,55)
beeinflußt sein. — Auch im Karlmeinet steht
„Termis“.
26 W. Golther, Das Rolandslied des Pfaffen
Konrad (1887) 6, 26 übergeht ihn vollständig.
27 W.Grimm, Ruolandesliet(i838) S.320,Anm.
zu 41, 22.
203