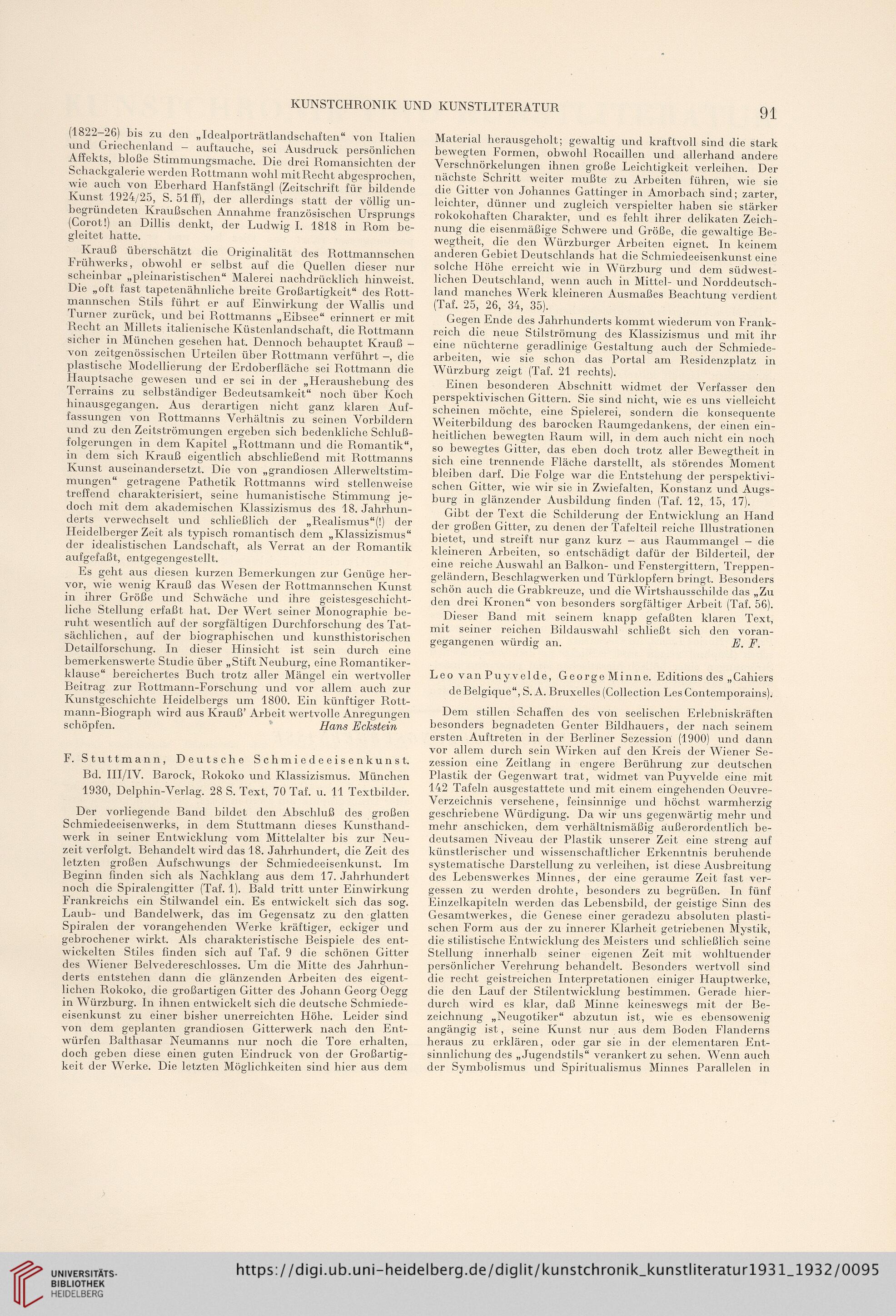KUNSTCHRONIK UND KUNSTLITERATUR
91
(1822-26) bis zu den „Idealporträtlandschaften“ von Italien
und Griechenland — auftauche, sei Ausdruck persönlichen
Affekts, bloße Stimmungsmache. Die drei Romansichten der
Schackgalerie werden Rottmann wohl mit Recht abgesprochen,
wie auch von Eberhard Hanfstängl (Zeitschrift für bildende
Kunst 1924/25, S. 51 ff), der allerdings statt der völlig un-
begründeten Kraußschen Annahme französischen Ursprungs
(Corot!) an Dillis denkt, der Ludwig I. 1818 in Rom be-
gleitet hatte.
Krauß überschätzt die Originalität des Rottmannschen
Frühwerks, obwohl er selbst auf die Quellen dieser nur
scheinbar „pleinaristischen“ Malerei nachdrücklich hinweist.
Die „oft fast tapetenähnliche breite Großartigkeit“ des Rott-
mannschen Stils führt er auf Einwirkung der Wallis und
Turner zurück, und bei Rottmanns „Eibsee“ erinnert er mit
Rech t an Millets italienische Küstenlandschaft, die Rottmann
sicher in München gesehen hat. Dennoch behauptet Krauß -
von zeitgenössischen Urteilen über Rottmann verführt -, die
plastische Modellierung der Erdoberfläche sei Rottmann die
Hauptsache gewesen und er sei in der „Heraushebung des
Terrains zu selbständiger Bedeutsamkeit“ noch über Koch
hinausgegangen. Aus derartigen nicht ganz klaren Auf-
fassungen von Rottmanns Verhältnis zu seinen Vorbildern
und zu den Zeitströmungen ergeben sich bedenkliche Schluß-
folgerungen in dem Kapitel „Rottmann und die Romantik“,
in dem sich Krauß eigentlich abschließend mit Rottmanns
Kunst auseinandersetzt. Die von „grandiosen Allerweltstim-
mungen“ getragene Pathetik Rottmanns wird stellenweise
treffend charakterisiert, seine humanistische Stimmung je-
doch mit dem akademischen Klassizismus des 18. Jahrhun-
derts verwechselt und schließlich der „Realismus“(!) der
Heidelberger Zeit als typisch romantisch dem „Klassizismus“
der idealistischen Landschaft, als Verrat an der Romantik
auf gefaßt, entgegengestellt.
Es geht aus diesen kurzen Bemerkungen zur Genüge her-
vor, wie wenig Krauß das Wesen der Rottmannschen Kunst
in ihrer Größe und Schwäche und ihre geistesgeschicht-
liche Stellung erfaßt hat. Der Wert seiner Monographie be-
ruht wesentlich auf der sorgfältigen Durchforschung des Tat-
sächlichen, auf der biographischen und kunsthistorischen
Detailforschung. In dieser Hinsicht ist sein durch eine
bemerkenswerte Studie über „Stift Neuburg, eine Romantiker-
klause“ bereichertes Buch trotz aller Mängel ein wertvoller
Beitrag zur Rottmann-Forschung und vor allem auch zur
Kunstgeschichte Heidelbergs um 1800. Ein künftiger Rott-
mann-Biograph wird aus Krauß’ Arbeit wertvolle Anregungen
schöpfen. Hans Eckstein
F. Stu11mann, Deutsche Schmiedeeisenkunst.
Bd. HI/IV. Barock, Rokoko und Klassizismus. München
1930, Delphin-Verlag. 28 S. Text, 70 Taf. u. 11 Textbilder.
Der vorliegende Band bildet den Abschluß des großen
Schmiedeeisenwerks, in dem Stuttmann dieses Kunsthand-
werk in seiner Entwicklung vom Mittelalter bis zur Neu-
zeit verfolgt. Behandelt wird das 18. Jahrhundert, die Zeit des
letzten großen Aufschwungs der Schmiedeeisenkunst. Im
Beginn finden sich als Nachklang aus dem 17. Jahrhundert
noch die Spiralengitter (Taf. 1). Bald tritt unter Einwirkung
Frankreichs ein Stilwandel ein. Es entwickelt sich das sog.
Laub- und Bandelwerk, das im Gegensatz zu den glatten
Spiralen der vorangehenden Werke kräftiger, eckiger und
gebrochener wirkt. Als charakteristische Beispiele des ent-
wickelten Stiles finden sich auf Taf. 9 die schönen Gitter
des Wiener Belvedereschlosses. Um die Mitte des Jahrhun-
derts entstehen dann die glänzenden Arbeiten des eigent-
lichen Rokoko, die großartigen Gitter des Johann Georg Oegg
in Würzburg. In ihnen entwickelt sich die deutsche Schmiede-
eisenkunst zu einer bisher unerreichten Höhe. Leider sind
von dem geplanten grandiosen Gitterwerk nach den Ent-
würfen Balthasar Neumanns nur noch die Tore erhalten,
doch geben diese einen guten Eindruck von der Großartig-
keit der Werke. Die letzten Möglichkeiten sind hier aus dem
Material herausgeholt; gewaltig und kraftvoll sind die stark
bewegten Formen, obwohl Rocaillen und allerhand andere
Verschnörkelungen ihnen große Leichtigkeit verleihen. Der
nächste Schritt weiter mußte zu Arbeiten führen, wie sie
die Gitter von Johannes Gattinger in Amorbach sind; zarter,
leichter, dünner und zugleich verspielter haben sie stärker
rokokohaften Charakter, und es fehlt ihrer delikaten Zeich-
nung die eisenmäßige Schwere und Größe, die gewaltige Be-
wegtheit, die den Würzburger Arbeiten eignet. In keinem
anderen Gebiet Deutschlands hat die Schmiedeeisenkunst eine
solche Höhe erreicht wie in Würzburg und dem südwest-
lichen Deutschland, wenn auch in Mittel- und Norddeutsch-
land manches Werk kleineren Ausmaßes Beachtung verdient
(Taf. 25, 26, 34, 35).
Gegen Ende des Jahrhunderts kommt wiederum von Frank-
reich die neue Stilströmung des Klassizismus und mit ihr
eine nüchterne geradlinige Gestaltung auch der Schmiede-
arbeiten, wie sie schon das Portal am Residenzplatz in
Würzburg zeigt (Taf. 21 rechts).
Einen besonderen Abschnitt widmet der Verfasser den
perspektivischen Gittern. Sie sind nicht, wie es uns vielleicht
scheinen möchte, eine Spielerei, sondern die konsequente
Weiterbildung des barocken Raumgedankens, der einen ein-
heitlichen bewegten Raum will, in dem auch nicht ein noch
so bewegtes Gitter, das eben doch trotz aller Bewegtheit in
sich eine trennende Fläche darstellt, als störendes Moment
bleiben darf. Die Folge war die Entstehung der perspektivi-
schen Gitter, wie wir sie in Zwiefalten, Konstanz und Augs-
burg in glänzender Ausbildung finden (Taf. 12, 15, 17).
Gibt der Text die Schilderung der Entwicklung an Hand
der großen Gitter, zu denen der Tafelteil reiche Illustrationen
bietet, und streift nur ganz kurz — aus Raummangel — die
kleineren Arbeiten, so entschädigt dafür der Bilderteil, der
eine reiche Auswahl an Balkon- und Fenstergittern, Treppen-
geländern, Beschlagwerken und Türklopfern bringt. Besonders
schön auch die Grabkreuze, und die Wirtshausschilde das „Zu
den drei Kronen“ von besonders sorgfältiger Arbeit (Taf. 56).
Dieser Band mit seinem knapp gefaßten klaren Text,
mit seiner reichen Bildauswahl schließt sich den voran-
gegangenen würdig an. E. F.
Leo van Puyvelde, George Minne. Editions des „Cahiers
de Belgique“, S. A. Bruxelles (Collection Les Contemporains).
Dem stillen Schaffen des von seelischen Erlebniskräften
besonders begnadeten Genter Bildhauers, der nach seinem
ersten Auftreten in der Berliner Sezession (1900) und dann
vor allem durch sein Wirken auf den Kreis der Wiener Se-
zession eine Zeitlang in engere Berührung zur deutschen
Plastik der Gegenwart trat, widmet van Puyvelde eine mit
142 Tafeln ausgestattete und mit einem eingehenden Oeuvre-
Verzeichnis versehene, feinsinnige und höchst warmherzig
geschriebene Würdigung. Da wir uns gegenwärtig mehr und
mehr anschicken, dem verhältnismäßig außerordentlich be-
deutsamen Niveau der Plastik unserer Zeit eine streng auf
künstlerischer und wissenschaftlicher Erkenntnis beruhende
systematische Darstellung zu verleihen, ist diese Ausbreitung
des Lebenswerkes Minnes, der eine geraume Zeit fast ver-
gessen zu werden drohte, besonders zu begrüßen. In fünf
Einzelkapiteln werden das Lebensbild, der geistige Sinn des
Gesamtwerkes, die Genese einer geradezu absoluten plasti-
schen Form aus der zu innerer Klarheit getriebenen Mystik,
die stilistische Entwicklung des Meisters und schließlich seine
Stellung innerhalb seiner eigenen Zeit mit wohltuender
persönlicher Verehrung behandelt. Besonders wertvoll sind
die recht geistreichen Interpretationen einiger Hauptwerke,
die den Lauf der Stilentwicklung bestimmen. Gerade hier-
durch wird es klar, daß Minne keineswegs mit der Be-
zeichnung „Neugotiker“ abzutun ist, wie es ebensowenig
angängig ist, seine Kunst nur aus dem Boden Flanderns
heraus zu erklären, oder gar sie in der elementaren Ent-
sinnlichung des „Jugendstils“ verankert zu sehen. Wenn auch
der Symbolismus und Spiritualismus Minnes Parallelen in
91
(1822-26) bis zu den „Idealporträtlandschaften“ von Italien
und Griechenland — auftauche, sei Ausdruck persönlichen
Affekts, bloße Stimmungsmache. Die drei Romansichten der
Schackgalerie werden Rottmann wohl mit Recht abgesprochen,
wie auch von Eberhard Hanfstängl (Zeitschrift für bildende
Kunst 1924/25, S. 51 ff), der allerdings statt der völlig un-
begründeten Kraußschen Annahme französischen Ursprungs
(Corot!) an Dillis denkt, der Ludwig I. 1818 in Rom be-
gleitet hatte.
Krauß überschätzt die Originalität des Rottmannschen
Frühwerks, obwohl er selbst auf die Quellen dieser nur
scheinbar „pleinaristischen“ Malerei nachdrücklich hinweist.
Die „oft fast tapetenähnliche breite Großartigkeit“ des Rott-
mannschen Stils führt er auf Einwirkung der Wallis und
Turner zurück, und bei Rottmanns „Eibsee“ erinnert er mit
Rech t an Millets italienische Küstenlandschaft, die Rottmann
sicher in München gesehen hat. Dennoch behauptet Krauß -
von zeitgenössischen Urteilen über Rottmann verführt -, die
plastische Modellierung der Erdoberfläche sei Rottmann die
Hauptsache gewesen und er sei in der „Heraushebung des
Terrains zu selbständiger Bedeutsamkeit“ noch über Koch
hinausgegangen. Aus derartigen nicht ganz klaren Auf-
fassungen von Rottmanns Verhältnis zu seinen Vorbildern
und zu den Zeitströmungen ergeben sich bedenkliche Schluß-
folgerungen in dem Kapitel „Rottmann und die Romantik“,
in dem sich Krauß eigentlich abschließend mit Rottmanns
Kunst auseinandersetzt. Die von „grandiosen Allerweltstim-
mungen“ getragene Pathetik Rottmanns wird stellenweise
treffend charakterisiert, seine humanistische Stimmung je-
doch mit dem akademischen Klassizismus des 18. Jahrhun-
derts verwechselt und schließlich der „Realismus“(!) der
Heidelberger Zeit als typisch romantisch dem „Klassizismus“
der idealistischen Landschaft, als Verrat an der Romantik
auf gefaßt, entgegengestellt.
Es geht aus diesen kurzen Bemerkungen zur Genüge her-
vor, wie wenig Krauß das Wesen der Rottmannschen Kunst
in ihrer Größe und Schwäche und ihre geistesgeschicht-
liche Stellung erfaßt hat. Der Wert seiner Monographie be-
ruht wesentlich auf der sorgfältigen Durchforschung des Tat-
sächlichen, auf der biographischen und kunsthistorischen
Detailforschung. In dieser Hinsicht ist sein durch eine
bemerkenswerte Studie über „Stift Neuburg, eine Romantiker-
klause“ bereichertes Buch trotz aller Mängel ein wertvoller
Beitrag zur Rottmann-Forschung und vor allem auch zur
Kunstgeschichte Heidelbergs um 1800. Ein künftiger Rott-
mann-Biograph wird aus Krauß’ Arbeit wertvolle Anregungen
schöpfen. Hans Eckstein
F. Stu11mann, Deutsche Schmiedeeisenkunst.
Bd. HI/IV. Barock, Rokoko und Klassizismus. München
1930, Delphin-Verlag. 28 S. Text, 70 Taf. u. 11 Textbilder.
Der vorliegende Band bildet den Abschluß des großen
Schmiedeeisenwerks, in dem Stuttmann dieses Kunsthand-
werk in seiner Entwicklung vom Mittelalter bis zur Neu-
zeit verfolgt. Behandelt wird das 18. Jahrhundert, die Zeit des
letzten großen Aufschwungs der Schmiedeeisenkunst. Im
Beginn finden sich als Nachklang aus dem 17. Jahrhundert
noch die Spiralengitter (Taf. 1). Bald tritt unter Einwirkung
Frankreichs ein Stilwandel ein. Es entwickelt sich das sog.
Laub- und Bandelwerk, das im Gegensatz zu den glatten
Spiralen der vorangehenden Werke kräftiger, eckiger und
gebrochener wirkt. Als charakteristische Beispiele des ent-
wickelten Stiles finden sich auf Taf. 9 die schönen Gitter
des Wiener Belvedereschlosses. Um die Mitte des Jahrhun-
derts entstehen dann die glänzenden Arbeiten des eigent-
lichen Rokoko, die großartigen Gitter des Johann Georg Oegg
in Würzburg. In ihnen entwickelt sich die deutsche Schmiede-
eisenkunst zu einer bisher unerreichten Höhe. Leider sind
von dem geplanten grandiosen Gitterwerk nach den Ent-
würfen Balthasar Neumanns nur noch die Tore erhalten,
doch geben diese einen guten Eindruck von der Großartig-
keit der Werke. Die letzten Möglichkeiten sind hier aus dem
Material herausgeholt; gewaltig und kraftvoll sind die stark
bewegten Formen, obwohl Rocaillen und allerhand andere
Verschnörkelungen ihnen große Leichtigkeit verleihen. Der
nächste Schritt weiter mußte zu Arbeiten führen, wie sie
die Gitter von Johannes Gattinger in Amorbach sind; zarter,
leichter, dünner und zugleich verspielter haben sie stärker
rokokohaften Charakter, und es fehlt ihrer delikaten Zeich-
nung die eisenmäßige Schwere und Größe, die gewaltige Be-
wegtheit, die den Würzburger Arbeiten eignet. In keinem
anderen Gebiet Deutschlands hat die Schmiedeeisenkunst eine
solche Höhe erreicht wie in Würzburg und dem südwest-
lichen Deutschland, wenn auch in Mittel- und Norddeutsch-
land manches Werk kleineren Ausmaßes Beachtung verdient
(Taf. 25, 26, 34, 35).
Gegen Ende des Jahrhunderts kommt wiederum von Frank-
reich die neue Stilströmung des Klassizismus und mit ihr
eine nüchterne geradlinige Gestaltung auch der Schmiede-
arbeiten, wie sie schon das Portal am Residenzplatz in
Würzburg zeigt (Taf. 21 rechts).
Einen besonderen Abschnitt widmet der Verfasser den
perspektivischen Gittern. Sie sind nicht, wie es uns vielleicht
scheinen möchte, eine Spielerei, sondern die konsequente
Weiterbildung des barocken Raumgedankens, der einen ein-
heitlichen bewegten Raum will, in dem auch nicht ein noch
so bewegtes Gitter, das eben doch trotz aller Bewegtheit in
sich eine trennende Fläche darstellt, als störendes Moment
bleiben darf. Die Folge war die Entstehung der perspektivi-
schen Gitter, wie wir sie in Zwiefalten, Konstanz und Augs-
burg in glänzender Ausbildung finden (Taf. 12, 15, 17).
Gibt der Text die Schilderung der Entwicklung an Hand
der großen Gitter, zu denen der Tafelteil reiche Illustrationen
bietet, und streift nur ganz kurz — aus Raummangel — die
kleineren Arbeiten, so entschädigt dafür der Bilderteil, der
eine reiche Auswahl an Balkon- und Fenstergittern, Treppen-
geländern, Beschlagwerken und Türklopfern bringt. Besonders
schön auch die Grabkreuze, und die Wirtshausschilde das „Zu
den drei Kronen“ von besonders sorgfältiger Arbeit (Taf. 56).
Dieser Band mit seinem knapp gefaßten klaren Text,
mit seiner reichen Bildauswahl schließt sich den voran-
gegangenen würdig an. E. F.
Leo van Puyvelde, George Minne. Editions des „Cahiers
de Belgique“, S. A. Bruxelles (Collection Les Contemporains).
Dem stillen Schaffen des von seelischen Erlebniskräften
besonders begnadeten Genter Bildhauers, der nach seinem
ersten Auftreten in der Berliner Sezession (1900) und dann
vor allem durch sein Wirken auf den Kreis der Wiener Se-
zession eine Zeitlang in engere Berührung zur deutschen
Plastik der Gegenwart trat, widmet van Puyvelde eine mit
142 Tafeln ausgestattete und mit einem eingehenden Oeuvre-
Verzeichnis versehene, feinsinnige und höchst warmherzig
geschriebene Würdigung. Da wir uns gegenwärtig mehr und
mehr anschicken, dem verhältnismäßig außerordentlich be-
deutsamen Niveau der Plastik unserer Zeit eine streng auf
künstlerischer und wissenschaftlicher Erkenntnis beruhende
systematische Darstellung zu verleihen, ist diese Ausbreitung
des Lebenswerkes Minnes, der eine geraume Zeit fast ver-
gessen zu werden drohte, besonders zu begrüßen. In fünf
Einzelkapiteln werden das Lebensbild, der geistige Sinn des
Gesamtwerkes, die Genese einer geradezu absoluten plasti-
schen Form aus der zu innerer Klarheit getriebenen Mystik,
die stilistische Entwicklung des Meisters und schließlich seine
Stellung innerhalb seiner eigenen Zeit mit wohltuender
persönlicher Verehrung behandelt. Besonders wertvoll sind
die recht geistreichen Interpretationen einiger Hauptwerke,
die den Lauf der Stilentwicklung bestimmen. Gerade hier-
durch wird es klar, daß Minne keineswegs mit der Be-
zeichnung „Neugotiker“ abzutun ist, wie es ebensowenig
angängig ist, seine Kunst nur aus dem Boden Flanderns
heraus zu erklären, oder gar sie in der elementaren Ent-
sinnlichung des „Jugendstils“ verankert zu sehen. Wenn auch
der Symbolismus und Spiritualismus Minnes Parallelen in