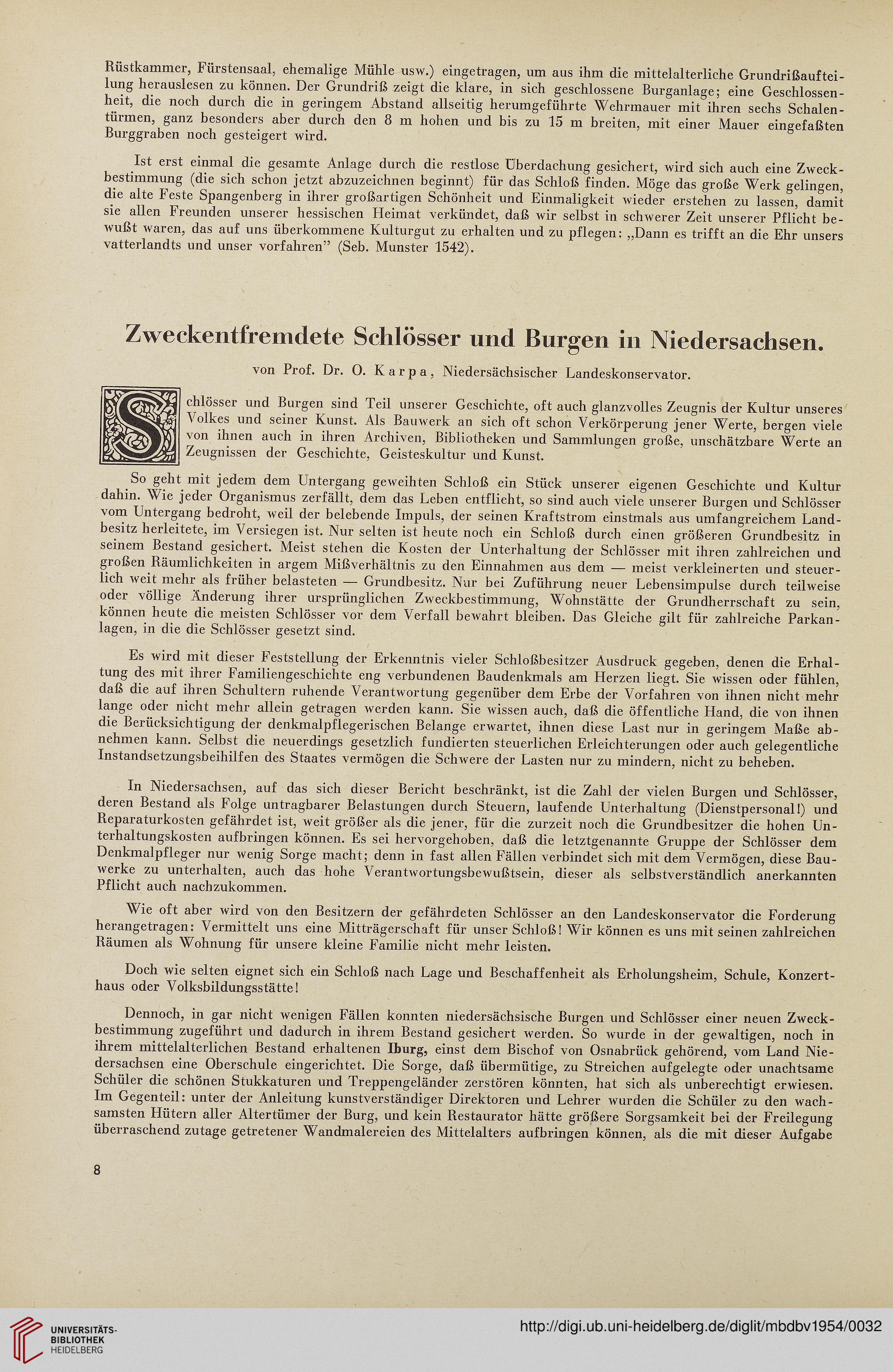Rüstkammer, Fürstensaal, ehemalige Mühle usw.) eingetragen, um aus ihm die mittelalterliche Grundrißauftei-
lung herauslcsen zu können. Der Grundriß zeigt die klare, in sich geschlossene Burganlage; eine Geschlossen-
heit, die noch durch die in geringem Abstand allseitig herumgeführte Wehrmauer mit ihren sechs Schalen -
türmen, ganz besonders aber durch den 8 m hohen und bis zu 15 m breiten, mit einer Mauer eingefaßten
Burggraben noch gesteigert wird.
Ist erst einmal die gesamte Anlage durch die restlose Überdachung gesichert, wird sich auch eine Zweck-
bestimmung (die sich schon jetzt abzuzeichnen beginnt) für das Schloß finden. Möge das große Werk gelingen,
die alte Feste Spangenberg in ihrer großartigen Schönheit und Einmaligkeit wieder erstehen zu lassen, damit
sie allen Freunden unserer hessischen Heimat verkündet, daß wir selbst in schwerer Zeit unserer Pflicht be-
wußt waren, das auf uns überkommene Kulturgut zu erhalten und zu pflegen: „Dann es trifft an die Ehr unsers
vatterlandts und unser Vorfahren" (Seb. Munster 1542).
Zweckentfremdete Schlösser und Burgen in Niedersachsen.
von Prof. Dr. O. K a r p a , Niedersächsischer Landeskonservator.
chlösser und Burgen sind Teil unserer Geschichte, oft auch glanzvolles Zeugnis der Kultur unseres
Volkes und seiner Kunst. Als Bauwerk an sich oft schon Verkörperung jener Werte, bergen viele
von ihnen auch in ihren Archiven, Bibliotheken und Sammlungen große, unschätzbare Werte an
Zeugnissen der Geschichte, Geisteskultur und Kunst.
So geht mit jedem dem Untergang geweihten Schloß ein Stück unserer eigenen Geschichte und Kultur
dahin. Wie jeder Organismus zerfällt, dem das Leben entflieht, so sind auch viele unserer Burgen und Schlösser
vom Untergang bedroht, weil der belebende Impuls, der seinen Kraftstrom einstmals aus umfangreichem Land-
besitz herleitetc, im Versiegen ist. Nur selten ist heute noch ein Schloß durch einen größeren Grundbesitz in
seinem Bestand gesichert. Meist stehen die Kosten der Unterhaltung der Schlösser mit ihren zahlreichen und
großen Räumlichkeiten in argem Mißverhältnis zu den Einnahmen aus dem — meist verkleinerten und steuer-
lich weit mehr als früher belasteten — Grundbesitz. Nur bei Zuführung neuer Lebensimpulse durch teilweise
oder völlige Änderung ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung, Wohnstätte der Grundherrschaft zu sein,
können heute die meisten Schlösser vor dem Verfall bewahrt bleiben. Das Gleiche gilt für zahlreiche Parkan-
lagen, in die die Schlösser gesetzt sind.
Es wird mit dieser Feststellung der Erkenntnis vieler Schloßbesitzer Ausdruck gegeben, denen die Erhal-
tung des mit ihrer Familiengeschichte eng verbundenen Baudenkmals am Herzen liegt. Sie wissen oder fühlen,
daß die auf ihren Schultern ruhende Verantwortung gegenüber dem Erbe der Vorfahren von ihnen nicht mehr
lange oder nicht mehr allein getragen werden kann. Sie wissen auch, daß die öffentliche Hand, die von ihnen
die Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange erwartet, ihnen diese Last nur in geringem Maße ab-
nehmen kann. Selbst die neuerdings gesetzlich fundierten steuerlichen Erleichterungen oder auch gelegentliche
Instandsetzungsbeihilfen des Staates vermögen die Schwere der Lasten nur zu mindern, nicht zu beheben.
In Niedersachsen, auf das sich dieser Bericht beschränkt, ist die Zahl der vielen Burgen und Schlösser,
deren Bestand als Folge untragbarer Belastungen durch Steuern, laufende Unterhaltung (Dienstpersonal!) und
Reparaturkosten gefährdet ist, weit größer als die jener, für die zurzeit noch die Grundbesitzer die hohen Un-
terhaltungskosten aufbringen können. Es sei hervorgehoben, daß die letztgenannte Gruppe der Schlösser dem
Denkmalpfleger nur wenig Sorge macht; denn in fast allen Fällen verbindet sich mit dem Vermögen, diese Bau-
werke zu unterhalten, auch das hohe Verantwortungsbewußtsein, dieser als selbstverständlich anerkannten
Pflicht auch nachzukommen.
Wie oft aber wird von den Besitzern der gefährdeten Schlösser an den Landeskonservator die Forderung
herangetragen: Vermittelt uns eine Mitträgerschaft für unser Schloß! Wir können es uns mit seinen zahlreichen
Räumen als Wohnung für unsere kleine Familie nicht mehr leisten.
Doch wie selten eignet sich ein Schloß nach Lage und Beschaffenheit als Erholungsheim, Schule, Konzert-
haus oder Volksbildungsstätte!
Dennoch, in gar nicht wenigen Fällen konnten niedersächsische Burgen und Schlösser einer neuen Zweck-
bestimmung zugeführt und dadurch in ihrem Bestand gesichert werden. So wurde in der gewaltigen, noch in
ihrem mittelalterlichen Bestand erhaltenen Iburg, einst dem Bischof von Osnabrück gehörend, vom Land Nie-
dersachsen eine Oberschule eingerichtet. Die Sorge, daß übermütige, zu Streichen aufgelegte oder unachtsame
Schüler die schönen Stukkaturen und Treppengeländer zerstören könnten, hat sich als unberechtigt erwiesen.
Im Gegenteil: unter der Anleitung kunstverständiger Direktoren und Lehrer wurden die Schüler zu den wach-
samsten Hütern aller Altertümer der Burg, und kein Restaurator hätte größere Sorgsamkeit bei der Freilegung
überraschend zutage getretener Wandmalereien des Mittelalters aufbringen können, als die mit dieser Aufgabe
8
lung herauslcsen zu können. Der Grundriß zeigt die klare, in sich geschlossene Burganlage; eine Geschlossen-
heit, die noch durch die in geringem Abstand allseitig herumgeführte Wehrmauer mit ihren sechs Schalen -
türmen, ganz besonders aber durch den 8 m hohen und bis zu 15 m breiten, mit einer Mauer eingefaßten
Burggraben noch gesteigert wird.
Ist erst einmal die gesamte Anlage durch die restlose Überdachung gesichert, wird sich auch eine Zweck-
bestimmung (die sich schon jetzt abzuzeichnen beginnt) für das Schloß finden. Möge das große Werk gelingen,
die alte Feste Spangenberg in ihrer großartigen Schönheit und Einmaligkeit wieder erstehen zu lassen, damit
sie allen Freunden unserer hessischen Heimat verkündet, daß wir selbst in schwerer Zeit unserer Pflicht be-
wußt waren, das auf uns überkommene Kulturgut zu erhalten und zu pflegen: „Dann es trifft an die Ehr unsers
vatterlandts und unser Vorfahren" (Seb. Munster 1542).
Zweckentfremdete Schlösser und Burgen in Niedersachsen.
von Prof. Dr. O. K a r p a , Niedersächsischer Landeskonservator.
chlösser und Burgen sind Teil unserer Geschichte, oft auch glanzvolles Zeugnis der Kultur unseres
Volkes und seiner Kunst. Als Bauwerk an sich oft schon Verkörperung jener Werte, bergen viele
von ihnen auch in ihren Archiven, Bibliotheken und Sammlungen große, unschätzbare Werte an
Zeugnissen der Geschichte, Geisteskultur und Kunst.
So geht mit jedem dem Untergang geweihten Schloß ein Stück unserer eigenen Geschichte und Kultur
dahin. Wie jeder Organismus zerfällt, dem das Leben entflieht, so sind auch viele unserer Burgen und Schlösser
vom Untergang bedroht, weil der belebende Impuls, der seinen Kraftstrom einstmals aus umfangreichem Land-
besitz herleitetc, im Versiegen ist. Nur selten ist heute noch ein Schloß durch einen größeren Grundbesitz in
seinem Bestand gesichert. Meist stehen die Kosten der Unterhaltung der Schlösser mit ihren zahlreichen und
großen Räumlichkeiten in argem Mißverhältnis zu den Einnahmen aus dem — meist verkleinerten und steuer-
lich weit mehr als früher belasteten — Grundbesitz. Nur bei Zuführung neuer Lebensimpulse durch teilweise
oder völlige Änderung ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung, Wohnstätte der Grundherrschaft zu sein,
können heute die meisten Schlösser vor dem Verfall bewahrt bleiben. Das Gleiche gilt für zahlreiche Parkan-
lagen, in die die Schlösser gesetzt sind.
Es wird mit dieser Feststellung der Erkenntnis vieler Schloßbesitzer Ausdruck gegeben, denen die Erhal-
tung des mit ihrer Familiengeschichte eng verbundenen Baudenkmals am Herzen liegt. Sie wissen oder fühlen,
daß die auf ihren Schultern ruhende Verantwortung gegenüber dem Erbe der Vorfahren von ihnen nicht mehr
lange oder nicht mehr allein getragen werden kann. Sie wissen auch, daß die öffentliche Hand, die von ihnen
die Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange erwartet, ihnen diese Last nur in geringem Maße ab-
nehmen kann. Selbst die neuerdings gesetzlich fundierten steuerlichen Erleichterungen oder auch gelegentliche
Instandsetzungsbeihilfen des Staates vermögen die Schwere der Lasten nur zu mindern, nicht zu beheben.
In Niedersachsen, auf das sich dieser Bericht beschränkt, ist die Zahl der vielen Burgen und Schlösser,
deren Bestand als Folge untragbarer Belastungen durch Steuern, laufende Unterhaltung (Dienstpersonal!) und
Reparaturkosten gefährdet ist, weit größer als die jener, für die zurzeit noch die Grundbesitzer die hohen Un-
terhaltungskosten aufbringen können. Es sei hervorgehoben, daß die letztgenannte Gruppe der Schlösser dem
Denkmalpfleger nur wenig Sorge macht; denn in fast allen Fällen verbindet sich mit dem Vermögen, diese Bau-
werke zu unterhalten, auch das hohe Verantwortungsbewußtsein, dieser als selbstverständlich anerkannten
Pflicht auch nachzukommen.
Wie oft aber wird von den Besitzern der gefährdeten Schlösser an den Landeskonservator die Forderung
herangetragen: Vermittelt uns eine Mitträgerschaft für unser Schloß! Wir können es uns mit seinen zahlreichen
Räumen als Wohnung für unsere kleine Familie nicht mehr leisten.
Doch wie selten eignet sich ein Schloß nach Lage und Beschaffenheit als Erholungsheim, Schule, Konzert-
haus oder Volksbildungsstätte!
Dennoch, in gar nicht wenigen Fällen konnten niedersächsische Burgen und Schlösser einer neuen Zweck-
bestimmung zugeführt und dadurch in ihrem Bestand gesichert werden. So wurde in der gewaltigen, noch in
ihrem mittelalterlichen Bestand erhaltenen Iburg, einst dem Bischof von Osnabrück gehörend, vom Land Nie-
dersachsen eine Oberschule eingerichtet. Die Sorge, daß übermütige, zu Streichen aufgelegte oder unachtsame
Schüler die schönen Stukkaturen und Treppengeländer zerstören könnten, hat sich als unberechtigt erwiesen.
Im Gegenteil: unter der Anleitung kunstverständiger Direktoren und Lehrer wurden die Schüler zu den wach-
samsten Hütern aller Altertümer der Burg, und kein Restaurator hätte größere Sorgsamkeit bei der Freilegung
überraschend zutage getretener Wandmalereien des Mittelalters aufbringen können, als die mit dieser Aufgabe
8