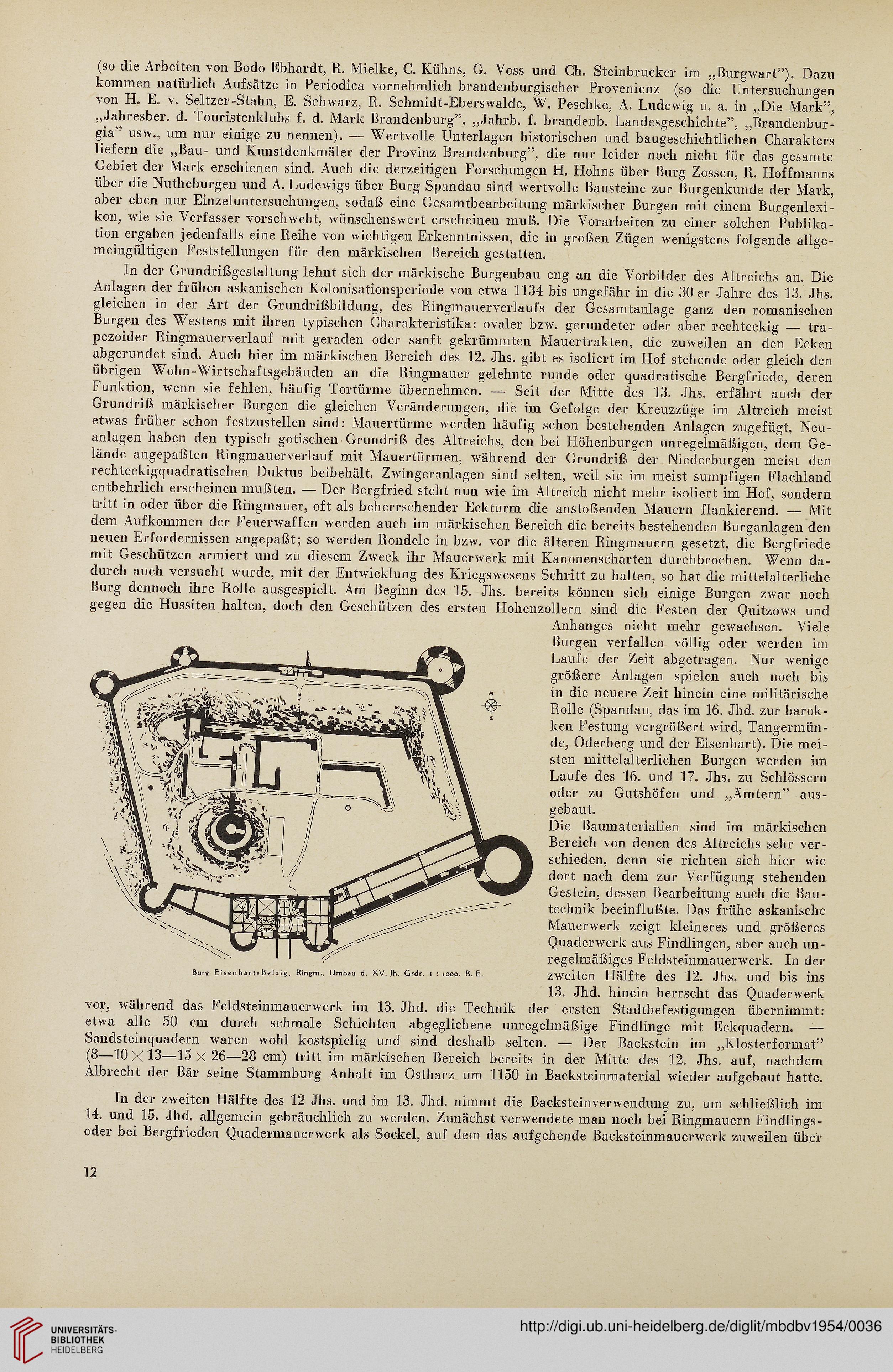(so die Arbeiten von Bodo Ebhardt, R. Mielke, G. Kiihns, G. Voss und Ch. Steinbrucker im „Burgwart"). Dazu
kommen natürlich Aufsätze in Periodica vornehmlich brandenburgischer Provenienz (so die Untersuchungen
von U. E. v. Seltzer-Stahn, E. Schwarz, R. Schinidt-Eberswalde, W. Peschke, A. Ludewig u. a. in „Die Mark",
„Jahresber. d. Touristenklubs f. d. Mark Brandenburg", „Jahrb. f. brandenb. Landesgeschichte", „Brandenbur-
gia" usw., um nur einige zu nennen). — Wertvolle Unterlagen historischen und baugeschichtlichen Charakters
liefern die „Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg", die nur leider noch nicht für das gesamte
Gebiet der Mark erschienen sind. Auch die derzeitigen Eorschungen H. Hohns über Burg Zossen, R. Hoffmanns
über die Nutheburgen und A. Ludewigs über Burg Spandau sind wertvolle Bausteine zur Burgenkunde der Mark,
aber eben nur Einzeluntersuchungen, sodaß eine Gesamtbearbeitung märkischer Burgen mit einem Burgenlexi-
kon, wie sie Verfasser vorschwebt, wünschenswert erscheinen muß. Die Vorarbeiten zu einer solchen Publika-
tion ergaben jedenfalls eine Reihe von wichtigen Erkenntnissen, die in großen Zügen wenigstens folgende allge-
meingültigen Feststellungen für den märkischen Bereich gestatten.
In der Grundrißgestaltung lehnt sich der märkische Burgenbau eng an die Vorbilder des Altreichs an. Die
Anlagen der frühen askanischen Kolonisationsperiode von etwa 1134 bis ungefähr in die 30 er Jahre des 13. Jhs.
gleichen in der Art der Grundrißbildung, des Ringmauerverlaufs der Gesamtanlage ganz den romanischen
Burgen des Westens mit ihren typischen Charakteristika: ovaler bzw. gerundeter oder aber rechteckig — tra-
pezoider Ringmauerverlauf mit geraden oder sanft gekrümmten Mauertrakten, die zuweilen an den Ecken
abgerundet sind. Auch hier im märkischen Bereich des 12. Jhs. gibt es isoliert im Hof stehende oder gleich den
übrigen Wohn-Wirtschaftsgebäuden an die Ringmauer gelehnte runde oder quadratische Bergfriede, deren
Funktion, wenn sie fehlen, häufig Tortürme übernehmen. — Seit der Mitte des 13. Jhs. erfährt auch der
Grundriß märkischer Burgen die gleichen Veränderungen, die im Gefolge der Kreuzzüge im Altreich meist
etwas früher schon festzustellen sind: Mauertürme werden häufig schon bestehenden Anlagen zugefügt, Neu-
anlagen haben den typisch gotischen Grundriß des Altreichs, den bei Höhenburgen unregelmäßigen, dem Ge-
lände angepaßten Ringmauerverlauf mit Mauertürmen, während der Grundriß der Niederburgen meist den
rechteckigquadratischen Duktus beibehält. Zwingeranlagen sind selten, weil sie im meist sumpfigen Flachland
entbehrlich erscheinen mußten. — Der Bergfried steht nun wie im Altreich nicht mehr isoliert im Hof, sondern
tritt in oder über die Ringmauer, oft als beherrschender Eckturm die anstoßenden Mauern flankierend. — Mit
dem Aufkommen der Feuerwaffen werden auch im märkischen Bereich die bereits bestehenden Burganlagen den
neuen Erfordernissen angepaßt; so werden Rondele in bzw. vor die älteren Ringmauern gesetzt, die Bergfriede
mit Geschützen armiert und zu diesem Zweck ihr Mauerwerk mit Kanonenscharten durchbrochen. Wenn da-
durch auch versucht wurde, mit der Entwicklung des Kriegswesens Schritt zu halten, so hat die mittelalterliche
Burg dennoch ihre Rolle ausgespielt. Am Beginn des 15. Jhs. bereits können sich einige Burgen zwar noch
gegen die Hussiten halten, doch den Geschützen des ersten Hohenzollern sind die Festen der Quitzows und
Anhanges nicht mehr gewachsen. Viele
Burgen verfallen völlig oder werden im
Laufe der Zeit abgetragen. Nur wenige
größere Anlagen spielen auch noch bis
in die neuere Zeit hinein eine militärische
Rolle (Spandau, das im 16. Jhd. zur barok-
ken Festung vergrößert wird, Tangermün-
de, Oderberg und der Eisenhart). Die mei-
sten mittelalterlichen Burgen werden im
Laufe des 16. und 17. Jhs. zu Schlössern
oder zu Gutshöfen und „Ämtern" aus-
gcbaut.
Die Baumaterialien sind im märkischen
Bereich von denen des Altreichs sehr ver-
schieden, denn sie richten sich hier wie
dort nach dem zur Verfügung stehenden
Gestein, dessen Bearbeitung auch die Bau-
technik beeinflußte. Das frühe askanische
Mauerwerk zeigt kleineres und größeres
Quaderwerk aus Findlingen, aber auch un-
regelmäßiges Feldsteinmauerwerk. In der
zweiten Hälfte des 12. Jhs. und bis ins
13. Jhd. hinein herrscht das Quaderwerk
vor, während das Feldsteinmauerwerk im 13. Jhd. die Technik der ersten Stadtbefestigungen übernimmt:
etwa alle 50 cm durch schmale Schichten abgeglichene unregelmäßige Findlinge mit Eckquadern. —
Sandsteinquadern waren wohl kostspielig und sind deshalb selten. — Der Backstein im „Klosterformat"
(8—10X13—15 x 26—28 cm) tritt im märkischen Bereich bereits in der Mitte des 12. Jhs. auf, nachdem
Albrecht der Bär seine Stammburg Anhalt im Ostharz um 1150 in Backsteinmaterial wieder aufgebaut hatte.
In der zweiten Hälfte des 12 Jhs. und im 13. Jhd. nimmt die Backsteinverwendung zu, um schließlich im
14. und 15. Jhd. allgemein gebräuchlich zu werden. Zunächst verwendete man noch bei Ringmauern Findlings-
oder bei Bergfrieden Quadermauerwerk als Sockel, auf dem das aufgehende Backsteinmauerwerk zuweilen über
12
kommen natürlich Aufsätze in Periodica vornehmlich brandenburgischer Provenienz (so die Untersuchungen
von U. E. v. Seltzer-Stahn, E. Schwarz, R. Schinidt-Eberswalde, W. Peschke, A. Ludewig u. a. in „Die Mark",
„Jahresber. d. Touristenklubs f. d. Mark Brandenburg", „Jahrb. f. brandenb. Landesgeschichte", „Brandenbur-
gia" usw., um nur einige zu nennen). — Wertvolle Unterlagen historischen und baugeschichtlichen Charakters
liefern die „Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg", die nur leider noch nicht für das gesamte
Gebiet der Mark erschienen sind. Auch die derzeitigen Eorschungen H. Hohns über Burg Zossen, R. Hoffmanns
über die Nutheburgen und A. Ludewigs über Burg Spandau sind wertvolle Bausteine zur Burgenkunde der Mark,
aber eben nur Einzeluntersuchungen, sodaß eine Gesamtbearbeitung märkischer Burgen mit einem Burgenlexi-
kon, wie sie Verfasser vorschwebt, wünschenswert erscheinen muß. Die Vorarbeiten zu einer solchen Publika-
tion ergaben jedenfalls eine Reihe von wichtigen Erkenntnissen, die in großen Zügen wenigstens folgende allge-
meingültigen Feststellungen für den märkischen Bereich gestatten.
In der Grundrißgestaltung lehnt sich der märkische Burgenbau eng an die Vorbilder des Altreichs an. Die
Anlagen der frühen askanischen Kolonisationsperiode von etwa 1134 bis ungefähr in die 30 er Jahre des 13. Jhs.
gleichen in der Art der Grundrißbildung, des Ringmauerverlaufs der Gesamtanlage ganz den romanischen
Burgen des Westens mit ihren typischen Charakteristika: ovaler bzw. gerundeter oder aber rechteckig — tra-
pezoider Ringmauerverlauf mit geraden oder sanft gekrümmten Mauertrakten, die zuweilen an den Ecken
abgerundet sind. Auch hier im märkischen Bereich des 12. Jhs. gibt es isoliert im Hof stehende oder gleich den
übrigen Wohn-Wirtschaftsgebäuden an die Ringmauer gelehnte runde oder quadratische Bergfriede, deren
Funktion, wenn sie fehlen, häufig Tortürme übernehmen. — Seit der Mitte des 13. Jhs. erfährt auch der
Grundriß märkischer Burgen die gleichen Veränderungen, die im Gefolge der Kreuzzüge im Altreich meist
etwas früher schon festzustellen sind: Mauertürme werden häufig schon bestehenden Anlagen zugefügt, Neu-
anlagen haben den typisch gotischen Grundriß des Altreichs, den bei Höhenburgen unregelmäßigen, dem Ge-
lände angepaßten Ringmauerverlauf mit Mauertürmen, während der Grundriß der Niederburgen meist den
rechteckigquadratischen Duktus beibehält. Zwingeranlagen sind selten, weil sie im meist sumpfigen Flachland
entbehrlich erscheinen mußten. — Der Bergfried steht nun wie im Altreich nicht mehr isoliert im Hof, sondern
tritt in oder über die Ringmauer, oft als beherrschender Eckturm die anstoßenden Mauern flankierend. — Mit
dem Aufkommen der Feuerwaffen werden auch im märkischen Bereich die bereits bestehenden Burganlagen den
neuen Erfordernissen angepaßt; so werden Rondele in bzw. vor die älteren Ringmauern gesetzt, die Bergfriede
mit Geschützen armiert und zu diesem Zweck ihr Mauerwerk mit Kanonenscharten durchbrochen. Wenn da-
durch auch versucht wurde, mit der Entwicklung des Kriegswesens Schritt zu halten, so hat die mittelalterliche
Burg dennoch ihre Rolle ausgespielt. Am Beginn des 15. Jhs. bereits können sich einige Burgen zwar noch
gegen die Hussiten halten, doch den Geschützen des ersten Hohenzollern sind die Festen der Quitzows und
Anhanges nicht mehr gewachsen. Viele
Burgen verfallen völlig oder werden im
Laufe der Zeit abgetragen. Nur wenige
größere Anlagen spielen auch noch bis
in die neuere Zeit hinein eine militärische
Rolle (Spandau, das im 16. Jhd. zur barok-
ken Festung vergrößert wird, Tangermün-
de, Oderberg und der Eisenhart). Die mei-
sten mittelalterlichen Burgen werden im
Laufe des 16. und 17. Jhs. zu Schlössern
oder zu Gutshöfen und „Ämtern" aus-
gcbaut.
Die Baumaterialien sind im märkischen
Bereich von denen des Altreichs sehr ver-
schieden, denn sie richten sich hier wie
dort nach dem zur Verfügung stehenden
Gestein, dessen Bearbeitung auch die Bau-
technik beeinflußte. Das frühe askanische
Mauerwerk zeigt kleineres und größeres
Quaderwerk aus Findlingen, aber auch un-
regelmäßiges Feldsteinmauerwerk. In der
zweiten Hälfte des 12. Jhs. und bis ins
13. Jhd. hinein herrscht das Quaderwerk
vor, während das Feldsteinmauerwerk im 13. Jhd. die Technik der ersten Stadtbefestigungen übernimmt:
etwa alle 50 cm durch schmale Schichten abgeglichene unregelmäßige Findlinge mit Eckquadern. —
Sandsteinquadern waren wohl kostspielig und sind deshalb selten. — Der Backstein im „Klosterformat"
(8—10X13—15 x 26—28 cm) tritt im märkischen Bereich bereits in der Mitte des 12. Jhs. auf, nachdem
Albrecht der Bär seine Stammburg Anhalt im Ostharz um 1150 in Backsteinmaterial wieder aufgebaut hatte.
In der zweiten Hälfte des 12 Jhs. und im 13. Jhd. nimmt die Backsteinverwendung zu, um schließlich im
14. und 15. Jhd. allgemein gebräuchlich zu werden. Zunächst verwendete man noch bei Ringmauern Findlings-
oder bei Bergfrieden Quadermauerwerk als Sockel, auf dem das aufgehende Backsteinmauerwerk zuweilen über
12