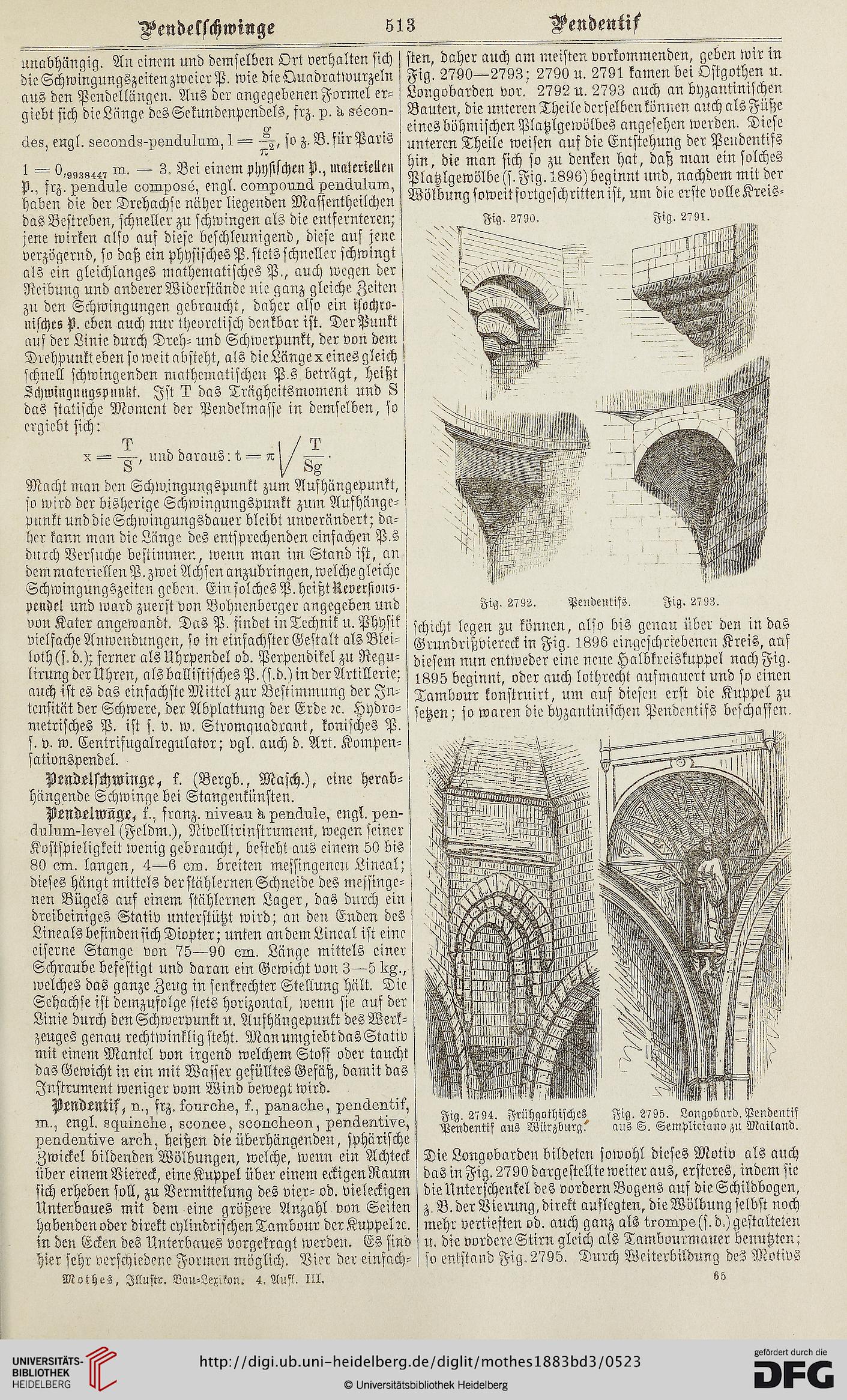WendekschwiAge
513
unabhängig. An einem und demselben Ort verhalten sich
dicSchwingungszcitenzweicrP. wie die Quadratwurzeln
aus den Pcndellängen. Aus der angegebenen Formel er-
giebt sich dieLänge des Sekundenpendels, frz. x. d sdoou-
ckee, engl, saoouäs-xsuäiilum, l — so z.B. für Paris
1 ----- 0,zgzg447 IN. — 3. Bei einem physischen P., materiellen
p., frz. xsnckals ooroxoss, engl, oomxounä xsnäulum,
haben die der Drehachse näher liegenden Massentheilchen
das Bestreben, schneller zu schwingen als die entfernteren;
jene wirken also aus diese beschleunigend, diese auf jene
verzögernd, so daß ein physisches P. stets schneller schwingt
als ein gleichlanges mathematisches P., auch wegen der
Reibung und anderer Widerstände nie ganz gleiche Zeiten
zu den Schwingungen gebraucht, daher also ein isochro-
nisches p. eben auch nur theoretisch denkbar ist. Der Punkt
auf der Linie durch Dreh- und Schwerpunkt, der von dem
Drehpunkt eben so weit absteht, als die Länge x eines gleich
schnell schwingenden mathematischen P.s beträgt, heißt
Achwmgnngspnullt. Ist 1 das Trägheitsmoment und 8
das statische Moment der Pendclmasse in demselben, so
ergiebt sich:
1 l / R
x ------1, und daraus: t ----- n / -
Macht man den Schw.ingungspunkt zum Aushüngepunkt,
so wird der bisherige Schwingungspunkt zum Aufhängc-
punkt unddieSchwingungsdauer bleibt unverändert; da-
her kann man die Lange des entsprechenden einfachen P.s
durch Versuche bestimmen, wenn man im Stand ist, an
demmateriellen P. zwei Achsen anzubringen, welche gleiche
Schwingungszeitcn geben. Ein solches P. heißtLcversions-
pcndel und ward zuerst von Bohnenberger angegeben und
von Kater angewandt. Das P. findet in Technik u. Physik
vielfache Anwendungen, so in einfachster Gestalt als Blei-
loth(s.d.); ferner als Uhrpendel od. Perpendikel zu Regu-
lirung der Uhren, als ballistisches P.is.d.) in der Artillerie;
auch ist cs das einfachste Mittel zur Bestimmung der In-
tensität der Schwere, der Abplattung der Erde w. Hydro-
metrisches P. ist s. v. w. Stromquadrant, konisches P.
s. v. w. Centrifugalregulator; vgl. auch d. Art. Kompen-
sationspendel.
Peudelschwinge^ 1. (Bergb., Masch.), eine herab-
hängende Schwinge bei Stangenkünsten.
PerrdelwUge, i., franz. nivauu d xenclule, engl, xsu-
äulurn-ltzval (Feldm.), Nivellirinstrumcnt, wegen seiner
Kostspieligkeit wenig gebraucht, besteht aus einem 50 bis
80 onr. langen, 4—6 oro. breiten messingenen Lineal;
dieses hängt mittels derstählernen Schneide des messinge-
nen Bügels auf einem stählernen Lager, das durch ein
dreibeiniges Stativ unterstützt wird; an den Enden des
Lineals befinden sich Diopter; unten an dem Lineal ist eine
eiserne Stange von 75—90 onr. Länge mittels einer
Schraube befestigt und daran ein Gewicht von 3—5 llA.,
welches das ganze Zeug in senkrechter Stellung hält. Die
Sehachse ist deinzufolge stets horizontal, wenn sie auf der
Linie durch den Schwerpunkt u. Aushängepunkt des Werk-
zeuges genau rechtwinklig steht. Man umgiebt das Stativ
mit einem Mantel von irgend welchem Stoff oder taucht
das Gewicht in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, damit das
Instrument weniger vom Wind bewegt wird.
DrudLNtif- u., srz. llonrolls, xanaotio, x6nel6nt.it',
m., engl, sgninolls, soonce, soonolrson, xknäontivs,
xsnclsntivS uroll, heißen die überhängenden, sphärische
Zwickel bildenden Wölbungen, welche, wenn ein Achteck
über einem Viereck, eineKuppel über einem eckigen Raum
sich erheben soll, zu Vermittelung des vier- od. vieleckigen
Unterbaues mit dem eine größere Anzahl von Seiten
habenden oder direkt cylindrischen Tambour der Kuppel re.
in den Ecken des Unterbaues vorgekragt werden. Es sind
hier sehr verschiedene Formen möglich. Vier der einsach-
Moihes, Jllustr. Vau-LexUon. 4. Ausl. III.
sten, daher auch am meisten vorkommendcn, geben wir in
Fig. 2790-2793; 2790 u. 2791 kamen bei Ostgothen u.
Langobarden vor. 2792 u. 2793 auch an byzantinischen
Bauten, die unterenTheilcdcrselbenkönuen auch alsFüße
einesböhmischen Platzlgewölbes angesehen werden. Diese
unteren Theile weisen auf die Entstehung der Pendcntifs
hin, die man sich so zu denken hat, daß man ein solches
Platzlgewölbe ss.Fig. 1896)beginnt und, nachdem mit der
Wölbung soweitfortgeschritten ist, um die erste volleKreis-
F'g. 2791.
Fig. 2792. Pendeiitifs. Fig. 2793.
schickst legen zu können, also bis genau über den in das
Grundrißviereck in Fig. 1896 eingeschriebenen Kreis, ans
diesem nun entweder eine neue Halbkreiskuppel nach Fig.
1895 beginnt, oder auch lothrccht aufmauert und so einen
Tambour konstruirt, um auf diesen erst die Kuppel zu
setzen; so waren die byzantinischen Pendentifs beschaffen.
Fig. 279-t. Frühgothisches
Peudentif aas Wiirzburgk
Fig. 2795. Longobaid.Pendentif
aus S. Sempliciano zu Mailand.
Die Longobarden bildeten sowohl dieses Motiv als auch
das in Fig. 2790 dargestelltc weiter aus, ersteres, indem sie
die Unterschenkel des vordem Bogens auf die Schildbogen,
z.B. der Vierung, direkt auslegten, die Wölbung selbst noch
mehr vertieften od. auch ganz als Iromxs ss.d.) gestalteten
u, die vordere Stirn gleich als Tambourmauer benutzten;
so entstand Fig. 2795. Durch Weiterbildung des Motivs
513
unabhängig. An einem und demselben Ort verhalten sich
dicSchwingungszcitenzweicrP. wie die Quadratwurzeln
aus den Pcndellängen. Aus der angegebenen Formel er-
giebt sich dieLänge des Sekundenpendels, frz. x. d sdoou-
ckee, engl, saoouäs-xsuäiilum, l — so z.B. für Paris
1 ----- 0,zgzg447 IN. — 3. Bei einem physischen P., materiellen
p., frz. xsnckals ooroxoss, engl, oomxounä xsnäulum,
haben die der Drehachse näher liegenden Massentheilchen
das Bestreben, schneller zu schwingen als die entfernteren;
jene wirken also aus diese beschleunigend, diese auf jene
verzögernd, so daß ein physisches P. stets schneller schwingt
als ein gleichlanges mathematisches P., auch wegen der
Reibung und anderer Widerstände nie ganz gleiche Zeiten
zu den Schwingungen gebraucht, daher also ein isochro-
nisches p. eben auch nur theoretisch denkbar ist. Der Punkt
auf der Linie durch Dreh- und Schwerpunkt, der von dem
Drehpunkt eben so weit absteht, als die Länge x eines gleich
schnell schwingenden mathematischen P.s beträgt, heißt
Achwmgnngspnullt. Ist 1 das Trägheitsmoment und 8
das statische Moment der Pendclmasse in demselben, so
ergiebt sich:
1 l / R
x ------1, und daraus: t ----- n / -
Macht man den Schw.ingungspunkt zum Aushüngepunkt,
so wird der bisherige Schwingungspunkt zum Aufhängc-
punkt unddieSchwingungsdauer bleibt unverändert; da-
her kann man die Lange des entsprechenden einfachen P.s
durch Versuche bestimmen, wenn man im Stand ist, an
demmateriellen P. zwei Achsen anzubringen, welche gleiche
Schwingungszeitcn geben. Ein solches P. heißtLcversions-
pcndel und ward zuerst von Bohnenberger angegeben und
von Kater angewandt. Das P. findet in Technik u. Physik
vielfache Anwendungen, so in einfachster Gestalt als Blei-
loth(s.d.); ferner als Uhrpendel od. Perpendikel zu Regu-
lirung der Uhren, als ballistisches P.is.d.) in der Artillerie;
auch ist cs das einfachste Mittel zur Bestimmung der In-
tensität der Schwere, der Abplattung der Erde w. Hydro-
metrisches P. ist s. v. w. Stromquadrant, konisches P.
s. v. w. Centrifugalregulator; vgl. auch d. Art. Kompen-
sationspendel.
Peudelschwinge^ 1. (Bergb., Masch.), eine herab-
hängende Schwinge bei Stangenkünsten.
PerrdelwUge, i., franz. nivauu d xenclule, engl, xsu-
äulurn-ltzval (Feldm.), Nivellirinstrumcnt, wegen seiner
Kostspieligkeit wenig gebraucht, besteht aus einem 50 bis
80 onr. langen, 4—6 oro. breiten messingenen Lineal;
dieses hängt mittels derstählernen Schneide des messinge-
nen Bügels auf einem stählernen Lager, das durch ein
dreibeiniges Stativ unterstützt wird; an den Enden des
Lineals befinden sich Diopter; unten an dem Lineal ist eine
eiserne Stange von 75—90 onr. Länge mittels einer
Schraube befestigt und daran ein Gewicht von 3—5 llA.,
welches das ganze Zeug in senkrechter Stellung hält. Die
Sehachse ist deinzufolge stets horizontal, wenn sie auf der
Linie durch den Schwerpunkt u. Aushängepunkt des Werk-
zeuges genau rechtwinklig steht. Man umgiebt das Stativ
mit einem Mantel von irgend welchem Stoff oder taucht
das Gewicht in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, damit das
Instrument weniger vom Wind bewegt wird.
DrudLNtif- u., srz. llonrolls, xanaotio, x6nel6nt.it',
m., engl, sgninolls, soonce, soonolrson, xknäontivs,
xsnclsntivS uroll, heißen die überhängenden, sphärische
Zwickel bildenden Wölbungen, welche, wenn ein Achteck
über einem Viereck, eineKuppel über einem eckigen Raum
sich erheben soll, zu Vermittelung des vier- od. vieleckigen
Unterbaues mit dem eine größere Anzahl von Seiten
habenden oder direkt cylindrischen Tambour der Kuppel re.
in den Ecken des Unterbaues vorgekragt werden. Es sind
hier sehr verschiedene Formen möglich. Vier der einsach-
Moihes, Jllustr. Vau-LexUon. 4. Ausl. III.
sten, daher auch am meisten vorkommendcn, geben wir in
Fig. 2790-2793; 2790 u. 2791 kamen bei Ostgothen u.
Langobarden vor. 2792 u. 2793 auch an byzantinischen
Bauten, die unterenTheilcdcrselbenkönuen auch alsFüße
einesböhmischen Platzlgewölbes angesehen werden. Diese
unteren Theile weisen auf die Entstehung der Pendcntifs
hin, die man sich so zu denken hat, daß man ein solches
Platzlgewölbe ss.Fig. 1896)beginnt und, nachdem mit der
Wölbung soweitfortgeschritten ist, um die erste volleKreis-
F'g. 2791.
Fig. 2792. Pendeiitifs. Fig. 2793.
schickst legen zu können, also bis genau über den in das
Grundrißviereck in Fig. 1896 eingeschriebenen Kreis, ans
diesem nun entweder eine neue Halbkreiskuppel nach Fig.
1895 beginnt, oder auch lothrccht aufmauert und so einen
Tambour konstruirt, um auf diesen erst die Kuppel zu
setzen; so waren die byzantinischen Pendentifs beschaffen.
Fig. 279-t. Frühgothisches
Peudentif aas Wiirzburgk
Fig. 2795. Longobaid.Pendentif
aus S. Sempliciano zu Mailand.
Die Longobarden bildeten sowohl dieses Motiv als auch
das in Fig. 2790 dargestelltc weiter aus, ersteres, indem sie
die Unterschenkel des vordem Bogens auf die Schildbogen,
z.B. der Vierung, direkt auslegten, die Wölbung selbst noch
mehr vertieften od. auch ganz als Iromxs ss.d.) gestalteten
u, die vordere Stirn gleich als Tambourmauer benutzten;
so entstand Fig. 2795. Durch Weiterbildung des Motivs