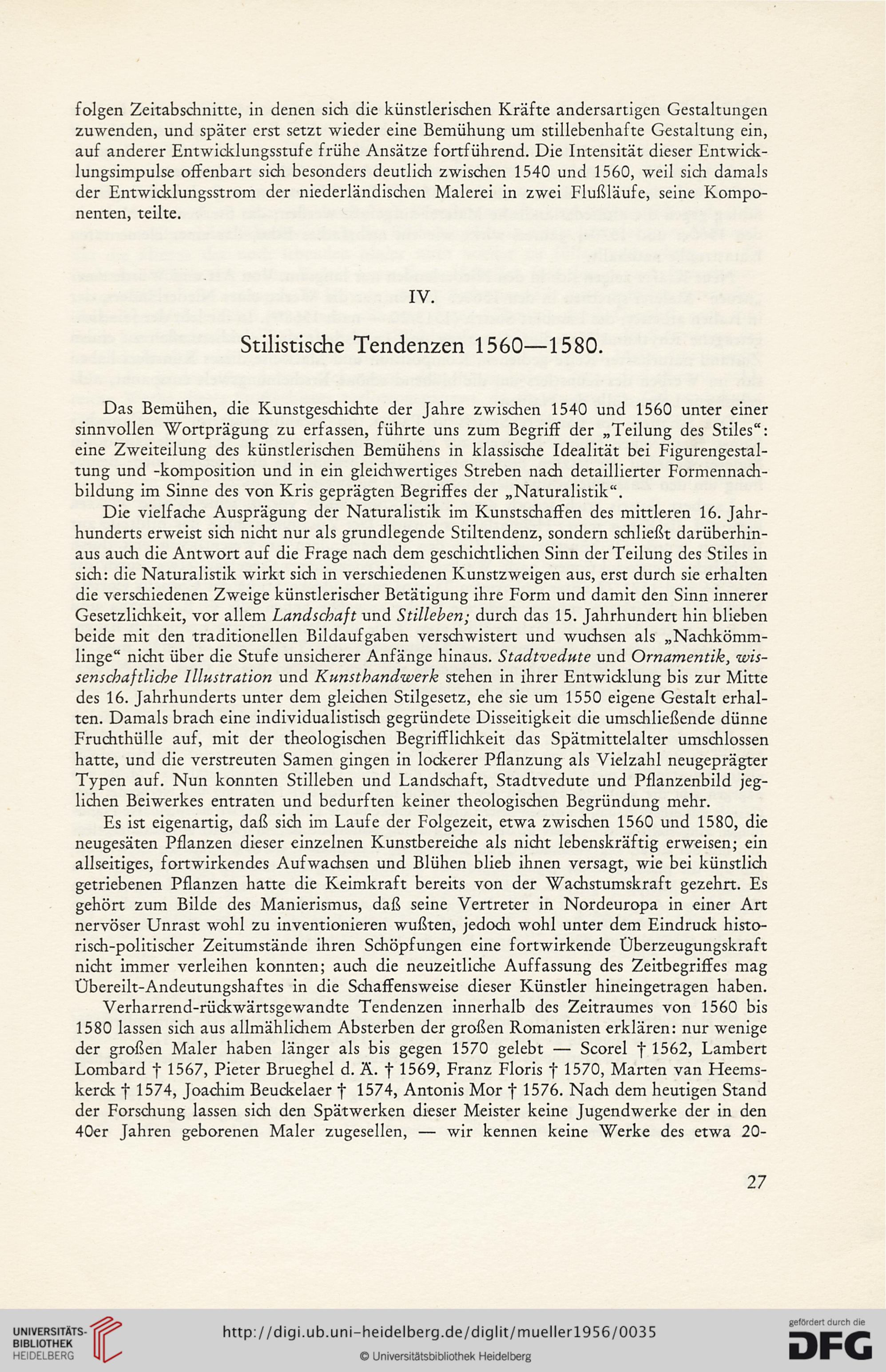folgen Zeitabschnitte, in denen sich die künstlerischen Kräfte andersartigen Gestaltungen
zuwenden, und später erst setzt wieder eine Bemühung um stillebenhafte Gestaltung ein,
auf anderer Entwicklungsstufe friihe Ansätze fortfiihrend. Die Intensität dieser Entwick-
lungsimpulse offenbart sich besonders deutlich zwischen 1540 und 1560, weil sich damals
der Entwicklungsstrom der niederländischen Malerei in zwei Flußläufe, seine Kompo-
nenten, teilte.
IV.
Stilistische Tendenzen 1560—1580.
Das Bemühen, die Kunstgeschichte der Jahre zwischen 1540 und 1560 unter einer
sinnvollen Wortprägung zu erfassen, führte uns zum Begriff der „Teilung des Stiles“:
eine Zweiteilung des künstlerischen Bemühens in klassische Idealität bei Figurengestal-
tung und -komposition und in ein gleichwertiges Streben nach detaillierter Formennach-
bildung im Sinne des von Kris geprägten Begriffes der „Naturalistik“.
Die vielfache Ausprägung der Naturalistik im Kunstsdhaffen des mittleren 16. Jahr-
hunderts erweist sich nicht nur als grundlegende Stiltendenz, sondern schließt darüberhin-
aus auch die Antwort auf die Frage nach dem geschichtlichen Sinn derTeilung des Stiles in
sich: die Naturalistik wirkt sich in verschiedenen Kunstzweigen aus, erst durch sie erhalten
die versdhiedenen Zweige künstlerischer Betätigung ihre Form und damit den Sinn innerer
Gesetzlichkeit, vor allem Landschaft und Stillehen; durch das 15. Jahrhundert hin blieben
beide mit den traditionellen Bildaufgaben verschwistert und wuchsen als „Nachkömm-
linge“ nicht über die Stufe unsicherer Anfänge hinaus. Stadtvedute und Ornamentik, wis-
senschaftliche lllustration und Kunsthandwerk stehen in ihrer Entwicklung bis zur Mitte
des 16. Jahrhunderts unter dem gleichen Stilgesetz, ehe sie um 1550 eigene Gestalt erhal-
ten. Damals brach eine individualistisch gegründete Disseitigkeit die umschließende dünne
Fruchthülle auf, mit der theologischen Begrifflichkeit das Spätmittelalter umschlossen
hatte, und die verstreuten Samen gingen in lockerer Pflanzung als Vielzahl neugeprägter
Typen auf. Nun konnten Stilleben und Landschaft, Stadtvedute und Pflanzenbild jeg-
lichen Beiwerkes entraten und bedurften keiner theologischen Begründung mehr.
Es ist eigenartig, daß sich im Laufe der Folgezeit, etwa zwischen 1560 und 1580, die
neugesäten Pflanzen dieser einzelnen Kunstbereiche als nicht lebenskräftig erweisen; ein
allseitiges, fortwirkendes Aufwachsen und Blühen blieb ihnen versagt, wie bei künstlich
getriebenen Pflanzen hatte die Keimkraft bereits von der Wachstumskraft gezehrt. Es
gehört zum Bilde des Manierismus, daß seine Vertreter in Nordeuropa in einer Art
nervöser Unrast wohl zu inventionieren wußten, jedoch wohl unter dem Eindruck histo-
risch-politischer Zeitumstände ihren Schöpfungen eine fortwirkende Überzeugungskraft
nicht immer verleihen konnten; auch die neuzeitliche Auffassung des Zeitbegriffes mag
Übereilt-Andeutungshaftes in die Schaffensweise dieser Künstler hineingetragen haben.
Verharrend-rückwärtsgewandte Tendenzen innerhalb des Zeitraumes von 1560 bis
1580 lassen sich aus allmählichem Absterben der großen Romanisten erklären: nur wenige
der großen Maler haben länger als bis gegen 1570 gelebt — Scorel J 1562, Lambert
Lombard f 1567, Pieter Brueghel d. Ä. f 1569, Franz Floris J 1570, Marten van Heems-
kerck f 1574, Joachim Beuckelaer f 1574, Antonis Mor f 1576. Nach dem heutigen Stand
der Forschung lassen sich den Spätwerken dieser Meister keine Jugendwerke der in den
40er Jahren geborenen Maler zugesellen, — wir kennen keine Werke des etwa 20-
27
zuwenden, und später erst setzt wieder eine Bemühung um stillebenhafte Gestaltung ein,
auf anderer Entwicklungsstufe friihe Ansätze fortfiihrend. Die Intensität dieser Entwick-
lungsimpulse offenbart sich besonders deutlich zwischen 1540 und 1560, weil sich damals
der Entwicklungsstrom der niederländischen Malerei in zwei Flußläufe, seine Kompo-
nenten, teilte.
IV.
Stilistische Tendenzen 1560—1580.
Das Bemühen, die Kunstgeschichte der Jahre zwischen 1540 und 1560 unter einer
sinnvollen Wortprägung zu erfassen, führte uns zum Begriff der „Teilung des Stiles“:
eine Zweiteilung des künstlerischen Bemühens in klassische Idealität bei Figurengestal-
tung und -komposition und in ein gleichwertiges Streben nach detaillierter Formennach-
bildung im Sinne des von Kris geprägten Begriffes der „Naturalistik“.
Die vielfache Ausprägung der Naturalistik im Kunstsdhaffen des mittleren 16. Jahr-
hunderts erweist sich nicht nur als grundlegende Stiltendenz, sondern schließt darüberhin-
aus auch die Antwort auf die Frage nach dem geschichtlichen Sinn derTeilung des Stiles in
sich: die Naturalistik wirkt sich in verschiedenen Kunstzweigen aus, erst durch sie erhalten
die versdhiedenen Zweige künstlerischer Betätigung ihre Form und damit den Sinn innerer
Gesetzlichkeit, vor allem Landschaft und Stillehen; durch das 15. Jahrhundert hin blieben
beide mit den traditionellen Bildaufgaben verschwistert und wuchsen als „Nachkömm-
linge“ nicht über die Stufe unsicherer Anfänge hinaus. Stadtvedute und Ornamentik, wis-
senschaftliche lllustration und Kunsthandwerk stehen in ihrer Entwicklung bis zur Mitte
des 16. Jahrhunderts unter dem gleichen Stilgesetz, ehe sie um 1550 eigene Gestalt erhal-
ten. Damals brach eine individualistisch gegründete Disseitigkeit die umschließende dünne
Fruchthülle auf, mit der theologischen Begrifflichkeit das Spätmittelalter umschlossen
hatte, und die verstreuten Samen gingen in lockerer Pflanzung als Vielzahl neugeprägter
Typen auf. Nun konnten Stilleben und Landschaft, Stadtvedute und Pflanzenbild jeg-
lichen Beiwerkes entraten und bedurften keiner theologischen Begründung mehr.
Es ist eigenartig, daß sich im Laufe der Folgezeit, etwa zwischen 1560 und 1580, die
neugesäten Pflanzen dieser einzelnen Kunstbereiche als nicht lebenskräftig erweisen; ein
allseitiges, fortwirkendes Aufwachsen und Blühen blieb ihnen versagt, wie bei künstlich
getriebenen Pflanzen hatte die Keimkraft bereits von der Wachstumskraft gezehrt. Es
gehört zum Bilde des Manierismus, daß seine Vertreter in Nordeuropa in einer Art
nervöser Unrast wohl zu inventionieren wußten, jedoch wohl unter dem Eindruck histo-
risch-politischer Zeitumstände ihren Schöpfungen eine fortwirkende Überzeugungskraft
nicht immer verleihen konnten; auch die neuzeitliche Auffassung des Zeitbegriffes mag
Übereilt-Andeutungshaftes in die Schaffensweise dieser Künstler hineingetragen haben.
Verharrend-rückwärtsgewandte Tendenzen innerhalb des Zeitraumes von 1560 bis
1580 lassen sich aus allmählichem Absterben der großen Romanisten erklären: nur wenige
der großen Maler haben länger als bis gegen 1570 gelebt — Scorel J 1562, Lambert
Lombard f 1567, Pieter Brueghel d. Ä. f 1569, Franz Floris J 1570, Marten van Heems-
kerck f 1574, Joachim Beuckelaer f 1574, Antonis Mor f 1576. Nach dem heutigen Stand
der Forschung lassen sich den Spätwerken dieser Meister keine Jugendwerke der in den
40er Jahren geborenen Maler zugesellen, — wir kennen keine Werke des etwa 20-
27