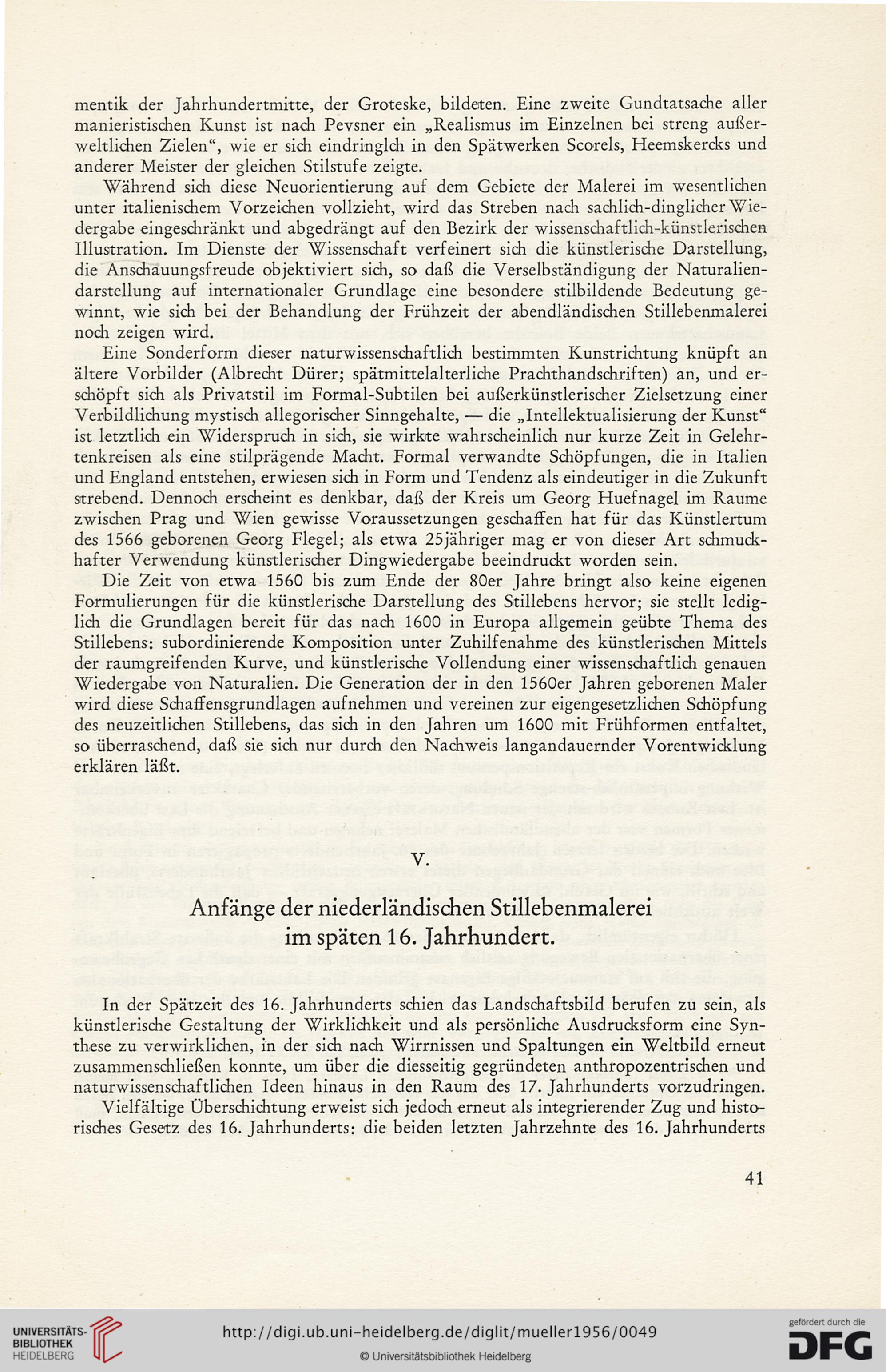mentik der Jahrhundertmitte, der Groteske, bildeten. Eine zweite Gundtatsache aller
manieristischen Kunst ist nach Pevsner ein „Realismus im Einzelnen bei streng außer-
weltlichen Zielen“, wie er sich eindringlch in den Spätwerken Scorels, Heemskercks und
anderer Meister der gleichen Stilstufe zeigte.
Während sich diese Neuorientierung auf dem Gebiete der Malerei im wesentlichen
unter italienischem Vorzeichen vollzieht, wird das Streben nadt sachlich-dinglicher Wie-
dergabe eingeschränkt und abgedrängt auf den Bezirk der wissenschaftlich-künstlerischen
Illustration. Im Dienste der Wissenschaft verfeinert sich die künstlerische Darstellung,
die Anschauungsfreude objektiviert sich, so daß die Verselbständigung der Naturalien-
darstellung auf internationaler Grundlage eine besondere stilbildende Bedeutung ge-
winnt, wie sich bei der Behandlung der Frühzeit der abendländischen Stillebenmalerei
nodi zeigen wird.
Eine Sonderform dieser naturwissenschaftlich bestimmten Kunstrichtung knüpft an
ältere Vorbilder (Albrecht Dürer; spätmittelalterliche Prachthandschriften) an, und er-
schöpft sich als Privatstil im Formal-Subtilen bei außerkünstlerischer Zielsetzung einer
Verbildlichung mystisch allegorischer Sinngehalte, — die „Intellektualisierung der Kunst“
ist letztlich ein Widerspruch in sich, sie wirkte wahrscheinlich nur kurze Zeit in Gelehr-
tenkreisen als eine stilprägende Macht. Formal verwandte Schöpfungen, die in Italien
und England entstehen, erwiesen sich in Form und Tendenz als eindeutiger in die Zukunft
strebend. Dennoch erscheint es denkbar, daß der Kreis um Georg Huefnagel im Raume
zwischen Prag und Wien gewisse Voraussetzungen geschaffen hat für das Künstlertum
des 1566 geborenen Georg Flegel; als etwa 25jähriger mag er von dieser Art schmuck-
hafter Verwendung künstlerischer Dingwiedergabe beeindruckt worden sein.
Die Zeit von etwa 1560 bis zum Ende der 80er Jahre bringt also keine eigenen
Formulierungen für die künstlerische Darstellung des Stillebens hervor; sie stellt ledig-
lich die Grundlagen bereit für das nach 1600 in Europa allgemein geübte Thema des
Stillebens: subordinierende Komposition unter Zuhilfenahme des künstlerischen Mittels
der raumgreifenden Kurve, und künstlerische Vollendung einer wissenschaftlich genauen
Wiedergabe von Naturalien. Die Generation der in den 1560er Jahren geborenen Maler
wird diese Schaffensgrundlagen aufnehmen und vereinen zur eigengesetzlichen Schöpfung
des neuzeitlichen Stillebens, das sich in den Jahren um 1600 mit Frühformen entfaltet,
so überraschend, daß sie sich nur durch den Nachweis langandauernder Vorentwicklung
erklären läßt.
V.
Anfänge der niederländisdien Stillebenmalerei
im späten 16. Jahrhundert.
In der Spätzeit des 16. Jahrhunderts schien das Landschaftsbild berufen zu sein, als
künstlerische Gestaltung der Wirklichkeit und als persönliche Ausdrucksform eine Syn-
these zu verwirklichen, in der sich nach Wirrnissen und Spaltungen ein Weltbild erneut
zusammenschließen konnte, um über die diesseitig gegründeten anthropozentrischen und
naturwissenschaftlichen Ideen hinaus in den Raum des 17. Jahrhunderts vorzudringen.
Vielfältige Überschichtung erweist sich jedoch erneut als integrierender Zug und histo-
risches Gesetz des 16. Jahrhunderts: die beiden letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts
41
manieristischen Kunst ist nach Pevsner ein „Realismus im Einzelnen bei streng außer-
weltlichen Zielen“, wie er sich eindringlch in den Spätwerken Scorels, Heemskercks und
anderer Meister der gleichen Stilstufe zeigte.
Während sich diese Neuorientierung auf dem Gebiete der Malerei im wesentlichen
unter italienischem Vorzeichen vollzieht, wird das Streben nadt sachlich-dinglicher Wie-
dergabe eingeschränkt und abgedrängt auf den Bezirk der wissenschaftlich-künstlerischen
Illustration. Im Dienste der Wissenschaft verfeinert sich die künstlerische Darstellung,
die Anschauungsfreude objektiviert sich, so daß die Verselbständigung der Naturalien-
darstellung auf internationaler Grundlage eine besondere stilbildende Bedeutung ge-
winnt, wie sich bei der Behandlung der Frühzeit der abendländischen Stillebenmalerei
nodi zeigen wird.
Eine Sonderform dieser naturwissenschaftlich bestimmten Kunstrichtung knüpft an
ältere Vorbilder (Albrecht Dürer; spätmittelalterliche Prachthandschriften) an, und er-
schöpft sich als Privatstil im Formal-Subtilen bei außerkünstlerischer Zielsetzung einer
Verbildlichung mystisch allegorischer Sinngehalte, — die „Intellektualisierung der Kunst“
ist letztlich ein Widerspruch in sich, sie wirkte wahrscheinlich nur kurze Zeit in Gelehr-
tenkreisen als eine stilprägende Macht. Formal verwandte Schöpfungen, die in Italien
und England entstehen, erwiesen sich in Form und Tendenz als eindeutiger in die Zukunft
strebend. Dennoch erscheint es denkbar, daß der Kreis um Georg Huefnagel im Raume
zwischen Prag und Wien gewisse Voraussetzungen geschaffen hat für das Künstlertum
des 1566 geborenen Georg Flegel; als etwa 25jähriger mag er von dieser Art schmuck-
hafter Verwendung künstlerischer Dingwiedergabe beeindruckt worden sein.
Die Zeit von etwa 1560 bis zum Ende der 80er Jahre bringt also keine eigenen
Formulierungen für die künstlerische Darstellung des Stillebens hervor; sie stellt ledig-
lich die Grundlagen bereit für das nach 1600 in Europa allgemein geübte Thema des
Stillebens: subordinierende Komposition unter Zuhilfenahme des künstlerischen Mittels
der raumgreifenden Kurve, und künstlerische Vollendung einer wissenschaftlich genauen
Wiedergabe von Naturalien. Die Generation der in den 1560er Jahren geborenen Maler
wird diese Schaffensgrundlagen aufnehmen und vereinen zur eigengesetzlichen Schöpfung
des neuzeitlichen Stillebens, das sich in den Jahren um 1600 mit Frühformen entfaltet,
so überraschend, daß sie sich nur durch den Nachweis langandauernder Vorentwicklung
erklären läßt.
V.
Anfänge der niederländisdien Stillebenmalerei
im späten 16. Jahrhundert.
In der Spätzeit des 16. Jahrhunderts schien das Landschaftsbild berufen zu sein, als
künstlerische Gestaltung der Wirklichkeit und als persönliche Ausdrucksform eine Syn-
these zu verwirklichen, in der sich nach Wirrnissen und Spaltungen ein Weltbild erneut
zusammenschließen konnte, um über die diesseitig gegründeten anthropozentrischen und
naturwissenschaftlichen Ideen hinaus in den Raum des 17. Jahrhunderts vorzudringen.
Vielfältige Überschichtung erweist sich jedoch erneut als integrierender Zug und histo-
risches Gesetz des 16. Jahrhunderts: die beiden letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts
41