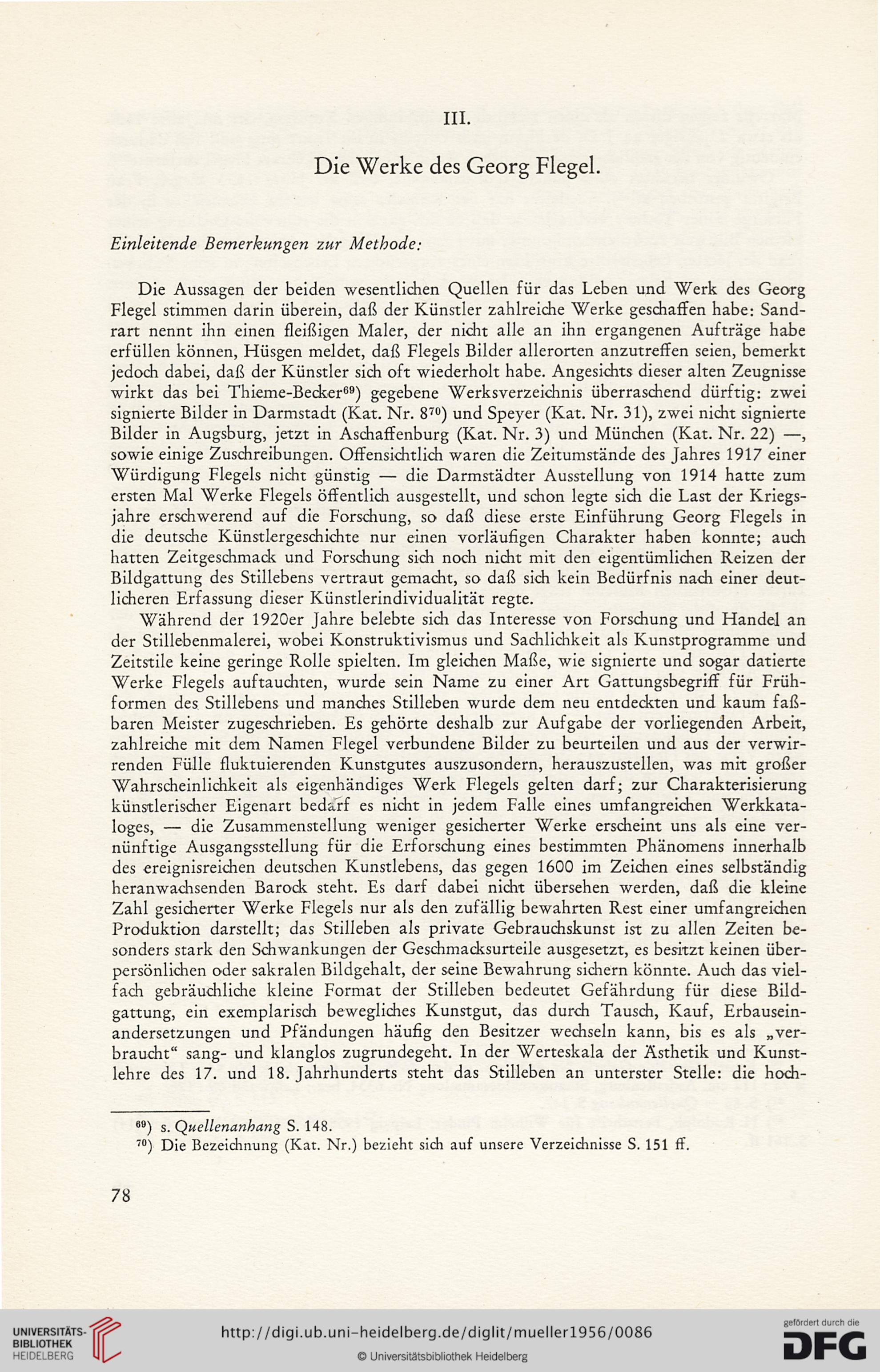III.
Die Werke des Georg Flegel.
Einleitende Bemerkungen zur Methode:
Die Aussagen der beiden wesentlichen Quellen für das Leben und Werk des Georg
Flegel stimmen darin überein, daß der Kiinstler zahlreiche Werke geschaffen habe: Sand-
rart nennt ihn einen fleißigen Maler, der nicht alle an ihn ergangenen Aufträge habe
erfüllen können, Hüsgen meldet, daß Flegels Bilder allerorten anzutreffen seien, bemerkt
jedoch dabei, daß der Künstler sich oft wiederholt habe. Angesichts dieser alten Zeugnisse
wirkt das bei Thieme-Becker69) gegebene Werksverzeichnis überraschend dürftig: zwei
signierte Bilder in Darmstadt (Kat. Nr. 870) und Speyer (Kat. Nr. 31), zwei nicht signierte
Bilder in Augsburg, jetzt in Aschaffenburg (Kat. Nr. 3) und München (Kat. Nr. 22) —,
sowie einige Zuschreibungen. Offensichtlich waren die Zeitumstände des Jahres 1917 einer
Würdigung Flegels nicht günstig — die Darmstädter Ausstellung von 1914 hatte zum
ersten Mal Werke Flegels öffentlich ausgestellt, und schon legte sich die Last der Kriegs-
jahre erschwerend auf die Forschung, so daß diese erste Einführung Georg Flegels in
die deutsche Künstlergeschichte nur einen vorläufigen Charakter haben konnte; auch
hatten Zeitgeschmack und Forschung sich noch nicht mit den eigentümlichen Reizen der
Bildgattung des Stillebens vertraut gcmacht, so daß sich kein Bedürfnis nach einer deut-
licheren Erfassung dieser Künstlerindividualität regte.
Während der 1920er Jahre belebte sich das Interesse von Forschung und Handel an
der Stillebenmalerei, wobei Konstruktivismus und Sachlichkeit als Kunstprogramme und
Zeitstile keine geringe Rolle spielten. Im gleichen Maße, wie signierte und sogar datierte
Werke Flegels auftauchten, wurde sein Name zu einer Art Gattungsbegriff für Früh-
formen des Stillebens und manches Stilleben wurde dem neu entdeckten und kaum faß-
baren Meister zugeschrieben. Es gehörte deshalb zur Aufgabe der vorliegenden Arbeit,
zahlreiche mit dem Namen Flegel verbundene Bilder zu beurteilen und aus der verwir-
renden Fülle fluktuierenden Kunstgutes auszusondern, herauszusteilen, was mit großer
Wahrscheinlichkeit als eigenhändiges Werk Flegels gelten darf; zur Charakterisierung
künstlerischer Eigenart bedarf es nicht in jedem Falle eines umfangreichen Werkkata-
loges, — die Zusammenstellung weniger gesicherter Werke erscheint uns als eine ver-
nünftige Ausgangsstellung für die Erforschung eines bestimmten Phänomens innerhalb
des ereignisreichen deutschen Kunstlebens, das gegen 1600 im Zeichen eines selbständig
heranwachsenden Barock steht. Es darf dabei nicht übersehen werden, daß die kleine
Zahl gesicherter Werke Flegels nur als den zufällig bewahrten Rest einer umfangreichen
Produktion darstellt; das Stilleben als private Gebrauchskunst ist zu allen Zeiten be-
sonders stark den Schwankungen der Geschmacksurteile ausgesetzt, es besitzt keinen über-
persönlichen oder sakralen Bildgehalt, der seine Bewahrung sichern könnte. Auch das viel-
fach gebräuchliche kleine Format der Stilleben bedeutet Gefährdung für diese Bild-
gattung, ein exemplarisch bewegliches Kunstgut, das durch Tausch, Kauf, Erbausein-
andersetzungen und Pfändungen häufig den Besitzer wechseln kann, bis es als „ver-
braucht“ sang- und klanglos zugrundegeht. In der Werteskala der Ästhetik und Kunst-
lehre des 17. und 18. Jahrhunderts steht das Stilleben an unterster Stelle: die hoch-
78
69) s. Quellenanhang S. 148.
70) Die Bezeichnung (Kat. Nr.) bezieht sich auf unsere Verzeichnisse S. 151 ff.
Die Werke des Georg Flegel.
Einleitende Bemerkungen zur Methode:
Die Aussagen der beiden wesentlichen Quellen für das Leben und Werk des Georg
Flegel stimmen darin überein, daß der Kiinstler zahlreiche Werke geschaffen habe: Sand-
rart nennt ihn einen fleißigen Maler, der nicht alle an ihn ergangenen Aufträge habe
erfüllen können, Hüsgen meldet, daß Flegels Bilder allerorten anzutreffen seien, bemerkt
jedoch dabei, daß der Künstler sich oft wiederholt habe. Angesichts dieser alten Zeugnisse
wirkt das bei Thieme-Becker69) gegebene Werksverzeichnis überraschend dürftig: zwei
signierte Bilder in Darmstadt (Kat. Nr. 870) und Speyer (Kat. Nr. 31), zwei nicht signierte
Bilder in Augsburg, jetzt in Aschaffenburg (Kat. Nr. 3) und München (Kat. Nr. 22) —,
sowie einige Zuschreibungen. Offensichtlich waren die Zeitumstände des Jahres 1917 einer
Würdigung Flegels nicht günstig — die Darmstädter Ausstellung von 1914 hatte zum
ersten Mal Werke Flegels öffentlich ausgestellt, und schon legte sich die Last der Kriegs-
jahre erschwerend auf die Forschung, so daß diese erste Einführung Georg Flegels in
die deutsche Künstlergeschichte nur einen vorläufigen Charakter haben konnte; auch
hatten Zeitgeschmack und Forschung sich noch nicht mit den eigentümlichen Reizen der
Bildgattung des Stillebens vertraut gcmacht, so daß sich kein Bedürfnis nach einer deut-
licheren Erfassung dieser Künstlerindividualität regte.
Während der 1920er Jahre belebte sich das Interesse von Forschung und Handel an
der Stillebenmalerei, wobei Konstruktivismus und Sachlichkeit als Kunstprogramme und
Zeitstile keine geringe Rolle spielten. Im gleichen Maße, wie signierte und sogar datierte
Werke Flegels auftauchten, wurde sein Name zu einer Art Gattungsbegriff für Früh-
formen des Stillebens und manches Stilleben wurde dem neu entdeckten und kaum faß-
baren Meister zugeschrieben. Es gehörte deshalb zur Aufgabe der vorliegenden Arbeit,
zahlreiche mit dem Namen Flegel verbundene Bilder zu beurteilen und aus der verwir-
renden Fülle fluktuierenden Kunstgutes auszusondern, herauszusteilen, was mit großer
Wahrscheinlichkeit als eigenhändiges Werk Flegels gelten darf; zur Charakterisierung
künstlerischer Eigenart bedarf es nicht in jedem Falle eines umfangreichen Werkkata-
loges, — die Zusammenstellung weniger gesicherter Werke erscheint uns als eine ver-
nünftige Ausgangsstellung für die Erforschung eines bestimmten Phänomens innerhalb
des ereignisreichen deutschen Kunstlebens, das gegen 1600 im Zeichen eines selbständig
heranwachsenden Barock steht. Es darf dabei nicht übersehen werden, daß die kleine
Zahl gesicherter Werke Flegels nur als den zufällig bewahrten Rest einer umfangreichen
Produktion darstellt; das Stilleben als private Gebrauchskunst ist zu allen Zeiten be-
sonders stark den Schwankungen der Geschmacksurteile ausgesetzt, es besitzt keinen über-
persönlichen oder sakralen Bildgehalt, der seine Bewahrung sichern könnte. Auch das viel-
fach gebräuchliche kleine Format der Stilleben bedeutet Gefährdung für diese Bild-
gattung, ein exemplarisch bewegliches Kunstgut, das durch Tausch, Kauf, Erbausein-
andersetzungen und Pfändungen häufig den Besitzer wechseln kann, bis es als „ver-
braucht“ sang- und klanglos zugrundegeht. In der Werteskala der Ästhetik und Kunst-
lehre des 17. und 18. Jahrhunderts steht das Stilleben an unterster Stelle: die hoch-
78
69) s. Quellenanhang S. 148.
70) Die Bezeichnung (Kat. Nr.) bezieht sich auf unsere Verzeichnisse S. 151 ff.