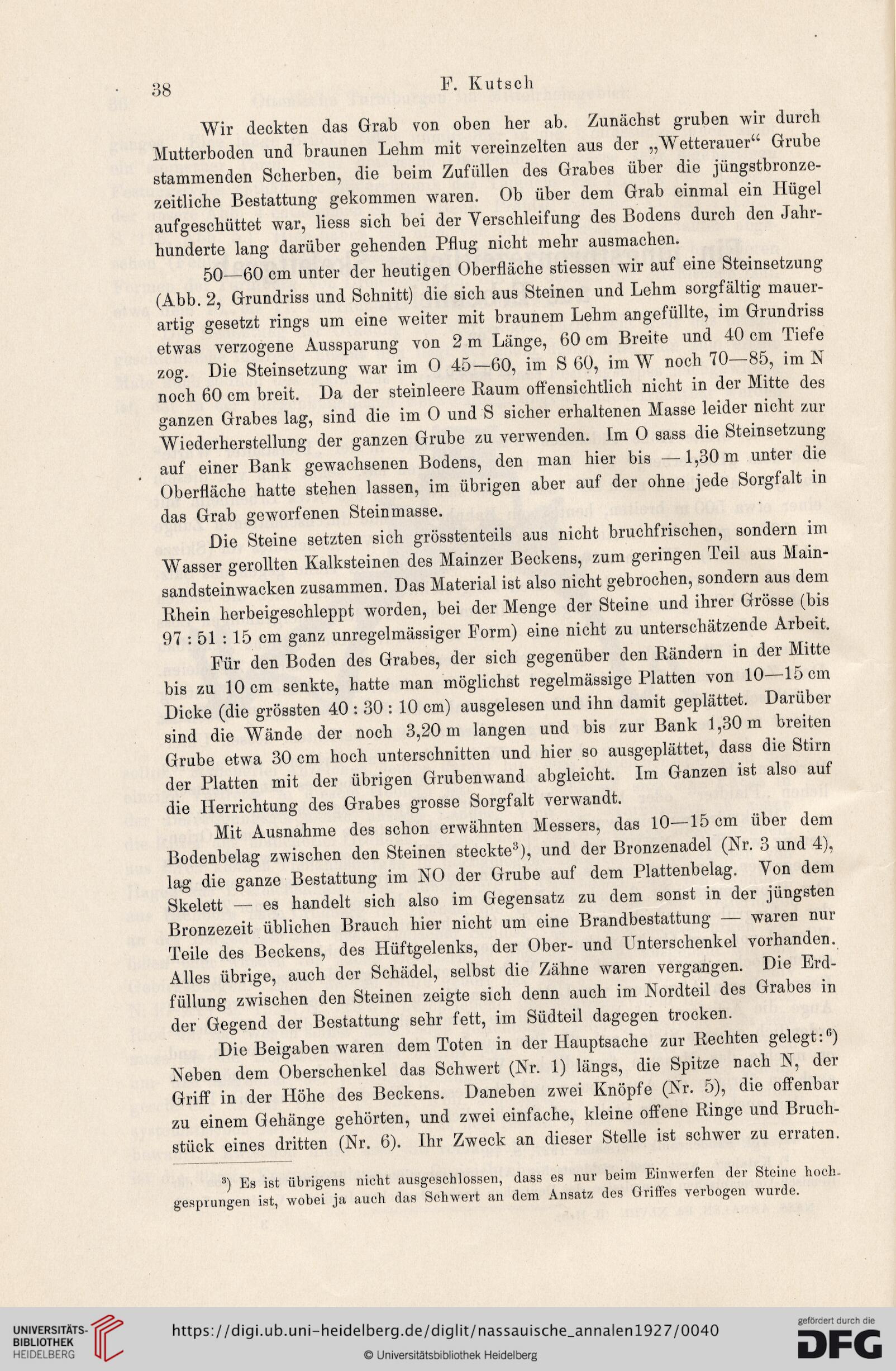38
F. Kutsch
Wir deckten das Grab von oben her ab. Zunächst gruben wir durch
Mutterboden und braunen Lehm mit vereinzelten aus der „Wetterauer“ Grube
stammenden Scherben, die beim Zufüllen des Grabes über die jüngstbronze-
zeitliche Bestattung gekommen waren. Ob über dem Grab einmal ein Hügel
aufgeschüttet war, liess sich bei der Verschleifung des Bodens durch den Jahr-
hunderte lang darüber gehenden Pflug nicht mehr ausmachen.
50—60 cm unter der heutigen Oberfläche stiessen wir auf eine Steinsetzung
(Abb. 2, Grundriss und Schnitt) die sich aus Steinen und Lehm sorgfältig mauer-
artig gesetzt rings um eine weiter mit braunem Lehm angefüllte, im Grundriss
etwas verzogene Aussparung von 2 m Länge, 60 cm Breite und 40 cm Tiefe
zog. Die Steinsetzung war im 0 45—60, im S 60, im W noch 70—85, im N
noch 60 cm breit. Da der steinleere Raum offensichtlich nicht in der Mitte des
ganzen Grabes lag, sind die im O und S sicher erhaltenen Masse leider nicht zur
Wiederherstellung der ganzen Grube zu verwenden. Im O sass die Steinsetzung
auf einer Bank gewachsenen Bodens, den man hier bis —1,30 m unter die
Oberfläche hatte stehen lassen, im übrigen aber auf der ohne jede Sorgfalt in
das Grab geworfenen Stein mässe.
Die Steine setzten sich grösstenteils aus nicht bruchfrischen, sondern im
Wasser gerollten Kalksteinen des Mainzer Beckens, zum geringen Teil aus Main-
sandsteinwacken zusammen. Das Material ist also nicht gebrochen, sondern aus dem
Rhein herbeigeschleppt worden, bei der Menge der Steine und ihrer Grösse (bis
97 : 51 : 15 cm ganz unregelmässiger Form) eine nicht zu unterschätzende Arbeit.
Für den Boden des Grabes, der sich gegenüber den Rändern in der Mitte
bis zu 10 cm senkte, hatte man möglichst regelmässige Platten von 10—15 cm
Dicke (die grössten 40 : 30 : 10 cm) ausgelesen und ihn damit geplättet. Darüber
sind die Wände der noch 3,20 m langen und bis zur Bank 1,30 m breiten
Grube etwa 30 cm hoch unterschnitten und hier so ausgeplättet, dass die Stirn
der Platten mit der übrigen Grubenwand abgleicht. Im Ganzen ist also auf
die Herrichtung des Grabes grosse Sorgfalt verwandt.
Mit Ausnahme des schon erwähnten Messers, das 10—15 cm über dem
Bodenbelag zwischen den Steinen steckte3), und der Bronzenadel (Nr. 3 und 4),
lag die ganze Bestattung im NO der Grube auf dem Plattenbelag. Von dem
Skelett — es handelt sich also im Gegensatz zu dem sonst in der jüngsten
Bronzezeit üblichen Brauch hier nicht um eine Brandbestattung — waren nur
Teile des Beckens, des Hüftgelenks, der Ober- und Unterschenkel vorhanden.
Alles übrige, auch der Schädel, selbst die Zähne waren vergangen. Die Erd-
füllung zwischen den Steinen zeigte sich denn auch im Nordteil des Grabes in
der Gegend der Bestattung sehr fett, im Südteil dagegen trocken.
Die Beigaben waren dem Toten in der Hauptsache zur Rechten gelegt:6)
Neben dem Oberschenkel das Schwert (Nr. 1) längs, die Spitze nach N, der
Griff in der Höhe des Beckens. Daneben zwei Knöpfe (Nr. 5), die offenbar
zu einem Gehänge gehörten, und zwei einfache, kleine offene Ringe und Bruch-
stück eines dritten (Nr. 6). Ihr Zweck an dieser Stelle ist schwer zu erraten.
s) Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass es nur beim Einwerfen der Steine hoch-
gesprungen ist, wobei ja auch das Schwert an dem Ansatz des Griffes verbogen wurde.
F. Kutsch
Wir deckten das Grab von oben her ab. Zunächst gruben wir durch
Mutterboden und braunen Lehm mit vereinzelten aus der „Wetterauer“ Grube
stammenden Scherben, die beim Zufüllen des Grabes über die jüngstbronze-
zeitliche Bestattung gekommen waren. Ob über dem Grab einmal ein Hügel
aufgeschüttet war, liess sich bei der Verschleifung des Bodens durch den Jahr-
hunderte lang darüber gehenden Pflug nicht mehr ausmachen.
50—60 cm unter der heutigen Oberfläche stiessen wir auf eine Steinsetzung
(Abb. 2, Grundriss und Schnitt) die sich aus Steinen und Lehm sorgfältig mauer-
artig gesetzt rings um eine weiter mit braunem Lehm angefüllte, im Grundriss
etwas verzogene Aussparung von 2 m Länge, 60 cm Breite und 40 cm Tiefe
zog. Die Steinsetzung war im 0 45—60, im S 60, im W noch 70—85, im N
noch 60 cm breit. Da der steinleere Raum offensichtlich nicht in der Mitte des
ganzen Grabes lag, sind die im O und S sicher erhaltenen Masse leider nicht zur
Wiederherstellung der ganzen Grube zu verwenden. Im O sass die Steinsetzung
auf einer Bank gewachsenen Bodens, den man hier bis —1,30 m unter die
Oberfläche hatte stehen lassen, im übrigen aber auf der ohne jede Sorgfalt in
das Grab geworfenen Stein mässe.
Die Steine setzten sich grösstenteils aus nicht bruchfrischen, sondern im
Wasser gerollten Kalksteinen des Mainzer Beckens, zum geringen Teil aus Main-
sandsteinwacken zusammen. Das Material ist also nicht gebrochen, sondern aus dem
Rhein herbeigeschleppt worden, bei der Menge der Steine und ihrer Grösse (bis
97 : 51 : 15 cm ganz unregelmässiger Form) eine nicht zu unterschätzende Arbeit.
Für den Boden des Grabes, der sich gegenüber den Rändern in der Mitte
bis zu 10 cm senkte, hatte man möglichst regelmässige Platten von 10—15 cm
Dicke (die grössten 40 : 30 : 10 cm) ausgelesen und ihn damit geplättet. Darüber
sind die Wände der noch 3,20 m langen und bis zur Bank 1,30 m breiten
Grube etwa 30 cm hoch unterschnitten und hier so ausgeplättet, dass die Stirn
der Platten mit der übrigen Grubenwand abgleicht. Im Ganzen ist also auf
die Herrichtung des Grabes grosse Sorgfalt verwandt.
Mit Ausnahme des schon erwähnten Messers, das 10—15 cm über dem
Bodenbelag zwischen den Steinen steckte3), und der Bronzenadel (Nr. 3 und 4),
lag die ganze Bestattung im NO der Grube auf dem Plattenbelag. Von dem
Skelett — es handelt sich also im Gegensatz zu dem sonst in der jüngsten
Bronzezeit üblichen Brauch hier nicht um eine Brandbestattung — waren nur
Teile des Beckens, des Hüftgelenks, der Ober- und Unterschenkel vorhanden.
Alles übrige, auch der Schädel, selbst die Zähne waren vergangen. Die Erd-
füllung zwischen den Steinen zeigte sich denn auch im Nordteil des Grabes in
der Gegend der Bestattung sehr fett, im Südteil dagegen trocken.
Die Beigaben waren dem Toten in der Hauptsache zur Rechten gelegt:6)
Neben dem Oberschenkel das Schwert (Nr. 1) längs, die Spitze nach N, der
Griff in der Höhe des Beckens. Daneben zwei Knöpfe (Nr. 5), die offenbar
zu einem Gehänge gehörten, und zwei einfache, kleine offene Ringe und Bruch-
stück eines dritten (Nr. 6). Ihr Zweck an dieser Stelle ist schwer zu erraten.
s) Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass es nur beim Einwerfen der Steine hoch-
gesprungen ist, wobei ja auch das Schwert an dem Ansatz des Griffes verbogen wurde.