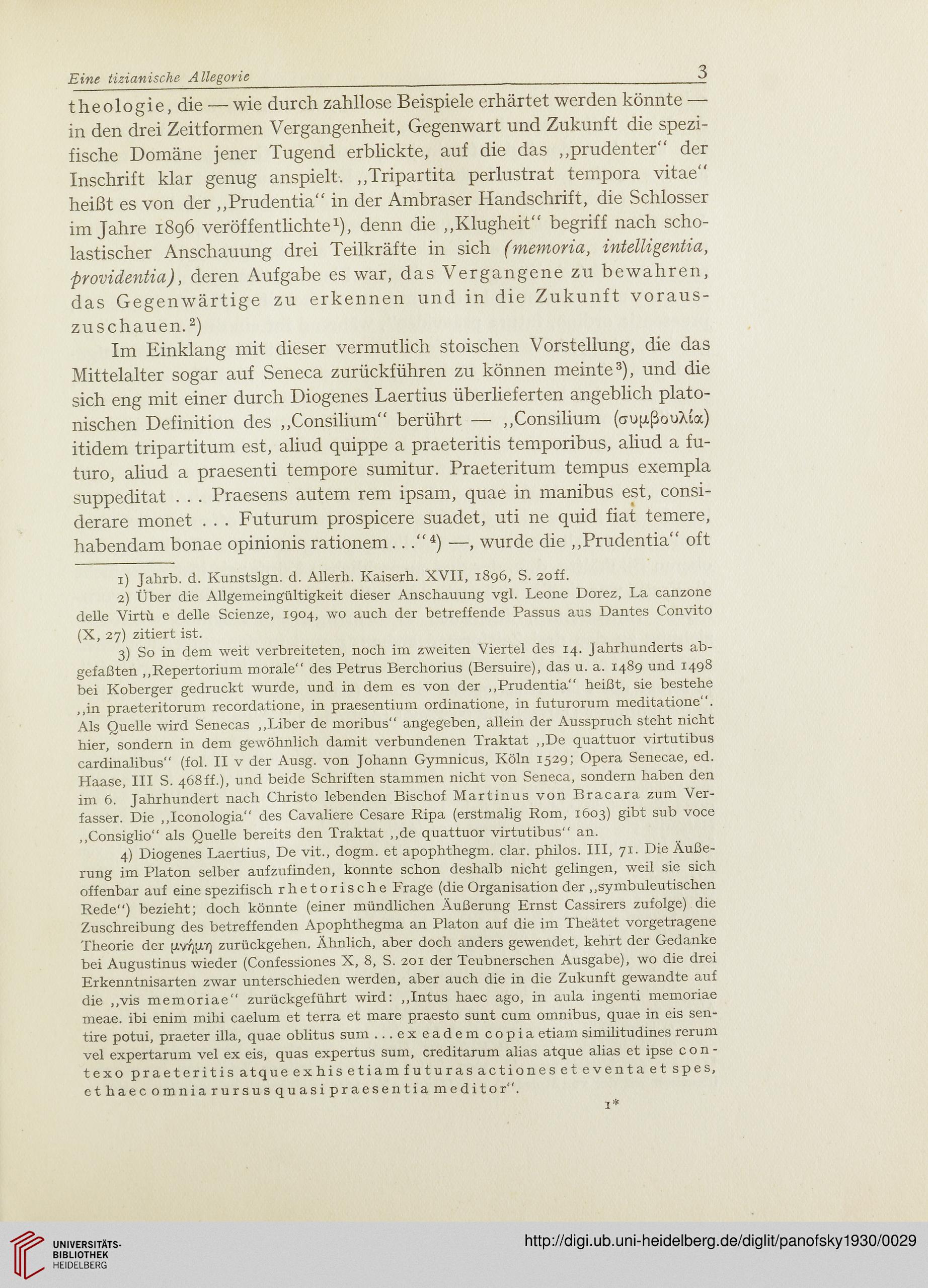3
Eine tizianische Allegorie
theologie, die — wie durch zahllose Beispiele erhärtet werden könnte —
in den drei Zeitformen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die spezi-
fische Domäne jener Tugend erblickte, auf die das „prudenter“ der
Inschrift klar genug anspielt. ,,Tripartita perlustrat tempora vitae“
heißt es von der „Prudentia“ in der Ambraser Handschrift, die Schlosser
im Jahre 1896 veröffentlichte1), denn die „Klugheit“ begriff nach scho-
lastischer Anschauung drei Teilkräfte in sich (memoria, intelligentia,
Providentia), deren Aufgabe es war, das Vergangene zu bewahren,
das Gegenwärtige zu erkennen und in die Zukunft voraus-
zuschauen. 2)
Im Einklang mit dieser vermutlich stoischen Vorstellung, die das
Mittelalter sogar auf Seneca zurückführen zu können meinte3), und die
sich eng mit einer durch Diogenes Laertius überlieferten angeblich plato-
nischen Definition des „Consilium“ berührt — „Consilium (crugßouXia)
itidem tripartitum est, aliud quippe a praeteritis temporibus, aliud a fu-
turo, aliud a praesenti tempore sumitur. Praeteritum tempus exempla
suppeditat . . . Praesens autem rem ipsam, quae in manibus est, consi-
derare monet . . . Futurum prospicere suadet, uti ne quid fiat temere,
habendam bonae opinionis rationem.. .“4) —, wurde die „Prudentia“ oft
1) Jahrb. d. Kunstslgn. d. Allerh. Kaiserh. XVII, 1896, S. 2off.
2) Über die Allgemeingültigkeit dieser Anschauung vgl. Leone Dorez, La canzone
delle Virtü e delle Scienze, 1904, wo auch der betreffende Passus aus Dantes Convito
(X, 27) zitiert ist.
3) So in dem weit verbreiteten, noch im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts ab-
gefaßten „Repertorium morale“ des Petrus Berchorius (Bersuire), das u. a. 1489 und 1498
bei Koberger gedruckt wurde, und in dem es von der „Prudentia“ heißt, sie bestehe
„in praeteritorum recordatione, in praesentium ordinatione, in futurorum meditatione“.
Als Quelle wird Senecas „Liber de moribus“ angegeben, allein der Ausspruch steht nicht
hier, sondern in dem gewöhnlich damit verbundenen Traktat „De quattuor virtutibus
cardinalibus“ (fol. II v der Ausg. von Johann Gymnicus, Köln 1529; Opera Senecae, ed.
Haase, III S. 468ff.), und beide Schriften stammen nicht von Seneca, sondern haben den
im 6. Jahrhundert nach Christo lebenden Bischof Martinus von Bracara zum Ver-
fasser. Die „Iconologia“ des Cavaliere Cesare Ripa (erstmalig Rom, 1603) gibt sub voce
„Consiglio“ als Quelle bereits den Traktat „de quattuor virtutibus“ an.
4) Diogenes Laertius, De vit., dogm. et apophthegm. dar. philos. III, 71. Die Äuße-
rung im Platon selber aufzufinden, konnte schon deshalb nicht gelingen, weil sie sich
offenbar auf eine spezifisch rhetorische Frage (die Organisation der „symbuleutischen
Rede“) bezieht; doch könnte (einer mündlichen Äußerung Ernst Cassirers zufolge) die
Zuschreibung des betreffenden Apophthegma an Platon auf die im Theätet vorgetragene
Theorie der pviQP'r) zurückgehen. Ähnlich, aber doch anders gewendet, kehrt der Gedanke
bei Augustinus wieder (Confessiones X, 8, S. 201 der Teubnerschen Ausgabe), wo die drei
Erkenntnisarten zwar unterschieden werden, aber auch die in die Zukunft gewandte auf
die „vis memoriae“ zurückgeführt wird: „Intus haec ago, in aula ingenti memoriae
meae. ibi enim mihi caelum et terra et mare praesto sunt cum omnibus, quae in eis sen-
tire potui, praeter illa, quae oblitus sum ...exeademcopia etiam similitudines rerum
vel expertarum vel ex eis, quas expertus sum, creditarum alias atque alias et ipse con-
texo praeteritis atque ex his etiam futurasactiones et eventa et spes,
et haec omnia rursus quasi praesentia meditor".
1*
Eine tizianische Allegorie
theologie, die — wie durch zahllose Beispiele erhärtet werden könnte —
in den drei Zeitformen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die spezi-
fische Domäne jener Tugend erblickte, auf die das „prudenter“ der
Inschrift klar genug anspielt. ,,Tripartita perlustrat tempora vitae“
heißt es von der „Prudentia“ in der Ambraser Handschrift, die Schlosser
im Jahre 1896 veröffentlichte1), denn die „Klugheit“ begriff nach scho-
lastischer Anschauung drei Teilkräfte in sich (memoria, intelligentia,
Providentia), deren Aufgabe es war, das Vergangene zu bewahren,
das Gegenwärtige zu erkennen und in die Zukunft voraus-
zuschauen. 2)
Im Einklang mit dieser vermutlich stoischen Vorstellung, die das
Mittelalter sogar auf Seneca zurückführen zu können meinte3), und die
sich eng mit einer durch Diogenes Laertius überlieferten angeblich plato-
nischen Definition des „Consilium“ berührt — „Consilium (crugßouXia)
itidem tripartitum est, aliud quippe a praeteritis temporibus, aliud a fu-
turo, aliud a praesenti tempore sumitur. Praeteritum tempus exempla
suppeditat . . . Praesens autem rem ipsam, quae in manibus est, consi-
derare monet . . . Futurum prospicere suadet, uti ne quid fiat temere,
habendam bonae opinionis rationem.. .“4) —, wurde die „Prudentia“ oft
1) Jahrb. d. Kunstslgn. d. Allerh. Kaiserh. XVII, 1896, S. 2off.
2) Über die Allgemeingültigkeit dieser Anschauung vgl. Leone Dorez, La canzone
delle Virtü e delle Scienze, 1904, wo auch der betreffende Passus aus Dantes Convito
(X, 27) zitiert ist.
3) So in dem weit verbreiteten, noch im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts ab-
gefaßten „Repertorium morale“ des Petrus Berchorius (Bersuire), das u. a. 1489 und 1498
bei Koberger gedruckt wurde, und in dem es von der „Prudentia“ heißt, sie bestehe
„in praeteritorum recordatione, in praesentium ordinatione, in futurorum meditatione“.
Als Quelle wird Senecas „Liber de moribus“ angegeben, allein der Ausspruch steht nicht
hier, sondern in dem gewöhnlich damit verbundenen Traktat „De quattuor virtutibus
cardinalibus“ (fol. II v der Ausg. von Johann Gymnicus, Köln 1529; Opera Senecae, ed.
Haase, III S. 468ff.), und beide Schriften stammen nicht von Seneca, sondern haben den
im 6. Jahrhundert nach Christo lebenden Bischof Martinus von Bracara zum Ver-
fasser. Die „Iconologia“ des Cavaliere Cesare Ripa (erstmalig Rom, 1603) gibt sub voce
„Consiglio“ als Quelle bereits den Traktat „de quattuor virtutibus“ an.
4) Diogenes Laertius, De vit., dogm. et apophthegm. dar. philos. III, 71. Die Äuße-
rung im Platon selber aufzufinden, konnte schon deshalb nicht gelingen, weil sie sich
offenbar auf eine spezifisch rhetorische Frage (die Organisation der „symbuleutischen
Rede“) bezieht; doch könnte (einer mündlichen Äußerung Ernst Cassirers zufolge) die
Zuschreibung des betreffenden Apophthegma an Platon auf die im Theätet vorgetragene
Theorie der pviQP'r) zurückgehen. Ähnlich, aber doch anders gewendet, kehrt der Gedanke
bei Augustinus wieder (Confessiones X, 8, S. 201 der Teubnerschen Ausgabe), wo die drei
Erkenntnisarten zwar unterschieden werden, aber auch die in die Zukunft gewandte auf
die „vis memoriae“ zurückgeführt wird: „Intus haec ago, in aula ingenti memoriae
meae. ibi enim mihi caelum et terra et mare praesto sunt cum omnibus, quae in eis sen-
tire potui, praeter illa, quae oblitus sum ...exeademcopia etiam similitudines rerum
vel expertarum vel ex eis, quas expertus sum, creditarum alias atque alias et ipse con-
texo praeteritis atque ex his etiam futurasactiones et eventa et spes,
et haec omnia rursus quasi praesentia meditor".
1*