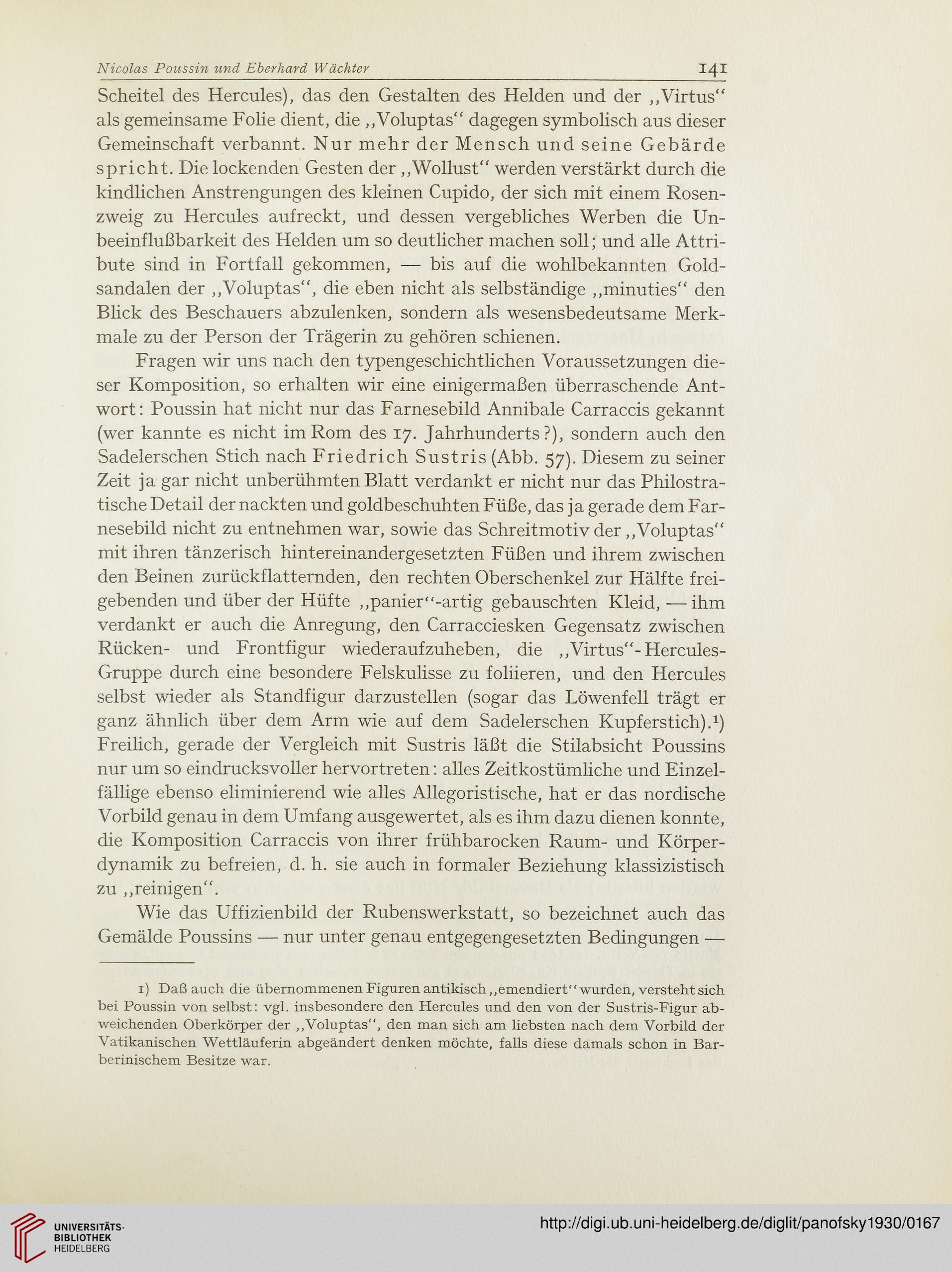Nicolas Poussin und Eberhard Wächter
141
Scheitel des Hercules), das den Gestalten des Helden und der „Virtus“
als gemeinsame Folie dient, die „Voluptas“ dagegen symbolisch aus dieser
Gemeinschaft verbannt. Nur mehr der Mensch und seine Gebärde
spricht. Die lockenden Gesten der „Wollust“ werden verstärkt durch die
kindlichen Anstrengungen des kleinen Cupido, der sich mit einem Rosen-
zweig zu Hercules aufreckt, und dessen vergebliches Werben die Un-
beeinflußbarkeit des Helden um so deutlicher machen soll; und alle Attri-
bute sind in Fortfall gekommen, — bis auf die wohlbekannten Gold-
sandalen der „Voluptas“, die eben nicht als selbständige „minuties“ den
Blick des Beschauers abzulenken, sondern als wesensbedeutsame Merk-
male zu der Person der Trägerin zu gehören schienen.
Fragen wir uns nach den typengeschichtlichen Voraussetzungen die-
ser Komposition, so erhalten wir eine einigermaßen überraschende Ant-
wort: Poussin hat nicht nur das Farnesebild Annibale Carraccis gekannt
(wer kannte es nicht im Rom des 17. Jahrhunderts?), sondern auch den
Sadelerschen Stich nach Friedrich Sustris (Abb. 57). Diesem zu seiner
Zeit ja gar nicht unberühmten Blatt verdankt er nicht nur das Philostra-
tische Detail der nackten und goldbeschuhten Füße, das ja gerade dem Far-
nesebild nicht zu entnehmen war, sowie das Schreitmotiv der „Voluptas“
mit ihren tänzerisch hintereinandergesetzten Füßen und ihrem zwischen
den Beinen zurückflatternden, den rechten Oberschenkel zur Hälfte frei-
gebenden und über der Hüfte „panier“-artig gebauschten Kleid, — ihm
verdankt er auch die Anregung, den Carracciesken Gegensatz zwischen
Rücken- und Frontfigur wiederaufzuheben, die „Virtus“-Hercules-
Gruppe durch eine besondere Felskulisse zu foliieren, und den Hercules
selbst wieder als Standfigur darzustellen (sogar das Löwenfell trägt er
ganz ähnlich über dem Arm wie auf dem Sadelerschen Kupferstich).1)
Freilich, gerade der Vergleich mit Sustris läßt die Stilabsicht Poussins
nur um so eindrucksvoller hervortreten: alles Zeitkostümliche und Einzel-
fällige ebenso eliminierend wie alles Allegoristische, hat er das nordische
Vorbild genau in dem Umfang ausgewertet, als es ihm dazu dienen konnte,
die Komposition Carraccis von ihrer frühbarocken Raum- und Körper-
dynamik zu befreien, d. h. sie auch in formaler Beziehung klassizistisch
zu „reinigen“.
Wie das Uffizienbild der Rubenswerkstatt, so bezeichnet auch das
Gemälde Poussins — nur unter genau entgegengesetzten Bedingungen —
1) Daß auch die übernommenen Figuren antikisch „emendiert" wurden, versteht sich
bei Poussin von selbst: vgl. insbesondere den Hercules und den von der Sustris-Figur ab-
weichenden Oberkörper der „Voluptas", den man sich am liebsten nach dem Vorbild der
Vatikanischen Wettläuferin abgeändert denken möchte, falls diese damals schon in Bar-
berinischem Besitze war.
141
Scheitel des Hercules), das den Gestalten des Helden und der „Virtus“
als gemeinsame Folie dient, die „Voluptas“ dagegen symbolisch aus dieser
Gemeinschaft verbannt. Nur mehr der Mensch und seine Gebärde
spricht. Die lockenden Gesten der „Wollust“ werden verstärkt durch die
kindlichen Anstrengungen des kleinen Cupido, der sich mit einem Rosen-
zweig zu Hercules aufreckt, und dessen vergebliches Werben die Un-
beeinflußbarkeit des Helden um so deutlicher machen soll; und alle Attri-
bute sind in Fortfall gekommen, — bis auf die wohlbekannten Gold-
sandalen der „Voluptas“, die eben nicht als selbständige „minuties“ den
Blick des Beschauers abzulenken, sondern als wesensbedeutsame Merk-
male zu der Person der Trägerin zu gehören schienen.
Fragen wir uns nach den typengeschichtlichen Voraussetzungen die-
ser Komposition, so erhalten wir eine einigermaßen überraschende Ant-
wort: Poussin hat nicht nur das Farnesebild Annibale Carraccis gekannt
(wer kannte es nicht im Rom des 17. Jahrhunderts?), sondern auch den
Sadelerschen Stich nach Friedrich Sustris (Abb. 57). Diesem zu seiner
Zeit ja gar nicht unberühmten Blatt verdankt er nicht nur das Philostra-
tische Detail der nackten und goldbeschuhten Füße, das ja gerade dem Far-
nesebild nicht zu entnehmen war, sowie das Schreitmotiv der „Voluptas“
mit ihren tänzerisch hintereinandergesetzten Füßen und ihrem zwischen
den Beinen zurückflatternden, den rechten Oberschenkel zur Hälfte frei-
gebenden und über der Hüfte „panier“-artig gebauschten Kleid, — ihm
verdankt er auch die Anregung, den Carracciesken Gegensatz zwischen
Rücken- und Frontfigur wiederaufzuheben, die „Virtus“-Hercules-
Gruppe durch eine besondere Felskulisse zu foliieren, und den Hercules
selbst wieder als Standfigur darzustellen (sogar das Löwenfell trägt er
ganz ähnlich über dem Arm wie auf dem Sadelerschen Kupferstich).1)
Freilich, gerade der Vergleich mit Sustris läßt die Stilabsicht Poussins
nur um so eindrucksvoller hervortreten: alles Zeitkostümliche und Einzel-
fällige ebenso eliminierend wie alles Allegoristische, hat er das nordische
Vorbild genau in dem Umfang ausgewertet, als es ihm dazu dienen konnte,
die Komposition Carraccis von ihrer frühbarocken Raum- und Körper-
dynamik zu befreien, d. h. sie auch in formaler Beziehung klassizistisch
zu „reinigen“.
Wie das Uffizienbild der Rubenswerkstatt, so bezeichnet auch das
Gemälde Poussins — nur unter genau entgegengesetzten Bedingungen —
1) Daß auch die übernommenen Figuren antikisch „emendiert" wurden, versteht sich
bei Poussin von selbst: vgl. insbesondere den Hercules und den von der Sustris-Figur ab-
weichenden Oberkörper der „Voluptas", den man sich am liebsten nach dem Vorbild der
Vatikanischen Wettläuferin abgeändert denken möchte, falls diese damals schon in Bar-
berinischem Besitze war.