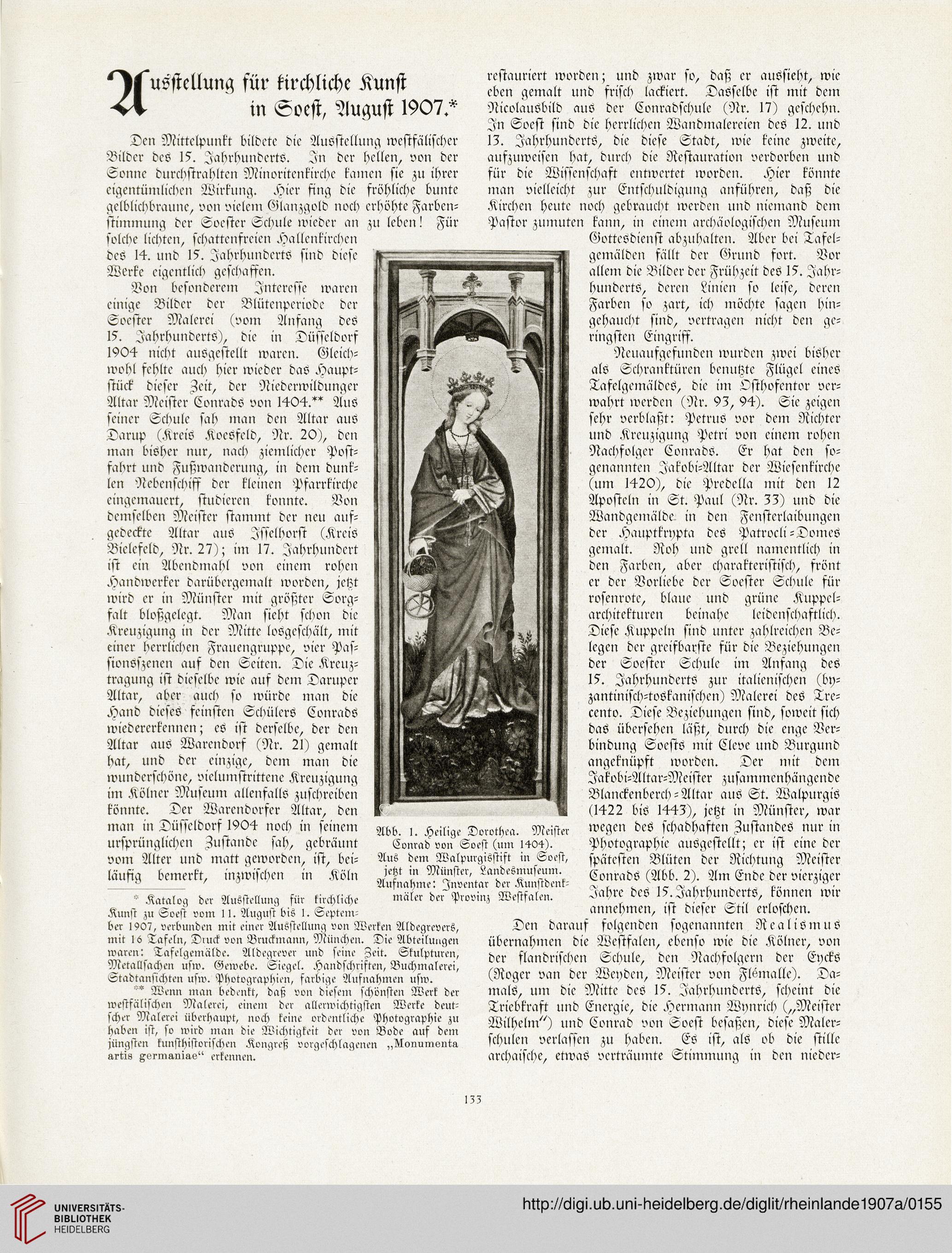usstellunq für kirchliche Kunst
in Soest, August I9O7?
Den Mittelpunkt bildete die Ausstellung westfälischer
Bilder deö 15. Jahrhunderts. In der Hellen, von der
Sonne durchstrahlten Minoritenkirche kamen sie zu ihrer
eigentümlichen Wirkung. Hier fing die fröhliche bunte
gelblichbraunc, von vielem Glanzgold noch erhöhte Farben-
stimmung der Soester Schule »nieder an zu leben! Für
solche lichten, schattcnfreien Hallenkirchen
Les 14. und 15. Jahrhunderts sind diese
Werke eigentlich geschaffen.
Don besonderem Interesse waren
einige Bilder der Blütcnperiodc der
Soester Malerei (vom Anfang des
15. Jahrhunderts), die in Düsseldorf
1904 nicht ausgestellt waren. Gleich-
wohl fehlte auch hier wieder das Haupt-
stück dieser Zeit, der Niederwildunger
Altar Meister Conrads von 1404.** ÄuS
seiner Schule sah man den Altar aus
Darup (Kreis Koesfeld, Nr. 20), den
man bisher nur, nach ziemlicher Post-
fahrt und Fußwanderung, in dem dunk-
len Nebenschiff der kleinen Pfarrkirche
eingcmaucrt, studieren konnte. Von
demselben Meister stammt der neu aus-
gedeckte Altar aus Jsselhorst (Kreis
Bielefeld, Nr. 27); im 17. Jahrhundert
ist ein Abendmahl von einem rohen
Handwerker darübergemalt worden, jetzt
wird er in Münster mit größter Sorg-
falt bloßgelegt. Man sieht schon die
Kreuzigung in der Mitte losgeschält, mit
einer herrlichen Frauengruppe, vier Pas-
sionsszenen auf den Seiten. Die Kreuz-
tragung ist dieselbe wie aus dem Daruper
Altar, aber auch so würde man die
Hand dieses feinsten Schülers Conrads
wiedererkennen; es ist derselbe, der den
Altar aus Warendorf (Nr. 21) gemalt
hat, und der einzige, dem man die
wunderschöne, vielumstrittene Kreuzigung
im Kölner Museum allenfalls zuschreiben
könnte. Der Warendorfer Altar, den
man in Düsseldorf 1904 noch in seinem
ursprünglichen Zustande sah, gebräunt
vom Alter und matt geworden, ist, bei-
läufig bemerkt, inzwischen in Köln
* Katalog der Ausstellung für kirchliche
Kunst zu Soest vom I I. August bis I. Septem-
ber I?07, verbunden mit einer Ausstellung von Werken Aldegrevers,
mit IS Tafeln, Druck von Bruckmann, München. Die Abteilungen
waren: Tafelgemälde. Aldcgrevcr und seine Zeit. Skulpturen,
Mctallsachen usw. Gewebe. Siegel. Handschriften, Buchmalerei,
Stadtansichten usw. Photographien, farbige Aufnahmen usw.
-* Wenn man bedenkt, daß von diesem schönsten Werk der
westfälischen Malerei, einein der allerwichtigsten Werke deut-
scher Malerei überhaupt, noch keine ordentliche Photographie zu
haben ist, so wird man die Wichtigkeit der von Bode auf dem
jüngsten kunsthistorischen Kongreß vorgcschlagenen „Nonumsntn
artig Asrnianias" erkennen.
restauriert worden; und zwar so, daß er auösieht, wie
eben gemalt und frisch lackiert. Dasselbe ist mit dem
Nicolausbild auS der Conradschule (Nr. 17) gcschehn.
In Soest sind die herrlichen Wandmalereien des 12. und
15. Jahrhunderts, die diese Stadt, wie keine zweite,
aufznweiscn hat, durch die Restauration verdorben und
für die Wissenschaft entwertet worden. Hier könnte
man vielleicht zur Entschuldigung ansühren, daß die
Kirchen heute noch gebraucht werden und niemand dem
Pastor zumuten kann, in einem archäologischen Museum
Gottesdienst abzuhaltcn. Aber bei Tafel-
gemälden fällt der Grund fort. Vor
allem die Bilder der Frühzcit deö 15. Jahr-
hunderts, deren Linien so leise, deren
Farben so zart, ich möchte sagen hin-
gehaucht sind, vertragen nicht den ge-
ringsten Eingriff.
Ncuaufgcsunden wurden zwei bisher
als Schranktüren benutzte Flügel eines
Tafclgemäldcö, die im Osthoscntor ver-
wahrt werden (Nr. 95, 94). Sic zeigen
sehr verblaßt: Petrus vor dem Richter
und Kreuzigung Petri von einem rohen
Nachfolger Conrads. Er hat den so-
genannten Jakobi-Altar der Wiescnkirche
(um 1420), die Predella mit den 12
Aposteln in St. Paul (Nr. 55) und die
Wandgemälde, in den Fensterlaibungcn
der Hauptkrypta des Patroeli-Domes
gemalt. Roh und grell namentlich in
den Farben, aber charakteristisch, frönt
er der Vorliebe der Soester Schule sm-
rosenrote, blaue und grüne Kuppel-
architekturen beinahe leidenschaftlich.
Diese Kuppeln sind unter zahlreichen Be-
legen der greifbarste für die Beziehungen
der Soester Schule im Anfang des
15. Jahrhunderts zur italienischen (by-
zantinisch-toskanischen) Malerei des Tre-
cento. Diese Beziehungen sind, soweit sich
das übersehen läßt, durch die enge Ver-
bindung Soests mit Cleve und Burgund
angcknüpst worden. Der mit dein
Jakobi-Altar-Meister zusammenhängende
Blanckcnberch-Altar aus St. Walpurgis
(1422 bis 1445), jetzt in Münster, war
wegen des schadhaften Zustandes nur in
Photographie ausgestellt; er ist eine der
spätesten Blüten der Richtung Meister
Conrads (Abb. 2). Am Ende der vierziger
Jahre des 15. Jahrhunderts, können wir
annehmen, ist dieser Stil erloschen.
Den daraus folgenden sogenannten Realismus
übernahmen die Westfalen, ebenso wie die Kölner, von
der flandrischen Schule, den Nachfolgern der Eycks
(Roger van der Weyden, Meister von Flsmalle). Da-
mals, um die Mitte des 15. Jahrhunderts, scheint die
Triebkraft und Energie, die Hermann Wynrich („Meister
Wilhelm") und Conrad von Soest besaßen, diese Maler-
schulen verlassen zu haben. Es ist, als ob die stille
archaische, etwas verträumte Stimmung in den nieder-
Abb. I. Heilige Dorothea. Meister
Conrad von Soest (um 1404).
Aus dem Walpurgisstift in Soest,
jetzt in Münster, Landesmuseum.
Aufnahme: Inventar der Kunstdenk-
mäler der Provinz Westfalen.
IZZ
in Soest, August I9O7?
Den Mittelpunkt bildete die Ausstellung westfälischer
Bilder deö 15. Jahrhunderts. In der Hellen, von der
Sonne durchstrahlten Minoritenkirche kamen sie zu ihrer
eigentümlichen Wirkung. Hier fing die fröhliche bunte
gelblichbraunc, von vielem Glanzgold noch erhöhte Farben-
stimmung der Soester Schule »nieder an zu leben! Für
solche lichten, schattcnfreien Hallenkirchen
Les 14. und 15. Jahrhunderts sind diese
Werke eigentlich geschaffen.
Don besonderem Interesse waren
einige Bilder der Blütcnperiodc der
Soester Malerei (vom Anfang des
15. Jahrhunderts), die in Düsseldorf
1904 nicht ausgestellt waren. Gleich-
wohl fehlte auch hier wieder das Haupt-
stück dieser Zeit, der Niederwildunger
Altar Meister Conrads von 1404.** ÄuS
seiner Schule sah man den Altar aus
Darup (Kreis Koesfeld, Nr. 20), den
man bisher nur, nach ziemlicher Post-
fahrt und Fußwanderung, in dem dunk-
len Nebenschiff der kleinen Pfarrkirche
eingcmaucrt, studieren konnte. Von
demselben Meister stammt der neu aus-
gedeckte Altar aus Jsselhorst (Kreis
Bielefeld, Nr. 27); im 17. Jahrhundert
ist ein Abendmahl von einem rohen
Handwerker darübergemalt worden, jetzt
wird er in Münster mit größter Sorg-
falt bloßgelegt. Man sieht schon die
Kreuzigung in der Mitte losgeschält, mit
einer herrlichen Frauengruppe, vier Pas-
sionsszenen auf den Seiten. Die Kreuz-
tragung ist dieselbe wie aus dem Daruper
Altar, aber auch so würde man die
Hand dieses feinsten Schülers Conrads
wiedererkennen; es ist derselbe, der den
Altar aus Warendorf (Nr. 21) gemalt
hat, und der einzige, dem man die
wunderschöne, vielumstrittene Kreuzigung
im Kölner Museum allenfalls zuschreiben
könnte. Der Warendorfer Altar, den
man in Düsseldorf 1904 noch in seinem
ursprünglichen Zustande sah, gebräunt
vom Alter und matt geworden, ist, bei-
läufig bemerkt, inzwischen in Köln
* Katalog der Ausstellung für kirchliche
Kunst zu Soest vom I I. August bis I. Septem-
ber I?07, verbunden mit einer Ausstellung von Werken Aldegrevers,
mit IS Tafeln, Druck von Bruckmann, München. Die Abteilungen
waren: Tafelgemälde. Aldcgrevcr und seine Zeit. Skulpturen,
Mctallsachen usw. Gewebe. Siegel. Handschriften, Buchmalerei,
Stadtansichten usw. Photographien, farbige Aufnahmen usw.
-* Wenn man bedenkt, daß von diesem schönsten Werk der
westfälischen Malerei, einein der allerwichtigsten Werke deut-
scher Malerei überhaupt, noch keine ordentliche Photographie zu
haben ist, so wird man die Wichtigkeit der von Bode auf dem
jüngsten kunsthistorischen Kongreß vorgcschlagenen „Nonumsntn
artig Asrnianias" erkennen.
restauriert worden; und zwar so, daß er auösieht, wie
eben gemalt und frisch lackiert. Dasselbe ist mit dem
Nicolausbild auS der Conradschule (Nr. 17) gcschehn.
In Soest sind die herrlichen Wandmalereien des 12. und
15. Jahrhunderts, die diese Stadt, wie keine zweite,
aufznweiscn hat, durch die Restauration verdorben und
für die Wissenschaft entwertet worden. Hier könnte
man vielleicht zur Entschuldigung ansühren, daß die
Kirchen heute noch gebraucht werden und niemand dem
Pastor zumuten kann, in einem archäologischen Museum
Gottesdienst abzuhaltcn. Aber bei Tafel-
gemälden fällt der Grund fort. Vor
allem die Bilder der Frühzcit deö 15. Jahr-
hunderts, deren Linien so leise, deren
Farben so zart, ich möchte sagen hin-
gehaucht sind, vertragen nicht den ge-
ringsten Eingriff.
Ncuaufgcsunden wurden zwei bisher
als Schranktüren benutzte Flügel eines
Tafclgemäldcö, die im Osthoscntor ver-
wahrt werden (Nr. 95, 94). Sic zeigen
sehr verblaßt: Petrus vor dem Richter
und Kreuzigung Petri von einem rohen
Nachfolger Conrads. Er hat den so-
genannten Jakobi-Altar der Wiescnkirche
(um 1420), die Predella mit den 12
Aposteln in St. Paul (Nr. 55) und die
Wandgemälde, in den Fensterlaibungcn
der Hauptkrypta des Patroeli-Domes
gemalt. Roh und grell namentlich in
den Farben, aber charakteristisch, frönt
er der Vorliebe der Soester Schule sm-
rosenrote, blaue und grüne Kuppel-
architekturen beinahe leidenschaftlich.
Diese Kuppeln sind unter zahlreichen Be-
legen der greifbarste für die Beziehungen
der Soester Schule im Anfang des
15. Jahrhunderts zur italienischen (by-
zantinisch-toskanischen) Malerei des Tre-
cento. Diese Beziehungen sind, soweit sich
das übersehen läßt, durch die enge Ver-
bindung Soests mit Cleve und Burgund
angcknüpst worden. Der mit dein
Jakobi-Altar-Meister zusammenhängende
Blanckcnberch-Altar aus St. Walpurgis
(1422 bis 1445), jetzt in Münster, war
wegen des schadhaften Zustandes nur in
Photographie ausgestellt; er ist eine der
spätesten Blüten der Richtung Meister
Conrads (Abb. 2). Am Ende der vierziger
Jahre des 15. Jahrhunderts, können wir
annehmen, ist dieser Stil erloschen.
Den daraus folgenden sogenannten Realismus
übernahmen die Westfalen, ebenso wie die Kölner, von
der flandrischen Schule, den Nachfolgern der Eycks
(Roger van der Weyden, Meister von Flsmalle). Da-
mals, um die Mitte des 15. Jahrhunderts, scheint die
Triebkraft und Energie, die Hermann Wynrich („Meister
Wilhelm") und Conrad von Soest besaßen, diese Maler-
schulen verlassen zu haben. Es ist, als ob die stille
archaische, etwas verträumte Stimmung in den nieder-
Abb. I. Heilige Dorothea. Meister
Conrad von Soest (um 1404).
Aus dem Walpurgisstift in Soest,
jetzt in Münster, Landesmuseum.
Aufnahme: Inventar der Kunstdenk-
mäler der Provinz Westfalen.
IZZ