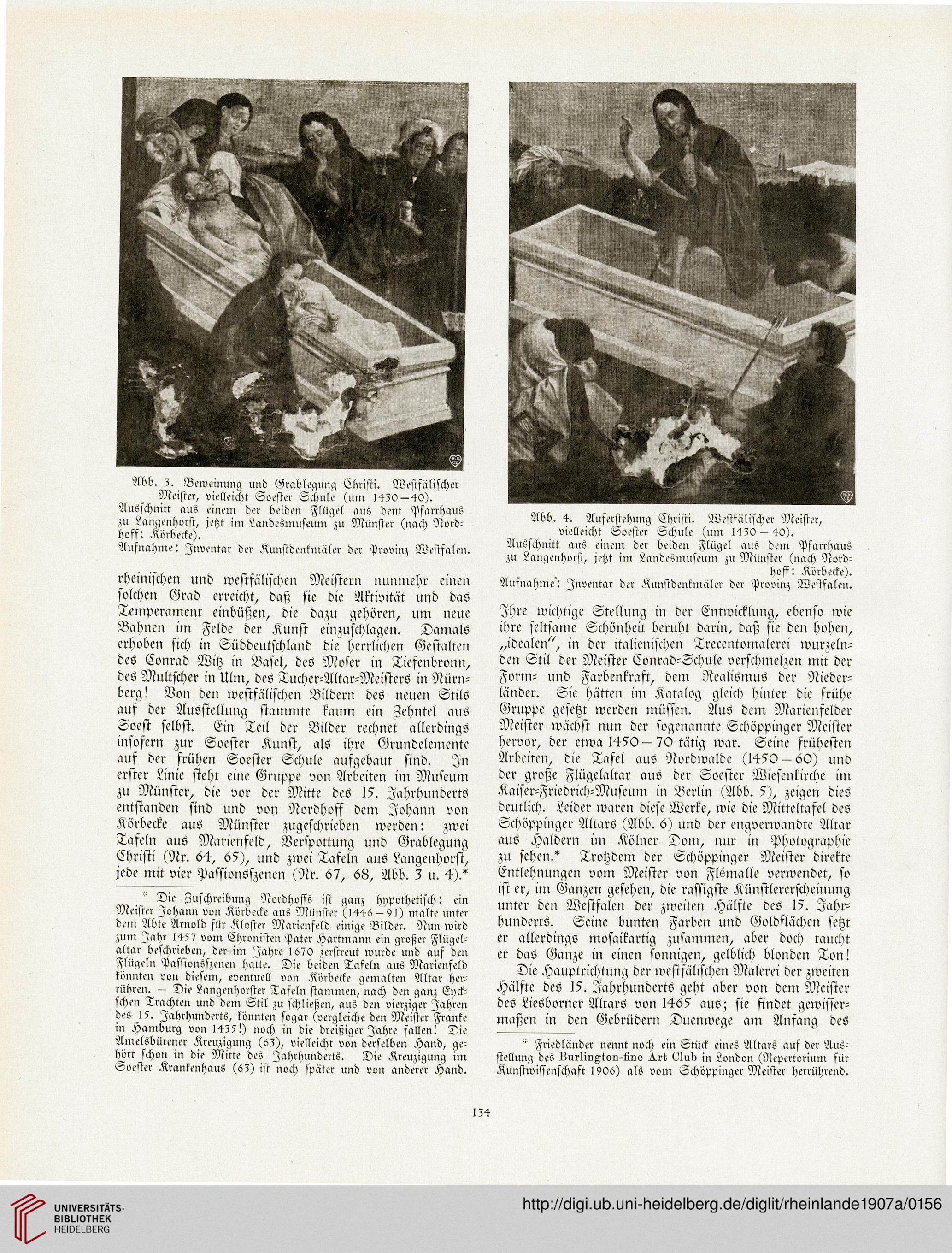Abb. 5. Beweinung und Grablegung Christi. Westfälischer
Meister, vielleicht Soester Schule (um 1450 — 40).
Ausschnitt aus einem der beiden Flügel aus dem Pfarrhaus
zu Langenhorst, jetzt im Landesmuseum zu Münster (nach Nord-
hoff: Korbecke).
Ausnahme: Inventar der Kunstdenkmäler der Provinz Westfalen.
rheinischen und westfälischen Meistern nunmehr einen
solchen Grad erreicht, daß sie die Aktivität und das
Temperament einbüßen, die dazu gehören, um neue
Bahnen im Felde der Kunst einzuschlagen. Damals
erhoben sich in Süddeutschland die herrlichen Gestalten
des Conrad Witz in Basel, des Moser in Tiefenbronn,
des Multscher in Ulm, des Tucher-Altar-Mcistcrs in Nürn-
berg! Von den westfälischen Bildern des neuen Stils
auf der Ausstellung stammte kaum ein Zehntel aus
Soest selbst. Ein Teil der Bilder rechnet allerdings
insofern zur Soester Kunst, als ihre Grundelementc
auf der frühen Soester Schule aufgebaut sind. In
erster Linie steht eine Gruppe von Arbeiten im Museum
zu Münster, die vor der Mitte des 15. Jahrhunderts
entstanden sind und von Nordhoff dem Johann von
Körbecke auö Münster zugeschrieben werden: zwei
Tafeln aus Marienfeld, Verspottung und Grablegung
Christi (Nr. 64, 65), und zwei Tafeln aus Langenhorst,
jede mit vier Passionsszenen (Nr. 67, 68, Abb. Z u. 4).*
" Die Zuschreibung Nordhoffs ist ganz hypothetisch: ein
Meister Johann von Körbecke aus Münster (1446 — 91) malte unter
dem Abte Arnold für Kloster Marienfeld einige Bilder. Nun wird
zum Jahr 1457 vom Chronisten Pater Hartmann ein großer Flügel-
altar beschrieben, der im Jahre 1670 zerstreut wurde und auf den
Flügeln Passionsszenen hatte. Die beiden Tafeln aus Marienfeld
könnten von diesem, eventuell von Körbecke gemalten Altar her-
rühren. — Die Langenhorster Tafeln stammen, nach den ganz Eyck-
schcn Trachten und dem Stil zu schließen, aus den vierziger Jahren
des 15. Jahrhunderts, könnten sogar (vergleiche den Meister Franke
in Hamburg von 1455!) noch in die dreißiger Jahre fallen! Die
Amelsbürener Kreuzigung (65), vielleicht von derselben Hand, ge-
hört schon in die Mitte des Jahrhunderts. Die Kreuzigung im
Soester Krankenhaus (65) ist noch später und von anderer Hand.
Abb. 4. Auferstehung Christi. Westfälischer Meister,
vielleicht Soester Schule (um 1450 — 40).
Ausschnitt aus einem der beiden Flügel aus dem Pfarrhaus
zu Langenhorst, jetzt im Landesmuseum zu Münster (nach Nord-
hoff: Körbecke).
Aufnahme': Inventar der Kunstdenkmäler der Provinz Westfalen.
Ihre wichtige Stellung in der Entwicklung, ebenso wie
ihre seltsame Schönheit beruht darin, daß sie den hohen,
„idealen", in der italienischen Treccntomalerei wurzeln-
den Stil der Meister Conrad-Schule verschmelzen mit der
Form- und Farbenkraft, dem Realismus der Nieder-
länder. Sie hätten im Katalog gleich hinter die frühe
Gruppe gesetzt werden müssen. Aus dem Marienselder
Meister wächst nun der sogenannte Schöppinger Meister
hervor, der etwa 1450 —7O tätig war. Seine frühesten
Arbeiten, die Tafel aus Nordwalde (1450-6O) und
der große Flügelaltar aus der Soester Wiesenkirche im
Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin (Abb. 5), zeigen dies
deutlich. Leider waren diese Werke, wie die Mitteltasel des
Schöppinger Altars (Abb. 6) und der cngverwandtc Altar
aus Haldern im Kölner Dom, nur in Photographie
zu sehen.* Trotzdem der Schöppinger Meister direkte
Entlehnungen vom Meister von Flsmalle verwendet, so
ist er, im Ganzen gesehen, die rassigste Künstlercrschcinung
unter den Westfalen der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts. Seine bunten Farben und Goldflächen setzt
er allerdings mosaikartig zusammen, aber doch taucht
er das Ganze in einen sonnigen, gelblich blonden Ton!
Die Hauptrichtung der westfälischen Malerei der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts geht aber von dem Meister
des Liesborner Altars von 1465 aus; sie findet gewisser-
maßen in den Gebrüdern Duenwege am Anfang des
'' Friedländer nennt noch ein Stück eines Altars auf der Aus-
stellung des Lui-linZston-tino Xrt Olub in London (Repertorium für
Kunstwissenschaft 1906) als vom Schöppinger Meister herrührend.