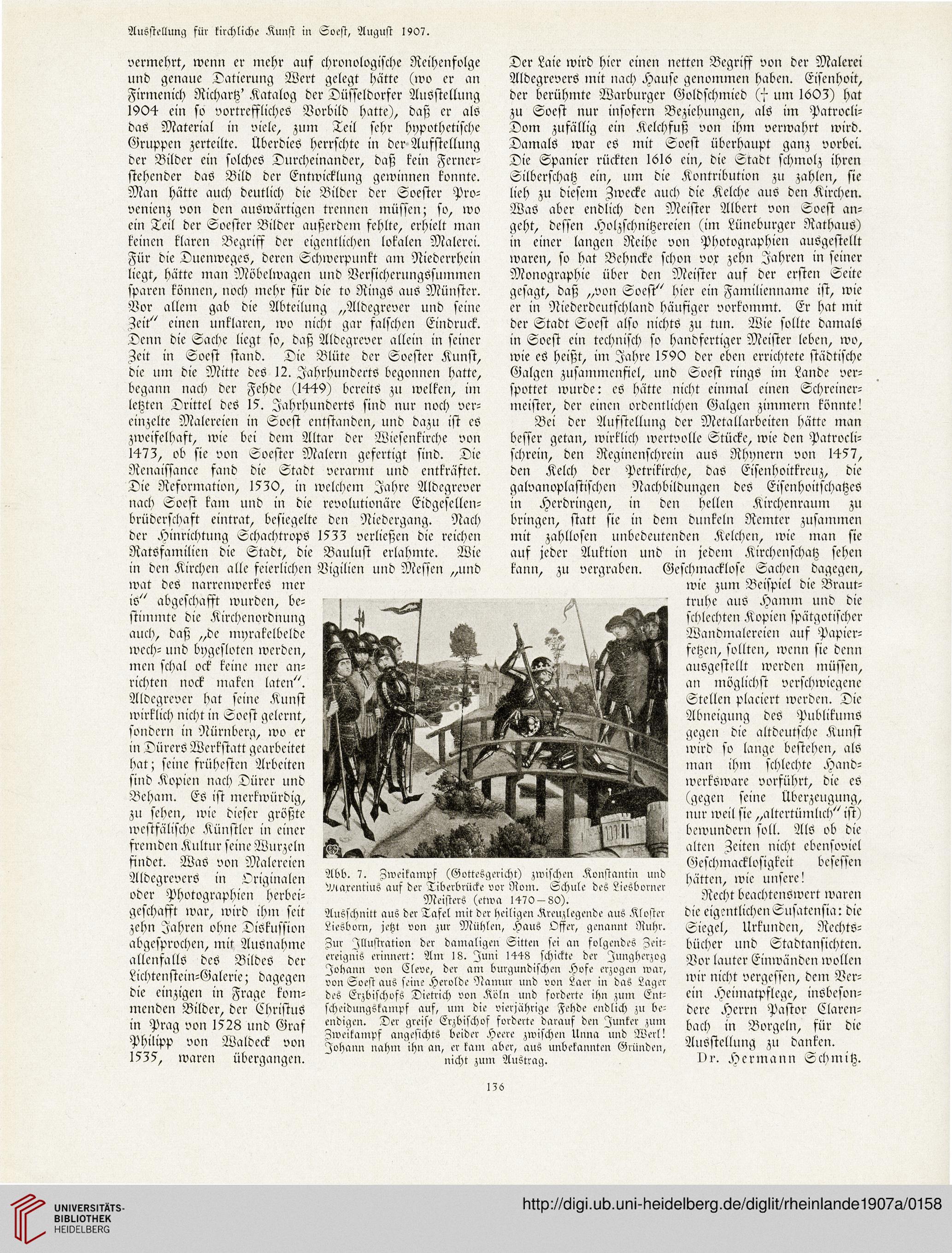Ausstellung für kirchliche Kunst in Soest, August 1907.
vermehrt, wenn er mehr auf chronologische Reihenfolge
rind genaue Datierung Wert gelegt hätte (wo er an
Firmcnich Richartz' Katalog der Düsseldorfer Ausstellung
1904 ein so vortreffliches Vorbild hatte), daß er als
das Material in viele, zum Teil sehr hypothetische
Gruppen zerteilte. Überdies herrschte in der Ausstellung
der Bilder ein solches Durcheinander, daß kein Ferner-
stehender das Bild der Entwicklung gewinnen konnte.
Man hätte auch deutlich die Bilder der Soester Pro-
venienz von den auswärtigen trennen muffen; so, wo
ein Teil der Soester Bilder außerdem fehlte, erhielt man
keinen klaren Begriff der eigentlichen lokalen Malerei.
Für die Duenweges, deren Schwerpunkt am Niederrhein
liegt, hätte inan Möbelwagen und Versicherungssummen
sparen können, noch mehr für die to Rings aus Münster.
Vor allem gab die Abteilung „Aldegrever und seine
Zeit" einen unklaren, wo nicht gar falschen Eindruck.
Denn die Sache liegt so, daß Aldegrever allein in seiner
Zeit in Soest stand. Die Blüte der Soester Kunst,
die um die Mitte des 12. Jahrhunderts begonnen hatte,
begann nach der Fehde (1449) bereits zu welken, im
letzten Drittel des 15. Jahrhunderts sind nur noch ver-
einzelte Malereien in Soest entstanden, und dazu ist es
zweifelhaft, wie bei dem Altar der Wiesenkirche von
I47Z, ob sie von Soester Malern gefertigt sind. Die
Renaissance sand die Stadt verarmt und entkräftet.
Die Reformation, 1550, in welchem Jahre Aldegrever
nach Soest kam und in die revolutionäre Eidgescllcn-
brüdcrschast eintrat, besiegelte den Niedergang. Nach
der Hinrichtung Schachtrups 1555 verließen die reichen
Ratssamilicn die Stadt, die Baulust erlahmte. Wie
in den Kirchen alte feierlichen Vigilien und Messen „und
wat des narrenwerkes mer
is" abgeschafft wurden, be¬
stimmte die Kirchenordnung
aucb, daß „de myrakclbcldc
wcch- und bygcsloten werden,
men schal ock keine mer an¬
richten nock maken laten".
Aldegrever hat seine Kunst
wirklich nicht in Soest gelernt,
sondern in Nürnberg, wo er
in Dürers Werkstatt gearbeitet
hat; seine frühesten Arbeiten
sind Kopien nach Dürer und
Behani. Es ist merkwürdig,
zu sehen, wie dieser größte
westfälische Künstler in einer
fremden Kultur seine Wurzeln
findet. Was von Malereien
Aldegrevers in Originalen
oder Photographien herbei¬
geschafft war, wird ihm seit
zehn Jahren ohne Diskussion
abgcsprochen, mit Ausnahme
allenfalls des Bildes der
Lichtenstein-Galerie; dagegen
die einzigen in Frage kom¬
menden Bilder, der Christus
in Prag von 1528 und Graf
Philipp von Waldeck von
1555, waren übergangen.
Der Laie wird hier einen netten Begriff von der Malerei
Aldegrevers mit nach Hause genommen haben. Eisenhoit,
der berühmte Marburger Goldschmied (ch um 1605) hat
zu Soest nur insofern Beziehungen, als im Patrocli-
Dom zufällig ein Kelchfuß von ihm verwahrt wird.
Damals war cs mit Soest überhaupt ganz vorbei.
Die Spanier rückten 1616 ein, die Stadt schmolz ihren
Silberschatz ein, um die Kontribution zu zahlen, sie
lieh zu diesem Zwecke auch die Kelche aus den Kirchen.
WaS aber endlich den Meister Albert von Soest an-
geht, dessen Holzschnitzereien (im Lüneburger Rathaus)
in einer langen Reihe von Photographien ausgestellt
waren, so hat Behncke schon vox zehn Jahren in seiner
Monographie über den Meister auf der ersten Seite
gesagt, daß „von Soest" hier ein Familienname ist, wie
er in Niederdcutschland häufiger vorkommt. Er hat mit
der Stadt Soest also nichts zu tun. Wie sollte damals
in Soest ein technisch so handfertiger Meister leben, wo,
wie eS heißt, im Jahre 1590 der eben errichtete städtische
Galgen zusammcnficl, und Soest rings im Lande ver-
spottet wurde: cs hätte nicht einmal einen Schreiner-
meister, der einen ordentlichen Galgen zimmern könnte!
Bei der Aufstellung der Metallarbeiten hätte man
besser getan, wirklich wertvolle Stücke, wie den Patrocli-
schrein, den Regincnschrcin aus Rhynern von 1457,
den Kelch der Petrikirche, das Eisenhoitkrcuz, die
galvanoplastischen Nachbildungen des EiscnhoitschatzeS
in Herdringen, in den Hellen Kirchenraum zu
bringen, statt sie in den: dunkeln Remter zusammen
mit zahllosen unbedeutenden Kelchen, wie man sie
auf jeder Auktion und in jedem Kirchcnschatz sehen
kann, zu vergraben. Geschmacklose Sachen dagegen,
wie zum Beispiel die Braut-
truhe aus Hamm und die
schlechten Kopie,: spätgotischer
Wandmalereien auf Papier-
fetzen, sollten, wenn sie denn
ausgestellt werden müssen,
an möglichst verschwiegene
Stellen placiert werden. Die
Abneigung des Publikums
gegen die altdeutsche Kunst
wird so lange bestehen, als
man ihm schlechte Hand-
werksware vorführt, die es
(gegen seine Überzeugung,
nur weil sic „altertümlich" ist)
bewundern soll. Als ob die
alten Zeiten nicht ebensoviel
Geschmacklosigkeit besessen
hätten, wie unsere!
Recht beachtenswert waren
die eigentlichen Susatensia: die
Siegel, Urkunden, Rechts-
bücher und Stadtansichtcn.
Vor lauter Einwänden »vollen
wir nicht vergessen, dem Ver-
ein Heimatpflcge, insbeson-
dere Herrn Pastor Claren-
bach in Borgcln, für die
Ausstellung zu danken.
Ur. Hermann Schmitz.
Abb. 7. Zweikampf (Gottesgericht) zwischen Konstantin und
Maxentius auf der Tiberbrücke vor Rom. Schule des Liesborner
Meisters (etwa 1470 — 80).
Ausschnitt aus der Tafel mit der heiligen Kreuzlegcnde aus Kloster
Liesborn, jetzt von zur Mühlen, Haus Offer, genannt Ruhr.
Am Illustration der damaligen Sitten sei an folgendes Zeit-
ereignis erinnert: Am 18. Juni 1448 schickte der Jungherzog
Johann von Cleve, der am burgundischen Hofe erzogen war,
von Soest aus seine Herolde Namur und von Laer in das Lager
des Erzbischofs Dietrich von Köln und forderte ihn zum Ent-
scheidungskampf auf, um die vierjährige Fehde endlich zu be-
endigen. Der greise Erzbischof forderte darauf den Junker zum
Zweikampf angesichts beider Heere zwischen Unna und Werl!
Johann nahm ihn an, er kam aber, aus unbekannten Gründen,
nicht zum Austrag.
vermehrt, wenn er mehr auf chronologische Reihenfolge
rind genaue Datierung Wert gelegt hätte (wo er an
Firmcnich Richartz' Katalog der Düsseldorfer Ausstellung
1904 ein so vortreffliches Vorbild hatte), daß er als
das Material in viele, zum Teil sehr hypothetische
Gruppen zerteilte. Überdies herrschte in der Ausstellung
der Bilder ein solches Durcheinander, daß kein Ferner-
stehender das Bild der Entwicklung gewinnen konnte.
Man hätte auch deutlich die Bilder der Soester Pro-
venienz von den auswärtigen trennen muffen; so, wo
ein Teil der Soester Bilder außerdem fehlte, erhielt man
keinen klaren Begriff der eigentlichen lokalen Malerei.
Für die Duenweges, deren Schwerpunkt am Niederrhein
liegt, hätte inan Möbelwagen und Versicherungssummen
sparen können, noch mehr für die to Rings aus Münster.
Vor allem gab die Abteilung „Aldegrever und seine
Zeit" einen unklaren, wo nicht gar falschen Eindruck.
Denn die Sache liegt so, daß Aldegrever allein in seiner
Zeit in Soest stand. Die Blüte der Soester Kunst,
die um die Mitte des 12. Jahrhunderts begonnen hatte,
begann nach der Fehde (1449) bereits zu welken, im
letzten Drittel des 15. Jahrhunderts sind nur noch ver-
einzelte Malereien in Soest entstanden, und dazu ist es
zweifelhaft, wie bei dem Altar der Wiesenkirche von
I47Z, ob sie von Soester Malern gefertigt sind. Die
Renaissance sand die Stadt verarmt und entkräftet.
Die Reformation, 1550, in welchem Jahre Aldegrever
nach Soest kam und in die revolutionäre Eidgescllcn-
brüdcrschast eintrat, besiegelte den Niedergang. Nach
der Hinrichtung Schachtrups 1555 verließen die reichen
Ratssamilicn die Stadt, die Baulust erlahmte. Wie
in den Kirchen alte feierlichen Vigilien und Messen „und
wat des narrenwerkes mer
is" abgeschafft wurden, be¬
stimmte die Kirchenordnung
aucb, daß „de myrakclbcldc
wcch- und bygcsloten werden,
men schal ock keine mer an¬
richten nock maken laten".
Aldegrever hat seine Kunst
wirklich nicht in Soest gelernt,
sondern in Nürnberg, wo er
in Dürers Werkstatt gearbeitet
hat; seine frühesten Arbeiten
sind Kopien nach Dürer und
Behani. Es ist merkwürdig,
zu sehen, wie dieser größte
westfälische Künstler in einer
fremden Kultur seine Wurzeln
findet. Was von Malereien
Aldegrevers in Originalen
oder Photographien herbei¬
geschafft war, wird ihm seit
zehn Jahren ohne Diskussion
abgcsprochen, mit Ausnahme
allenfalls des Bildes der
Lichtenstein-Galerie; dagegen
die einzigen in Frage kom¬
menden Bilder, der Christus
in Prag von 1528 und Graf
Philipp von Waldeck von
1555, waren übergangen.
Der Laie wird hier einen netten Begriff von der Malerei
Aldegrevers mit nach Hause genommen haben. Eisenhoit,
der berühmte Marburger Goldschmied (ch um 1605) hat
zu Soest nur insofern Beziehungen, als im Patrocli-
Dom zufällig ein Kelchfuß von ihm verwahrt wird.
Damals war cs mit Soest überhaupt ganz vorbei.
Die Spanier rückten 1616 ein, die Stadt schmolz ihren
Silberschatz ein, um die Kontribution zu zahlen, sie
lieh zu diesem Zwecke auch die Kelche aus den Kirchen.
WaS aber endlich den Meister Albert von Soest an-
geht, dessen Holzschnitzereien (im Lüneburger Rathaus)
in einer langen Reihe von Photographien ausgestellt
waren, so hat Behncke schon vox zehn Jahren in seiner
Monographie über den Meister auf der ersten Seite
gesagt, daß „von Soest" hier ein Familienname ist, wie
er in Niederdcutschland häufiger vorkommt. Er hat mit
der Stadt Soest also nichts zu tun. Wie sollte damals
in Soest ein technisch so handfertiger Meister leben, wo,
wie eS heißt, im Jahre 1590 der eben errichtete städtische
Galgen zusammcnficl, und Soest rings im Lande ver-
spottet wurde: cs hätte nicht einmal einen Schreiner-
meister, der einen ordentlichen Galgen zimmern könnte!
Bei der Aufstellung der Metallarbeiten hätte man
besser getan, wirklich wertvolle Stücke, wie den Patrocli-
schrein, den Regincnschrcin aus Rhynern von 1457,
den Kelch der Petrikirche, das Eisenhoitkrcuz, die
galvanoplastischen Nachbildungen des EiscnhoitschatzeS
in Herdringen, in den Hellen Kirchenraum zu
bringen, statt sie in den: dunkeln Remter zusammen
mit zahllosen unbedeutenden Kelchen, wie man sie
auf jeder Auktion und in jedem Kirchcnschatz sehen
kann, zu vergraben. Geschmacklose Sachen dagegen,
wie zum Beispiel die Braut-
truhe aus Hamm und die
schlechten Kopie,: spätgotischer
Wandmalereien auf Papier-
fetzen, sollten, wenn sie denn
ausgestellt werden müssen,
an möglichst verschwiegene
Stellen placiert werden. Die
Abneigung des Publikums
gegen die altdeutsche Kunst
wird so lange bestehen, als
man ihm schlechte Hand-
werksware vorführt, die es
(gegen seine Überzeugung,
nur weil sic „altertümlich" ist)
bewundern soll. Als ob die
alten Zeiten nicht ebensoviel
Geschmacklosigkeit besessen
hätten, wie unsere!
Recht beachtenswert waren
die eigentlichen Susatensia: die
Siegel, Urkunden, Rechts-
bücher und Stadtansichtcn.
Vor lauter Einwänden »vollen
wir nicht vergessen, dem Ver-
ein Heimatpflcge, insbeson-
dere Herrn Pastor Claren-
bach in Borgcln, für die
Ausstellung zu danken.
Ur. Hermann Schmitz.
Abb. 7. Zweikampf (Gottesgericht) zwischen Konstantin und
Maxentius auf der Tiberbrücke vor Rom. Schule des Liesborner
Meisters (etwa 1470 — 80).
Ausschnitt aus der Tafel mit der heiligen Kreuzlegcnde aus Kloster
Liesborn, jetzt von zur Mühlen, Haus Offer, genannt Ruhr.
Am Illustration der damaligen Sitten sei an folgendes Zeit-
ereignis erinnert: Am 18. Juni 1448 schickte der Jungherzog
Johann von Cleve, der am burgundischen Hofe erzogen war,
von Soest aus seine Herolde Namur und von Laer in das Lager
des Erzbischofs Dietrich von Köln und forderte ihn zum Ent-
scheidungskampf auf, um die vierjährige Fehde endlich zu be-
endigen. Der greise Erzbischof forderte darauf den Junker zum
Zweikampf angesichts beider Heere zwischen Unna und Werl!
Johann nahm ihn an, er kam aber, aus unbekannten Gründen,
nicht zum Austrag.