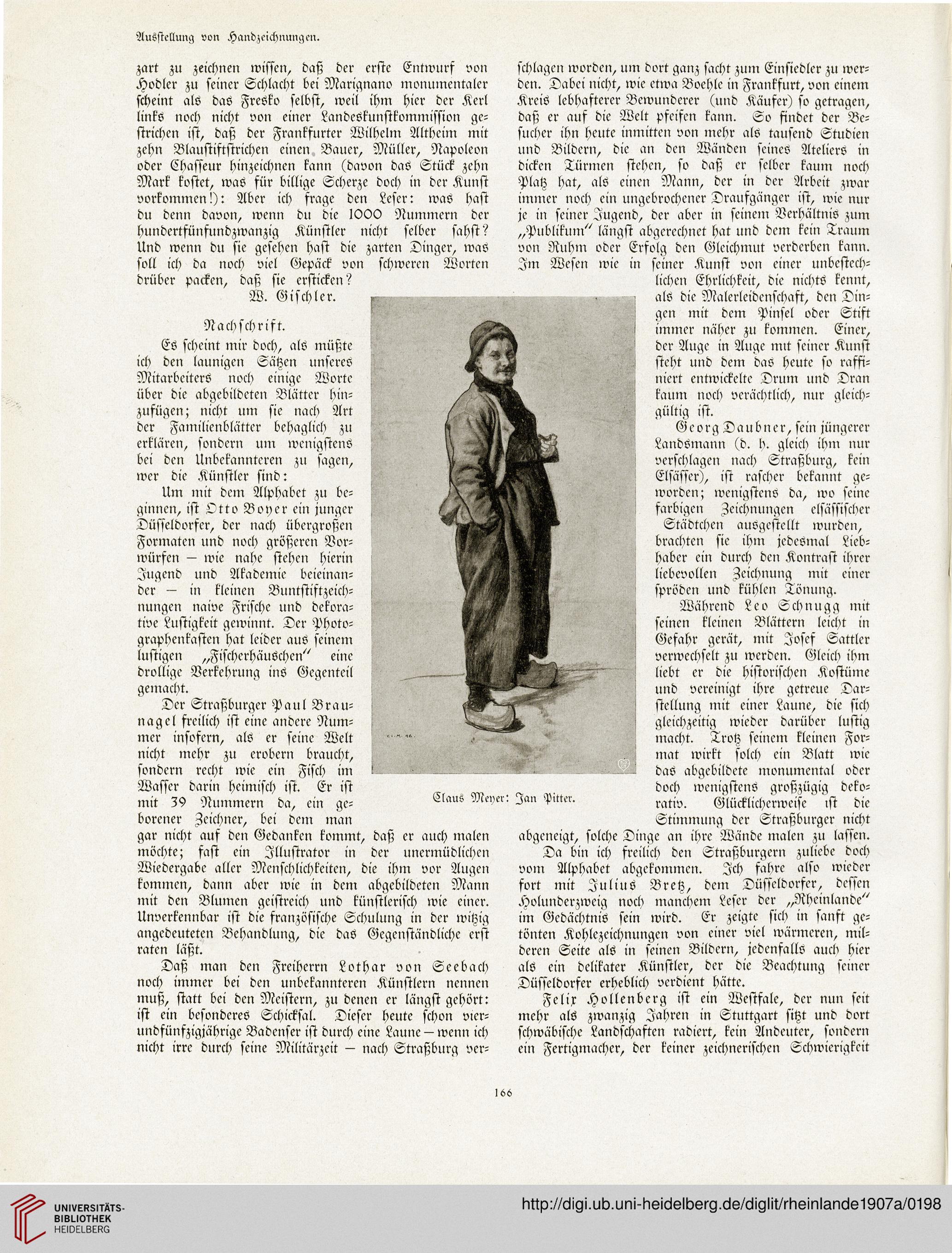Ausstellung von Handzeichnungcn.
zart zu zeichnen wissen, daß der erste Entwurf van
Hodler zu seiner Schlacht bei Marignano monumentaler
scheint als das Fresko selbst, weil ihm hier der Kerl
links noch nicht von einer Landeökunstkommission ge-
strichen ist, daß der Frankfurter Wilhelm Althcim mit
zehn Blaustiftstrichen einen Bauer, Müller, Napoleon
oder Chasseur hinzeichnen kann (davon das Stück zehn
Mark kostet, was für billige Scherze doch in der Kunst
vorkommen!): Aber ich frage den Leser: was hast
du denn davon, wenn du die IOOO Nummern der
hundertfünsundzwanzig Künstler nicht selber sahst?
Und wenn du sie gesehen hast die zarten Dinger, was
soll ich da noch viel Gepäck von schweren Worten
drüber packen, daß sie ersticken?
W. Gischler.
Nachschrift.
Es scheint mir doch, als müßte
ich den lärmigen Sätzen unseres
Mitarbeiters noch einige Worte
über die abgebildeten Blätter hin-
zufügen; nicht um sie nach Art
der Familicnblättcr behaglich zu
erklären, sondern um wenigstens
bei den Unbekannteren zu sagen,
wer die Künstler sind:
Um mit dem Alphabet zu be-
ginnen, ist Otto Boyer ein junger
Düsseldorfer, der nach übergroßen
Formaten und noch größeren Vor-
würfen — wie nabe stehen hierin
Jugend und Akademie beieinan-
der — in kleinen Buntstistzeich-
nungcn naive Frische und dekora-
tive Lustigkeit gewinnt. Der Photo-
graphenkasten hat leider aus seinem
lustigen „Fischerhäuschcn" eine
drollige Verkehrung ins Gegenteil
gemacht.
Der Straßburger Paul Brau-
nagel freilich ist eine andere Num-
mer insofern, als er seine Welt
nicht mehr zu erobern braucht,
sondern recht wie ein Fisch im
Wasser darin heimisch ist. Er ist
mit 39 Nummern da, ein ge-
borener Zeichner, bei dem man
gar nicht aus den Gedanken kommt, daß er auch malen
möchte; fast ein Illustrator in der unermüdlichen
Wiedergabe aller Menschlichkeiten, die ihm vor Augen
kommen, dann aber wie in dem abgebildeten Mann
mit den Blumen geistreich und künstlerisch wie einer.
Unverkennbar ist die französische Schulung in der witzig
«»gedeuteten Behandlung, die daö Gegenständliche erst
raten läßt.
Daß man den Frciherrn Lothar von Seebach
noch immer bei den unbekannteren Künstlern nennen
muß, statt bei den Meistern, zu denen er längst gehört:
ist ein besonderes Schicksal. Dieser heute schon vicr-
undfünszigjährige Badenser ist durch eine Laune - wenn ich
nicht irre durch seine Militärzcit — nach Straßburg ver-
schlagen worden, um dort ganz sacht zum Einsiedler zu wer-
den. Dabei nicht, wie etwa Boehle in Frankfurt, von einem
Kreis lebhafterer Bewunderer (und Käufer) so getragen,
daß er auf die Welt pfeifen kann. So findet der Be-
sucher ihn heute inmitten von mehr als tausend Studien
und Bildern, die an den Wänden seines Ateliers in
dicken Türmen stehen, so daß er selber kaum noch
Platz hat, als einen Mann, der in der Arbeit zwar
immer noch ein ungebrochener Draufgänger ist, wie nur
je in seiner Jugend, der aber in seinem Verhältnis zum
„Publikum" längst abgerechnet hat und dem kein Traum
von Ruhm oder Erfolg den Gleichmut verderben kann.
Im Wesen wie in seiner Kunst von einer unbestech-
lichen Ehrlichkeit, die nichts kennt,
als die Malerleidenschaft, den Din-
gen mit dem Pinsel oder Stift
immer näher zu kommen. Einer,
der Auge in Auge nut seiner Kunst
steht und dem das heute so raffi-
niert entwickelte Drum und Dran
kaum noch verächtlich, nur gleich-
gültig ist.
Georg Daubner, sein jüngerer
Landsmann (d. h. gleich ihm nur
verschlagen nach Straßburg, kein
Elsässer), ist rascher bekannt ge-
worden; wenigstens da, wo seine
farbigen Zeichnungen elsässischer
Städtchen ausgestellt wurden,
brachten sie ihm jcdcSmal Lieb-
haber ein durch den Kontrast ihrer
liebevollen Zeichnung mit einer
spröden und kühlen Tönung.
Während Leo Schnugg mit
seinen kleinen Blättern leicht in
Gefahr gerät, mit Joses Sattler
verwechselt zu werden. Gleich ihm
liebt er die historischen Kostüme
und vereinigt ihre getreue Dar-
stellung mit einer Laune, die sich
gleichzeitig wieder darüber lustig
macht. Trotz seinem kleinen For-
mat wirkt solch ein Blatt wie
das abgebildete monumental oder
doch wenigstens großzügig deko-
rativ. Glücklicherweise ist die
Stimmung der Straßburger nicht
abgeneigt, solche Dinge an ihre Wände malen zu lassen.
Da bin ich freilich den Straßburgern zuliebe doch
vom Alphabet abgckommcn. Ich fahre also wieder
fort mit Julius Bretz, dem Düsseldorfer, dessen
Hvlunderzweig noch manchem Leser der „Rheinlande"
im Gedächtnis sein wird. Er zeigte sich in sanft ge-
tönten Kohlezeichnungen von einer viel wärmeren, mil-
deren Seite als in seinen Bildern, jedenfalls auch hier
als ein delikater Künstler, der die Beachtung seiner
Düsseldorfer erheblich verdient hätte.
Felix Hollenberg ist ein Westfale, der nun seit
mehr als zwanzig Jahren in Stuttgart sitzt und dort
schwäbische Landschaften radiert, kein Andeuter, sondern
ein Fertigmacher, der keiner zeichnerischen Schwierigkeit
«E'M '-W
zart zu zeichnen wissen, daß der erste Entwurf van
Hodler zu seiner Schlacht bei Marignano monumentaler
scheint als das Fresko selbst, weil ihm hier der Kerl
links noch nicht von einer Landeökunstkommission ge-
strichen ist, daß der Frankfurter Wilhelm Althcim mit
zehn Blaustiftstrichen einen Bauer, Müller, Napoleon
oder Chasseur hinzeichnen kann (davon das Stück zehn
Mark kostet, was für billige Scherze doch in der Kunst
vorkommen!): Aber ich frage den Leser: was hast
du denn davon, wenn du die IOOO Nummern der
hundertfünsundzwanzig Künstler nicht selber sahst?
Und wenn du sie gesehen hast die zarten Dinger, was
soll ich da noch viel Gepäck von schweren Worten
drüber packen, daß sie ersticken?
W. Gischler.
Nachschrift.
Es scheint mir doch, als müßte
ich den lärmigen Sätzen unseres
Mitarbeiters noch einige Worte
über die abgebildeten Blätter hin-
zufügen; nicht um sie nach Art
der Familicnblättcr behaglich zu
erklären, sondern um wenigstens
bei den Unbekannteren zu sagen,
wer die Künstler sind:
Um mit dem Alphabet zu be-
ginnen, ist Otto Boyer ein junger
Düsseldorfer, der nach übergroßen
Formaten und noch größeren Vor-
würfen — wie nabe stehen hierin
Jugend und Akademie beieinan-
der — in kleinen Buntstistzeich-
nungcn naive Frische und dekora-
tive Lustigkeit gewinnt. Der Photo-
graphenkasten hat leider aus seinem
lustigen „Fischerhäuschcn" eine
drollige Verkehrung ins Gegenteil
gemacht.
Der Straßburger Paul Brau-
nagel freilich ist eine andere Num-
mer insofern, als er seine Welt
nicht mehr zu erobern braucht,
sondern recht wie ein Fisch im
Wasser darin heimisch ist. Er ist
mit 39 Nummern da, ein ge-
borener Zeichner, bei dem man
gar nicht aus den Gedanken kommt, daß er auch malen
möchte; fast ein Illustrator in der unermüdlichen
Wiedergabe aller Menschlichkeiten, die ihm vor Augen
kommen, dann aber wie in dem abgebildeten Mann
mit den Blumen geistreich und künstlerisch wie einer.
Unverkennbar ist die französische Schulung in der witzig
«»gedeuteten Behandlung, die daö Gegenständliche erst
raten läßt.
Daß man den Frciherrn Lothar von Seebach
noch immer bei den unbekannteren Künstlern nennen
muß, statt bei den Meistern, zu denen er längst gehört:
ist ein besonderes Schicksal. Dieser heute schon vicr-
undfünszigjährige Badenser ist durch eine Laune - wenn ich
nicht irre durch seine Militärzcit — nach Straßburg ver-
schlagen worden, um dort ganz sacht zum Einsiedler zu wer-
den. Dabei nicht, wie etwa Boehle in Frankfurt, von einem
Kreis lebhafterer Bewunderer (und Käufer) so getragen,
daß er auf die Welt pfeifen kann. So findet der Be-
sucher ihn heute inmitten von mehr als tausend Studien
und Bildern, die an den Wänden seines Ateliers in
dicken Türmen stehen, so daß er selber kaum noch
Platz hat, als einen Mann, der in der Arbeit zwar
immer noch ein ungebrochener Draufgänger ist, wie nur
je in seiner Jugend, der aber in seinem Verhältnis zum
„Publikum" längst abgerechnet hat und dem kein Traum
von Ruhm oder Erfolg den Gleichmut verderben kann.
Im Wesen wie in seiner Kunst von einer unbestech-
lichen Ehrlichkeit, die nichts kennt,
als die Malerleidenschaft, den Din-
gen mit dem Pinsel oder Stift
immer näher zu kommen. Einer,
der Auge in Auge nut seiner Kunst
steht und dem das heute so raffi-
niert entwickelte Drum und Dran
kaum noch verächtlich, nur gleich-
gültig ist.
Georg Daubner, sein jüngerer
Landsmann (d. h. gleich ihm nur
verschlagen nach Straßburg, kein
Elsässer), ist rascher bekannt ge-
worden; wenigstens da, wo seine
farbigen Zeichnungen elsässischer
Städtchen ausgestellt wurden,
brachten sie ihm jcdcSmal Lieb-
haber ein durch den Kontrast ihrer
liebevollen Zeichnung mit einer
spröden und kühlen Tönung.
Während Leo Schnugg mit
seinen kleinen Blättern leicht in
Gefahr gerät, mit Joses Sattler
verwechselt zu werden. Gleich ihm
liebt er die historischen Kostüme
und vereinigt ihre getreue Dar-
stellung mit einer Laune, die sich
gleichzeitig wieder darüber lustig
macht. Trotz seinem kleinen For-
mat wirkt solch ein Blatt wie
das abgebildete monumental oder
doch wenigstens großzügig deko-
rativ. Glücklicherweise ist die
Stimmung der Straßburger nicht
abgeneigt, solche Dinge an ihre Wände malen zu lassen.
Da bin ich freilich den Straßburgern zuliebe doch
vom Alphabet abgckommcn. Ich fahre also wieder
fort mit Julius Bretz, dem Düsseldorfer, dessen
Hvlunderzweig noch manchem Leser der „Rheinlande"
im Gedächtnis sein wird. Er zeigte sich in sanft ge-
tönten Kohlezeichnungen von einer viel wärmeren, mil-
deren Seite als in seinen Bildern, jedenfalls auch hier
als ein delikater Künstler, der die Beachtung seiner
Düsseldorfer erheblich verdient hätte.
Felix Hollenberg ist ein Westfale, der nun seit
mehr als zwanzig Jahren in Stuttgart sitzt und dort
schwäbische Landschaften radiert, kein Andeuter, sondern
ein Fertigmacher, der keiner zeichnerischen Schwierigkeit
«E'M '-W