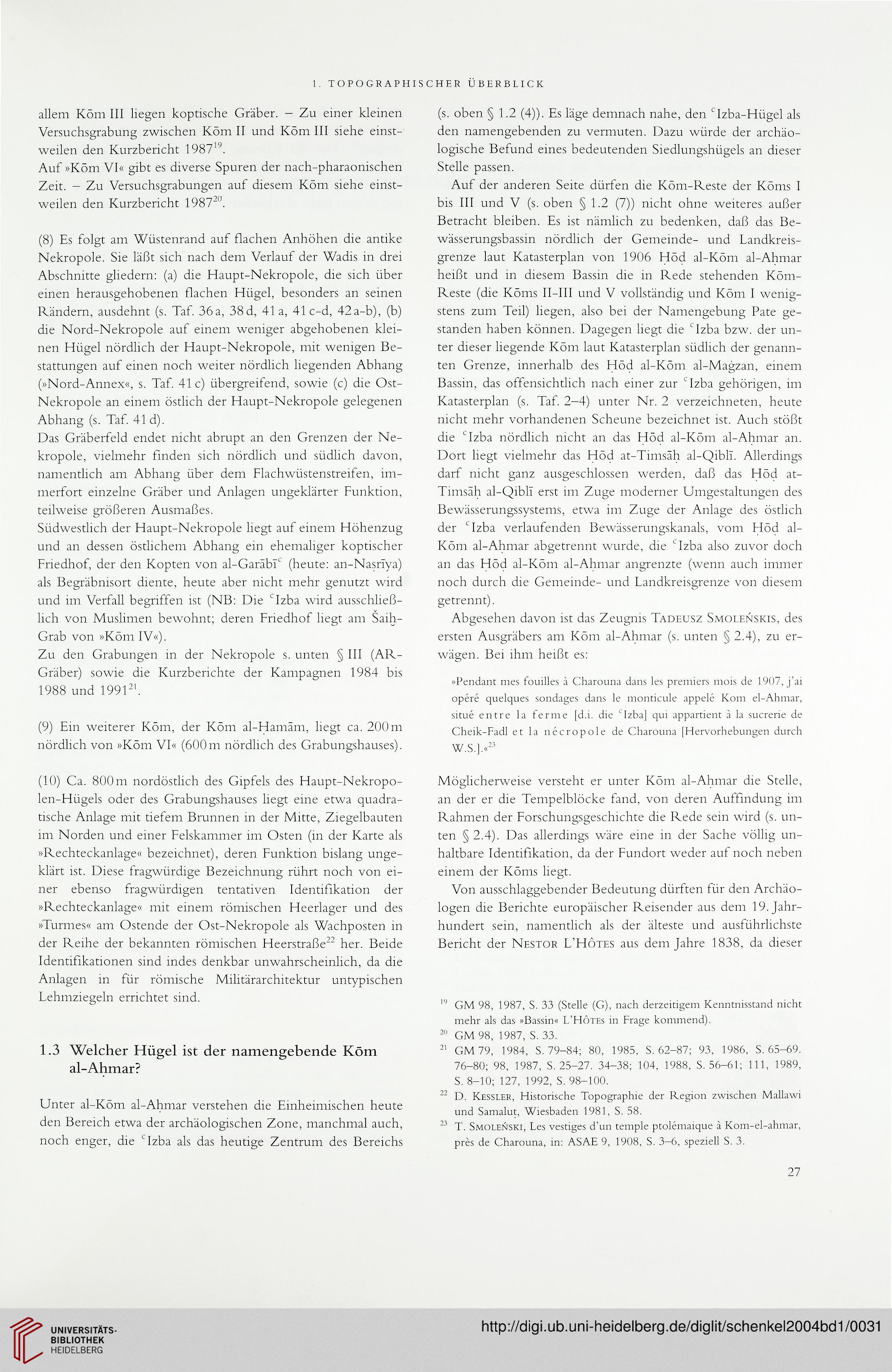1. topographischer überblick
allem Köm III liegen koptische Gräber. - Zu einer kleinen
Versuchsgrabung zwischen Köm II und Köm III siehe einst-
weilen den Kurzbericht 198719.
Auf »Köm VI« gibt es diverse Spuren der nach-pharaomschen
Zeit. — Zu Versuchsgrabungen auf diesem Köm siehe einst-
weilen den Kurzbericht 19872".
(8) Es folgt am Wüstenrand auf flachen Anhöhen die antike
Nekropole. Sie läßt sich nach dem Verlauf der Wadis in drei
Abschnitte gliedern: (a) die Haupt-Nekropole, die sich über
einen herausgehobenen flachen Hügel, besonders an seinen
Rändern, ausdehnt (s. Taf. 36a, 38d, 41 a, 41c-d, 42a-b), (b)
die Nord-Nekropole auf einem weniger abgehobenen klei-
nen Hügel nördlich der Haupt-Nekropole, mit wenigen Be-
stattungen auf einen noch weiter nördlich liegenden Abhang
(»Nord-Annex«, s. Taf. 41 c) übergreifend, sowie (c) die Ost-
Nekropole an einem östlich der Haupt-Nekropole gelegenen
Abhang (s. Taf. 41 d).
Das Gräberfeld endet nicht abrupt an den Grenzen der Ne-
kropole, vielmehr finden sich nördlich und südlich davon,
namentlich am Abhang über dem Flachwüstenstreifen, im-
merfort einzelne Gräber und Anlagen ungeklärter Funktion,
teilweise größeren Ausmaßes.
Südwestlich der Haupt-Nekropole liegt auf einem Höhenzug
und an dessen östlichem Abhang ein ehemaliger koptischer
Friedhof, der den Kopten von al-Garäbic (heute: an-Nasrlya)
als Begräbnisort diente, heute aber nicht mehr genutzt wird
und im Verfall begriffen ist (NB: Die LIzba wird ausschließ-
lich von Muslimen bewohnt; deren Friedhof liegt am Saih-
Grab von »Köm IV«).
Zu den Grabungen in der Nekropole s. unten § III (AR-
Gräber) sowie die Kurzberichte der Kampagnen 1984 bis
1988 und 199121.
(9) Em weiterer Köm, der Köm al-Hamäm, liegt ca. 200 m
nördlich von »Köm VI« (600m nördlich des Grabungshauses).
(10) Ca. 800 m nordöstlich des Gipfels des Haupt-Nekropo-
len-Hügels oder des Grabungshauses liegt eine etwa quadra-
tische Anlage mit tiefem Brunnen in der Mitte, Ziegelbauten
im Norden und einer Felskammer im Osten (in der Karte als
»Rechteckanlage« bezeichnet), deren Funktion bislang unge-
klärt ist. Diese fragwürdige Bezeichnung rührt noch von ei-
ner ebenso fragwürdigen tentativen Identifikation der
»Rechteckanlage« mit einem römischen Heerlager und des
»Turmes« am Ostende der Ost-Nekropole als Wachposten in
der Reihe der bekannten römischen Heerstraße22 her. Beide
Identifikationen sind indes denkbar unwahrscheinlich, da die
Anlagen in für römische Militärarchitektur untypischen
Lehmziegeln errichtet sind.
1.3 Welcher Hügel ist der namengebende Köm
al-Ahmar?
Unter al-Köm al-Ahmar verstehen die Einheimischen heute
den Bereich etwa der archäologischen Zone, manchmal auch,
noch enger, die cIzba als das heutige Zentrum des Bereichs
(s. oben § 1.2 (4)). Es läge demnach nahe, den cIzba-Hügel als
den namengebenden zu vermuten. Dazu würde der archäo-
logische Befund eines bedeutenden Siedlungshügels an dieser
Stelle passen.
Auf der anderen Seite dürfen die Köm-Reste der Köms I
bis III und V (s. oben § 1.2 (7)) nicht ohne weiteres außer
Betracht bleiben. Es ist nämlich zu bedenken, daß das Be-
wässerungsbassin nördlich der Gemeinde- und Landkreis-
grenze laut Katasterplan von 1906 Höd al-Köm al-Ahmar
heißt und in diesem Bassin die in Rede stehenden Köm-
Reste (die Köms II-III und V vollständig und Köm I wenig-
stens zum Teil) liegen, also bei der Namengebung Pate ge-
standen haben können. Dagegen liegt die cIzba bzw. der un-
ter dieser liegende Köm laut Katasterplan südlich der genann-
ten Grenze, innerhalb des Höd al-Köm al-Magzan, einem
Bassin, das offensichtlich nach einer zur LIzba gehörigen, im
Katasterplan (s. Taf. 2—4) unter Nr. 2 verzeichneten, heute
nicht mehr vorhandenen Scheune bezeichnet ist. Auch stößt
die cIzba nördlich nicht an das Höd al-Köm al-Ahmar an.
Dort liegt vielmehr das Höd at-Timsäh al-QiblT. Allerdings
darf nicht ganz ausgeschlossen werden, daß das Höd at-
Timsäh al-Qibli erst im Zuge moderner Umgestaltungen des
Bewässerungssystems, etwa im Zuge der Anlage des östlich
der L Izba verlaufenden Bewässerungskanals, vom Höd al-
Köm al-Ahmar abgetrennt wurde, die LIzba also zuvor doch
an das Höd al-Köm al-Ahmar angrenzte (wenn auch immer
noch durch die Gemeinde- und Landkreisgrenze von diesem
getrennt).
Abgesehen davon ist das Zeugnis Tadeusz Smolenskis, des
ersten Ausgräbers am Köm al-Ahmar (s. unten § 2.4), zu er-
wägen. Bei ihm heißt es:
»Pendant tnes fouilles ä Charouna dans les premiers mois de 1907, j'ai
opere quelques sondages dans le monticule appele Koni el-Ahmar,
situe entre la ferme [d.i. die e Izba] qui appartient ä la sucrerie de
Cheik-Fadl et la necropole de Charouna [Hervorhebungen durch
W.S.].«23
Möglicherweise versteht er unter Köm al-Ahmar die Stelle,
an der er die Tempelblöcke fand, von deren Auffindung im
Rahmen der Forschungsgeschichte die Rede sein wird (s. un-
ten § 2.4). Das allerdings wäre eine in der Sache völlig un-
haltbare Identifikation, da der Fundort weder auf noch neben
einem der Köms liegt.
Von ausschlaggebender Bedeutung dürften für den Archäo-
logen die Berichte europäischer Reisender aus dem ^.Jahr-
hundert sein, namentlich als der älteste und ausführlichste
Bericht der Nestor L'Hötes aus dem Jahre 1838, da dieser
19 GM 98, 1987, S. 33 (Stelle (G), nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
mehr als das »Bassin« L'Hötes in Frage kommend).
20 GM 98, 1987, S. 33.
21 GM 79, 1984, S. 79-84; 80, 1985, S. 62-87; 93, 1986, S. 65-69.
76-80; 98, 1987, S. 25-27. 34-38; 104, 1988, S. 56-61; 111, 1989,
S. 8-10; 127, 1992, S. 98-100.
22 D. Kessler, Historische Topographie der Region zwischen Mallawi
und Samalut, Wiesbaden 1981, S. 58.
23 T. Smolenski, Les vestiges d'un temple ptolemaique ä Kom-el-ahmar,
pres de Charouna, in: ASAE 9, 1908, S. 3-6, speziell S. 3.
27
allem Köm III liegen koptische Gräber. - Zu einer kleinen
Versuchsgrabung zwischen Köm II und Köm III siehe einst-
weilen den Kurzbericht 198719.
Auf »Köm VI« gibt es diverse Spuren der nach-pharaomschen
Zeit. — Zu Versuchsgrabungen auf diesem Köm siehe einst-
weilen den Kurzbericht 19872".
(8) Es folgt am Wüstenrand auf flachen Anhöhen die antike
Nekropole. Sie läßt sich nach dem Verlauf der Wadis in drei
Abschnitte gliedern: (a) die Haupt-Nekropole, die sich über
einen herausgehobenen flachen Hügel, besonders an seinen
Rändern, ausdehnt (s. Taf. 36a, 38d, 41 a, 41c-d, 42a-b), (b)
die Nord-Nekropole auf einem weniger abgehobenen klei-
nen Hügel nördlich der Haupt-Nekropole, mit wenigen Be-
stattungen auf einen noch weiter nördlich liegenden Abhang
(»Nord-Annex«, s. Taf. 41 c) übergreifend, sowie (c) die Ost-
Nekropole an einem östlich der Haupt-Nekropole gelegenen
Abhang (s. Taf. 41 d).
Das Gräberfeld endet nicht abrupt an den Grenzen der Ne-
kropole, vielmehr finden sich nördlich und südlich davon,
namentlich am Abhang über dem Flachwüstenstreifen, im-
merfort einzelne Gräber und Anlagen ungeklärter Funktion,
teilweise größeren Ausmaßes.
Südwestlich der Haupt-Nekropole liegt auf einem Höhenzug
und an dessen östlichem Abhang ein ehemaliger koptischer
Friedhof, der den Kopten von al-Garäbic (heute: an-Nasrlya)
als Begräbnisort diente, heute aber nicht mehr genutzt wird
und im Verfall begriffen ist (NB: Die LIzba wird ausschließ-
lich von Muslimen bewohnt; deren Friedhof liegt am Saih-
Grab von »Köm IV«).
Zu den Grabungen in der Nekropole s. unten § III (AR-
Gräber) sowie die Kurzberichte der Kampagnen 1984 bis
1988 und 199121.
(9) Em weiterer Köm, der Köm al-Hamäm, liegt ca. 200 m
nördlich von »Köm VI« (600m nördlich des Grabungshauses).
(10) Ca. 800 m nordöstlich des Gipfels des Haupt-Nekropo-
len-Hügels oder des Grabungshauses liegt eine etwa quadra-
tische Anlage mit tiefem Brunnen in der Mitte, Ziegelbauten
im Norden und einer Felskammer im Osten (in der Karte als
»Rechteckanlage« bezeichnet), deren Funktion bislang unge-
klärt ist. Diese fragwürdige Bezeichnung rührt noch von ei-
ner ebenso fragwürdigen tentativen Identifikation der
»Rechteckanlage« mit einem römischen Heerlager und des
»Turmes« am Ostende der Ost-Nekropole als Wachposten in
der Reihe der bekannten römischen Heerstraße22 her. Beide
Identifikationen sind indes denkbar unwahrscheinlich, da die
Anlagen in für römische Militärarchitektur untypischen
Lehmziegeln errichtet sind.
1.3 Welcher Hügel ist der namengebende Köm
al-Ahmar?
Unter al-Köm al-Ahmar verstehen die Einheimischen heute
den Bereich etwa der archäologischen Zone, manchmal auch,
noch enger, die cIzba als das heutige Zentrum des Bereichs
(s. oben § 1.2 (4)). Es läge demnach nahe, den cIzba-Hügel als
den namengebenden zu vermuten. Dazu würde der archäo-
logische Befund eines bedeutenden Siedlungshügels an dieser
Stelle passen.
Auf der anderen Seite dürfen die Köm-Reste der Köms I
bis III und V (s. oben § 1.2 (7)) nicht ohne weiteres außer
Betracht bleiben. Es ist nämlich zu bedenken, daß das Be-
wässerungsbassin nördlich der Gemeinde- und Landkreis-
grenze laut Katasterplan von 1906 Höd al-Köm al-Ahmar
heißt und in diesem Bassin die in Rede stehenden Köm-
Reste (die Köms II-III und V vollständig und Köm I wenig-
stens zum Teil) liegen, also bei der Namengebung Pate ge-
standen haben können. Dagegen liegt die cIzba bzw. der un-
ter dieser liegende Köm laut Katasterplan südlich der genann-
ten Grenze, innerhalb des Höd al-Köm al-Magzan, einem
Bassin, das offensichtlich nach einer zur LIzba gehörigen, im
Katasterplan (s. Taf. 2—4) unter Nr. 2 verzeichneten, heute
nicht mehr vorhandenen Scheune bezeichnet ist. Auch stößt
die cIzba nördlich nicht an das Höd al-Köm al-Ahmar an.
Dort liegt vielmehr das Höd at-Timsäh al-QiblT. Allerdings
darf nicht ganz ausgeschlossen werden, daß das Höd at-
Timsäh al-Qibli erst im Zuge moderner Umgestaltungen des
Bewässerungssystems, etwa im Zuge der Anlage des östlich
der L Izba verlaufenden Bewässerungskanals, vom Höd al-
Köm al-Ahmar abgetrennt wurde, die LIzba also zuvor doch
an das Höd al-Köm al-Ahmar angrenzte (wenn auch immer
noch durch die Gemeinde- und Landkreisgrenze von diesem
getrennt).
Abgesehen davon ist das Zeugnis Tadeusz Smolenskis, des
ersten Ausgräbers am Köm al-Ahmar (s. unten § 2.4), zu er-
wägen. Bei ihm heißt es:
»Pendant tnes fouilles ä Charouna dans les premiers mois de 1907, j'ai
opere quelques sondages dans le monticule appele Koni el-Ahmar,
situe entre la ferme [d.i. die e Izba] qui appartient ä la sucrerie de
Cheik-Fadl et la necropole de Charouna [Hervorhebungen durch
W.S.].«23
Möglicherweise versteht er unter Köm al-Ahmar die Stelle,
an der er die Tempelblöcke fand, von deren Auffindung im
Rahmen der Forschungsgeschichte die Rede sein wird (s. un-
ten § 2.4). Das allerdings wäre eine in der Sache völlig un-
haltbare Identifikation, da der Fundort weder auf noch neben
einem der Köms liegt.
Von ausschlaggebender Bedeutung dürften für den Archäo-
logen die Berichte europäischer Reisender aus dem ^.Jahr-
hundert sein, namentlich als der älteste und ausführlichste
Bericht der Nestor L'Hötes aus dem Jahre 1838, da dieser
19 GM 98, 1987, S. 33 (Stelle (G), nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
mehr als das »Bassin« L'Hötes in Frage kommend).
20 GM 98, 1987, S. 33.
21 GM 79, 1984, S. 79-84; 80, 1985, S. 62-87; 93, 1986, S. 65-69.
76-80; 98, 1987, S. 25-27. 34-38; 104, 1988, S. 56-61; 111, 1989,
S. 8-10; 127, 1992, S. 98-100.
22 D. Kessler, Historische Topographie der Region zwischen Mallawi
und Samalut, Wiesbaden 1981, S. 58.
23 T. Smolenski, Les vestiges d'un temple ptolemaique ä Kom-el-ahmar,
pres de Charouna, in: ASAE 9, 1908, S. 3-6, speziell S. 3.
27