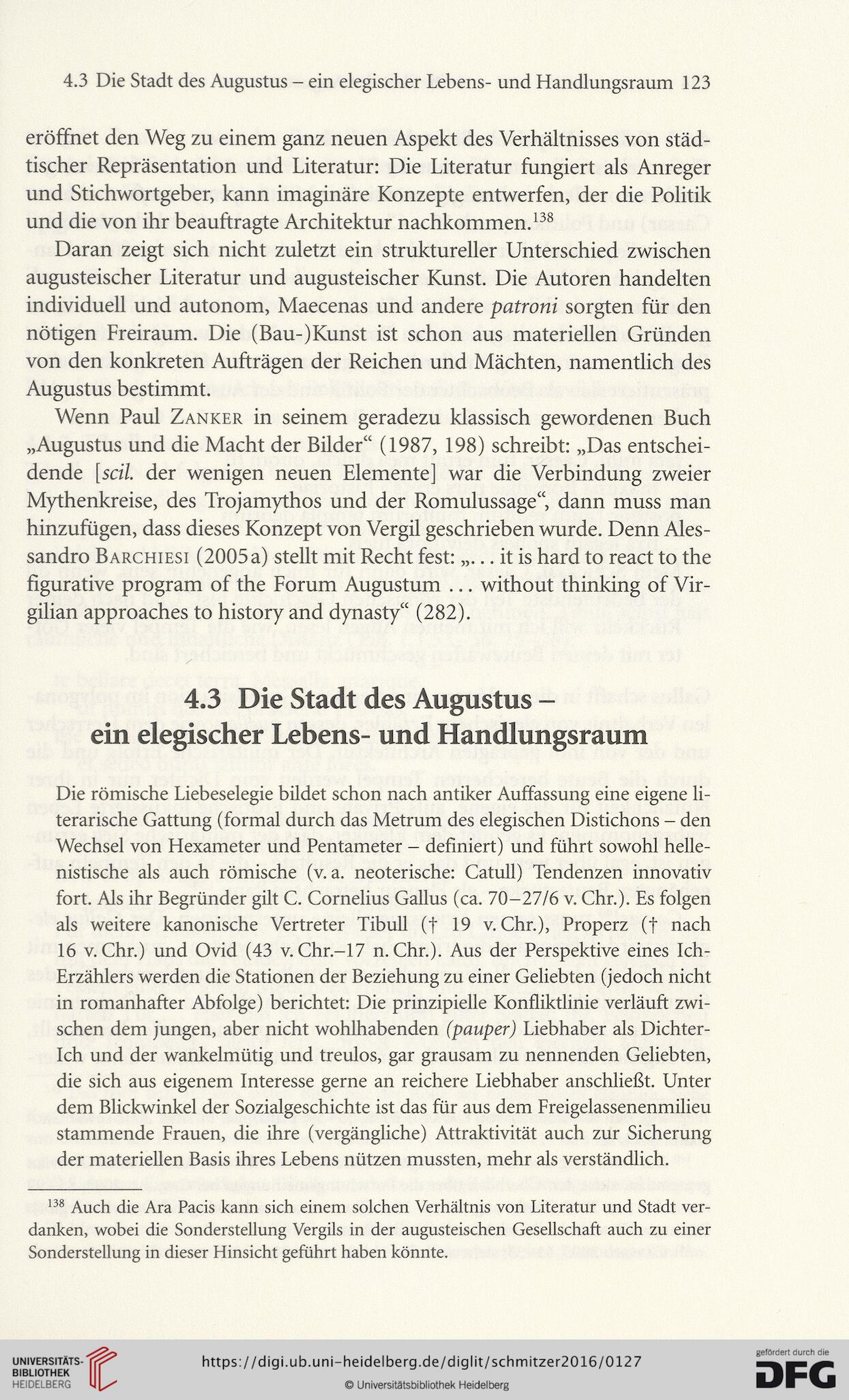4.3 Die Stadt des Augustus - ein elegischer Lebens- und Handlungsraum 123
eröffnet den Weg zu einem ganz neuen Aspekt des Verhältnisses von städ-
tischer Repräsentation und Literatur: Die Literatur fungiert als Anreger
und Stichwortgeber, kann imaginäre Konzepte entwerfen, der die Politik
und die von ihr beauftragte Architektur nachkommen.138
Daran zeigt sich nicht zuletzt ein struktureller Unterschied zwischen
augusteischer Literatur und augusteischer Kunst. Die Autoren handelten
individuell und autonom, Maecenas und andere patroni sorgten für den
nötigen Freiraum. Die (Bau-)Kunst ist schon aus materiellen Gründen
von den konkreten Aufträgen der Reichen und Mächten, namentlich des
Augustus bestimmt.
Wenn Paul Zänker in seinem geradezu klassisch gewordenen Buch
„Augustus und die Macht der Bilder" (1987, 198) schreibt: „Das entschei-
dende [seil, der wenigen neuen Elemente] war die Verbindung zweier
Mythenkreise, des Trojamythos und der Romulussage", dann muss man
hinzufügen, dass dieses Konzept von Vergil geschrieben wurde. Denn Ales-
sandro Barchiesi (2005a) stellt mit Recht fest: „.. . it is hard to react to the
figurative program of the Forum Augustum... without thinking of Vir-
gilian approaches to history and dynasty" (282).
4.3 Die Stadt des Augustus -
ein elegischer Lebens- und Handlungsraum
Die römische Liebeselegie bildet schon nach antiker Auffassung eine eigene li-
terarische Gattung (formal durch das Metrum des elegischen Distichons - den
Wechsel von Hexameter und Pentameter - definiert) und führt sowohl helle-
nistische als auch römische (v. a. neoterische: Catull) Tendenzen innovativ
fort. Als ihr Begründer gilt C. Cornelius Gallus (ca. 70-27/6 v. Chr.). Es folgen
als weitere kanonische Vertreter Tibull (t 19 v. Chr.), Properz (t nach
16 v. Chr.) und Ovid (43 v. Chr.-17 n. Chr.). Aus der Perspektive eines Ich-
Erzählers werden die Stationen der Beziehung zu einer Geliebten (jedoch nicht
in romanhafter Abfolge) berichtet: Die prinzipielle Konfliktlinie verläuft zwi-
schen dem jungen, aber nicht wohlhabenden (pauper) Liebhaber als Dichter-
Ich und der wankelmütig und treulos, gar grausam zu nennenden Geliebten,
die sich aus eigenem Interesse gerne an reichere Liebhaber anschließt. Unter
dem Blickwinkel der Sozialgeschichte ist das für aus dem Freigelassenenmilieu
stammende Frauen, die ihre (vergängliche) Attraktivität auch zur Sicherung
der materiellen Basis ihres Lebens nützen mussten, mehr als verständlich.
138 Auch die Ara Pacis kann sich einem solchen Verhältnis von Literatur und Stadt ver-
danken, wobei die Sonderstellung Vergils in der augusteischen Gesellschaft auch zu einer
Sonderstellung in dieser Hinsicht geführt haben könnte.
eröffnet den Weg zu einem ganz neuen Aspekt des Verhältnisses von städ-
tischer Repräsentation und Literatur: Die Literatur fungiert als Anreger
und Stichwortgeber, kann imaginäre Konzepte entwerfen, der die Politik
und die von ihr beauftragte Architektur nachkommen.138
Daran zeigt sich nicht zuletzt ein struktureller Unterschied zwischen
augusteischer Literatur und augusteischer Kunst. Die Autoren handelten
individuell und autonom, Maecenas und andere patroni sorgten für den
nötigen Freiraum. Die (Bau-)Kunst ist schon aus materiellen Gründen
von den konkreten Aufträgen der Reichen und Mächten, namentlich des
Augustus bestimmt.
Wenn Paul Zänker in seinem geradezu klassisch gewordenen Buch
„Augustus und die Macht der Bilder" (1987, 198) schreibt: „Das entschei-
dende [seil, der wenigen neuen Elemente] war die Verbindung zweier
Mythenkreise, des Trojamythos und der Romulussage", dann muss man
hinzufügen, dass dieses Konzept von Vergil geschrieben wurde. Denn Ales-
sandro Barchiesi (2005a) stellt mit Recht fest: „.. . it is hard to react to the
figurative program of the Forum Augustum... without thinking of Vir-
gilian approaches to history and dynasty" (282).
4.3 Die Stadt des Augustus -
ein elegischer Lebens- und Handlungsraum
Die römische Liebeselegie bildet schon nach antiker Auffassung eine eigene li-
terarische Gattung (formal durch das Metrum des elegischen Distichons - den
Wechsel von Hexameter und Pentameter - definiert) und führt sowohl helle-
nistische als auch römische (v. a. neoterische: Catull) Tendenzen innovativ
fort. Als ihr Begründer gilt C. Cornelius Gallus (ca. 70-27/6 v. Chr.). Es folgen
als weitere kanonische Vertreter Tibull (t 19 v. Chr.), Properz (t nach
16 v. Chr.) und Ovid (43 v. Chr.-17 n. Chr.). Aus der Perspektive eines Ich-
Erzählers werden die Stationen der Beziehung zu einer Geliebten (jedoch nicht
in romanhafter Abfolge) berichtet: Die prinzipielle Konfliktlinie verläuft zwi-
schen dem jungen, aber nicht wohlhabenden (pauper) Liebhaber als Dichter-
Ich und der wankelmütig und treulos, gar grausam zu nennenden Geliebten,
die sich aus eigenem Interesse gerne an reichere Liebhaber anschließt. Unter
dem Blickwinkel der Sozialgeschichte ist das für aus dem Freigelassenenmilieu
stammende Frauen, die ihre (vergängliche) Attraktivität auch zur Sicherung
der materiellen Basis ihres Lebens nützen mussten, mehr als verständlich.
138 Auch die Ara Pacis kann sich einem solchen Verhältnis von Literatur und Stadt ver-
danken, wobei die Sonderstellung Vergils in der augusteischen Gesellschaft auch zu einer
Sonderstellung in dieser Hinsicht geführt haben könnte.