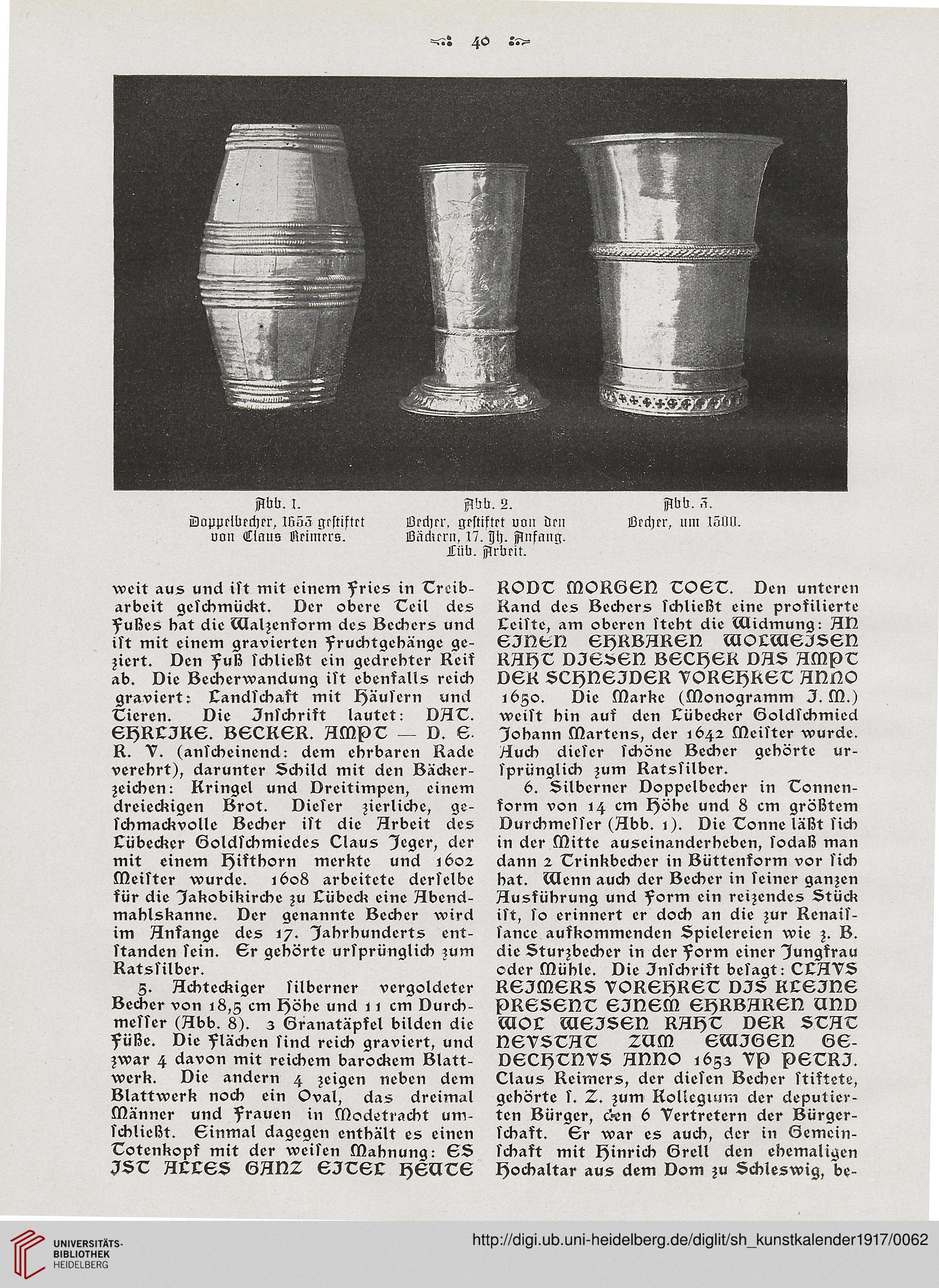jflbb. I. ftlib. 2. fftbb. 3.
iQapprlürdjrr, 1B53 grftiftrt iDrtljrr, grftiftrt uon Dm ißrdjrr, um 150U.
uon Claus Wrimrra. ßämmi, 17. Iflj. fnifnutr.
JEiib. jprbrit.
weit aus und iTt mit einem frtes in Treib-
arbeit gefebmückt. Der obere Teil des
f ußes bat die CHaljenform des Bechers und
ift mit einem gravierten f ruebtgebänge ge-
giert. Den fuß Tcbließt ein gedrehter Reif
ab. Die Becherwandung iTt ebenfalls reich
graviert: CandTcbaft mit Käufern und
Tieren. Die JnTchrift lautet: DHC.
e^ROKe. BecneR. hmpt — d. e.
R. V. (anfebeinend: dem ehrbaren Rade
verehrt), darunter Schild mit den Bäcker-
reichen: Kringel und Dreitimpen, einem
dreieckigen Brot. DieTer nerlicbe, ge-
fcbmachvolle Becher ift die Hrbeit des
Cübecker Goldfcbmiedes Claus Jeger, der
mit einem I)iftborn merkte und 1602
Metfter wurde. 1608 arbeitete derfelbe
für die Jakobikircbe ju Cübeck eine Hbend-
mablshanne. Der genannte Becher wird
im Hnfange des 17. Jahrhunderts ent-
ftanden fein. 6r gehörte urfprünglicb jiim
RatsNlber.
5. Hcbtechiger filberner vergoldeter
Becher von 18,5 cm I)öbe und 11 cm Durch-
meffer (Hbb. 8). 3 Granatäpfel bilden die
füße. Die flächen find reich graviert, und
jwar 4 davon mit reichem barockem Blatt-
werk. Die andern 4 jeigen neben dem
Blattwerk noch ein Oval, das dreimal
Männer und frauen in Modetracbt um-
fcblicßt. Ginmal dagegen enthält es einen
Totenhopf mit der weifen Mahnung: 6S
jst Hcces 6HD2 ejcec F>euze
RODT M0R66D T06T. Den unteren
Rand des Bechers fcbließt eine profilierte
CciTte, am oberen ftebt die Widmung: HI2
ejnen ei>RBHRen vaozvaezsen
rhi>t Djesen BecneR dhs hmpt
D6R sci>neJDeR vorgibt anno
1650. Die Marke (Sonogramm 3. M.)
weift bin auf den Cübecker 6oldfcbmicd
Johann Martens, der 1642 MeiTter wurde.
Hucb diefer feböne Becher gehörte ur-
fprünglich jum Ratsfilber.
6. Silberner Doppelbecber in Tonnen-
form von 14 cm I)öhe und 8 cm größtem
Durcbmcffer (Hbb. 1). Die Tonne läßt fich
in der Mitte auseinanderbeben, fodaß man
dann 2 Trinkbecher in Büttenform vor Neb
bat. IQenn auch der Becher in feiner ganjen
Husfübrung und form ein reifendes Stück
ift, fo erinnert er doch an die jur Renaif-
Tance aufkommenden Spielereien wie 5. B.
die Sturjbecber in der form einer Jungfrau
oder Mühle. Die Jnfcbrift befagt: CCHVS
rgjmgrs voRei>ReT djs Kcejne
PReseDT ejneM ei^RBHRen anD
cüoc caejsen rhi>t dbr stht
nevsTHT zum emjeen ee-
Deci)TnTS Hnno 1653 vp pgtrj.
Claus Reimers, der diefen Becher ftiftete,
gehörte f. Z, jum Kollegium der deputier-
ten Bürger, ckn 6 Vertretern der Bürger-
febaft. 6r war es auch, der in Gemcin-
febaft mit I)inricb Grell den ehemaligen
Hochaltar aus dem Dom ju Schleswig, be-
iQapprlürdjrr, 1B53 grftiftrt iDrtljrr, grftiftrt uon Dm ißrdjrr, um 150U.
uon Claus Wrimrra. ßämmi, 17. Iflj. fnifnutr.
JEiib. jprbrit.
weit aus und iTt mit einem frtes in Treib-
arbeit gefebmückt. Der obere Teil des
f ußes bat die CHaljenform des Bechers und
ift mit einem gravierten f ruebtgebänge ge-
giert. Den fuß Tcbließt ein gedrehter Reif
ab. Die Becherwandung iTt ebenfalls reich
graviert: CandTcbaft mit Käufern und
Tieren. Die JnTchrift lautet: DHC.
e^ROKe. BecneR. hmpt — d. e.
R. V. (anfebeinend: dem ehrbaren Rade
verehrt), darunter Schild mit den Bäcker-
reichen: Kringel und Dreitimpen, einem
dreieckigen Brot. DieTer nerlicbe, ge-
fcbmachvolle Becher ift die Hrbeit des
Cübecker Goldfcbmiedes Claus Jeger, der
mit einem I)iftborn merkte und 1602
Metfter wurde. 1608 arbeitete derfelbe
für die Jakobikircbe ju Cübeck eine Hbend-
mablshanne. Der genannte Becher wird
im Hnfange des 17. Jahrhunderts ent-
ftanden fein. 6r gehörte urfprünglicb jiim
RatsNlber.
5. Hcbtechiger filberner vergoldeter
Becher von 18,5 cm I)öbe und 11 cm Durch-
meffer (Hbb. 8). 3 Granatäpfel bilden die
füße. Die flächen find reich graviert, und
jwar 4 davon mit reichem barockem Blatt-
werk. Die andern 4 jeigen neben dem
Blattwerk noch ein Oval, das dreimal
Männer und frauen in Modetracbt um-
fcblicßt. Ginmal dagegen enthält es einen
Totenhopf mit der weifen Mahnung: 6S
jst Hcces 6HD2 ejcec F>euze
RODT M0R66D T06T. Den unteren
Rand des Bechers fcbließt eine profilierte
CciTte, am oberen ftebt die Widmung: HI2
ejnen ei>RBHRen vaozvaezsen
rhi>t Djesen BecneR dhs hmpt
D6R sci>neJDeR vorgibt anno
1650. Die Marke (Sonogramm 3. M.)
weift bin auf den Cübecker 6oldfcbmicd
Johann Martens, der 1642 MeiTter wurde.
Hucb diefer feböne Becher gehörte ur-
fprünglich jum Ratsfilber.
6. Silberner Doppelbecber in Tonnen-
form von 14 cm I)öhe und 8 cm größtem
Durcbmcffer (Hbb. 1). Die Tonne läßt fich
in der Mitte auseinanderbeben, fodaß man
dann 2 Trinkbecher in Büttenform vor Neb
bat. IQenn auch der Becher in feiner ganjen
Husfübrung und form ein reifendes Stück
ift, fo erinnert er doch an die jur Renaif-
Tance aufkommenden Spielereien wie 5. B.
die Sturjbecber in der form einer Jungfrau
oder Mühle. Die Jnfcbrift befagt: CCHVS
rgjmgrs voRei>ReT djs Kcejne
PReseDT ejneM ei^RBHRen anD
cüoc caejsen rhi>t dbr stht
nevsTHT zum emjeen ee-
Deci)TnTS Hnno 1653 vp pgtrj.
Claus Reimers, der diefen Becher ftiftete,
gehörte f. Z, jum Kollegium der deputier-
ten Bürger, ckn 6 Vertretern der Bürger-
febaft. 6r war es auch, der in Gemcin-
febaft mit I)inricb Grell den ehemaligen
Hochaltar aus dem Dom ju Schleswig, be-