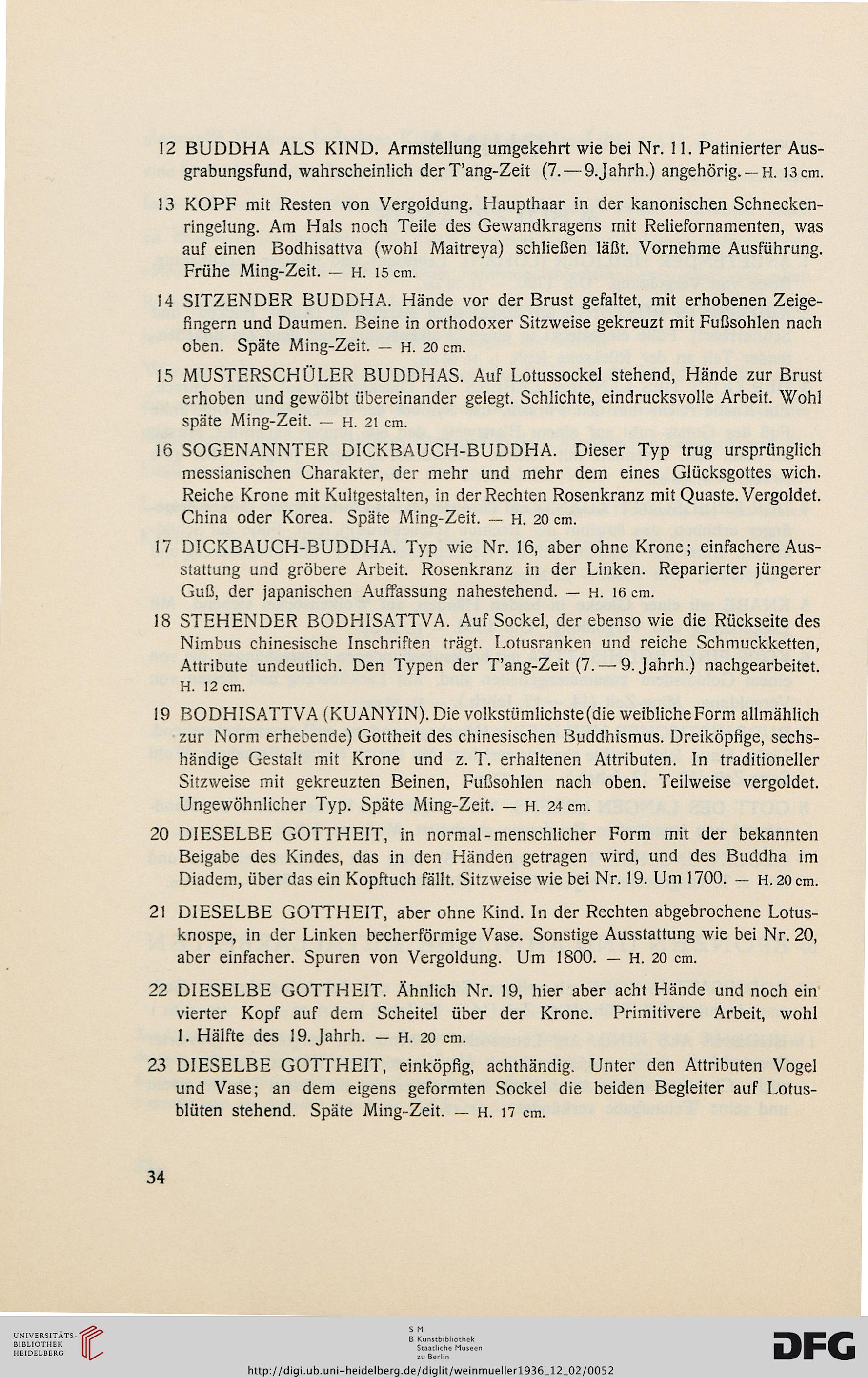12 BUDDHA ALS KIND. Armstellung umgekehrt wie bei Nr. 11. Patinierter Aus-
grabungsfund, wahrscheinlich der T'ang-Zeit (7. — 9.Jahrh.) angehörig. — h. 13 cm.
13 KOPF mit Resten von Vergoldung. Haupthaar in der kanonischen Schnecken-
ringelung. Am Hals noch Teile des Gewandkragens mit Reliefornamenten, was
auf einen Bodhisattva (wohl Maitreya) schließen läßt. Vornehme Ausführung.
Frühe Ming-Zeit. — h. 15 cm.
14 SITZENDER BUDDHA. Hände vor der Brust gefaltet, mit erhobenen Zeige-
fingern und Daumen. Beine in orthodoxer Sitzweise gekreuzt mit Fußsohlen nach
oben. Späte Ming-Zeit. — h. 20 cm.
15 MUSTERSCHÜLER BUDDHAS. Auf Lotussockel stehend, Hände zur Brust
erhoben und gewölbt übereinander gelegt. Schlichte, eindrucksvolle Arbeit. Wohl
späte Ming-Zeit. — h. 21 cm.
16 SOGENANNTER DICKBAUCH-BUDDHA. Dieser Typ trug ursprünglich
messianischen Charakter, der mehr und mehr dem eines Glücksgottes wich.
Reiche Krone mit Kultgestalten, in der Rechten Rosenkranz mit Quaste. Vergoldet.
China oder Korea. Späte Ming-Zeit. — h. 20 cm.
17 DICKBAUCH-BUDDHA. Typ wie Nr. 16, aber ohne Krone; einfachere Aus-
stattung und gröbere Arbeit. Rosenkranz in der Linken. Reparierter jüngerer
Guß, der japanischen Auffassung nahestehend. — h. 16 cm.
18 STEHENDER BODHISATTVA. Auf Sockel, der ebenso wie die Rückseite des
Nimbus chinesische Inschriften trägt. Lotusranken und reiche Schmuckketten,
Attribute undeutlich. Den Typen der T'ang-Zeit (7.-9. Jahrh.) nachgearbeitet.
H. 12 cm.
19 BODHISATTVA (KUANYIN). Die volkstümlichste (die weibliche Form allmählich
zur Norm erhebende) Gottheit des chinesischen Buddhismus. Dreiköpfige, sechs-
händige Gestalt mit Krone und z. T. erhaltenen Attributen. In traditioneller
Sitzweise mit gekreuzten Beinen, Fußsohlen nach oben. Teilweise vergoldet.
Ungewöhnlicher Typ. Späte Ming-Zeit. — h. 24 cm.
20 DIESELBE GOTTHEIT, in normal-menschlicher Form mit der bekannten
Beigabe des Kindes, das in den Händen getragen wird, und des Buddha im
Diadem, über das ein Kopftuch fällt. Sitzweise wie bei Nr. 19. Um 1700. — h. 20 cm.
21 DIESELBE GOTTHEIT, aber ohne Kind. In der Rechten abgebrochene Lotus-
knospe, in der Linken becherförmige Vase. Sonstige Ausstattung wie bei Nr. 20,
aber einfacher. Spuren von Vergoldung. Um 1800. — h. 20 cm.
22 DIESELBE GOTTHEIT. Ähnlich Nr. 19, hier aber acht Hände und noch ein
vierter Kopf auf dem Scheitel über der Krone. Primitivere Arbeit, wohl
I. Hälfte des 19. Jahrh. — h. 20 cm.
23 DIESELBE GOTTHEIT, einköpfig, achthändig. Unter den Attributen Vogel
und Vase; an dem eigens geformten Sockel die beiden Begleiter auf Lotus-
blüten stehend. Späte Ming-Zeit. — h. 17 cm.
34
grabungsfund, wahrscheinlich der T'ang-Zeit (7. — 9.Jahrh.) angehörig. — h. 13 cm.
13 KOPF mit Resten von Vergoldung. Haupthaar in der kanonischen Schnecken-
ringelung. Am Hals noch Teile des Gewandkragens mit Reliefornamenten, was
auf einen Bodhisattva (wohl Maitreya) schließen läßt. Vornehme Ausführung.
Frühe Ming-Zeit. — h. 15 cm.
14 SITZENDER BUDDHA. Hände vor der Brust gefaltet, mit erhobenen Zeige-
fingern und Daumen. Beine in orthodoxer Sitzweise gekreuzt mit Fußsohlen nach
oben. Späte Ming-Zeit. — h. 20 cm.
15 MUSTERSCHÜLER BUDDHAS. Auf Lotussockel stehend, Hände zur Brust
erhoben und gewölbt übereinander gelegt. Schlichte, eindrucksvolle Arbeit. Wohl
späte Ming-Zeit. — h. 21 cm.
16 SOGENANNTER DICKBAUCH-BUDDHA. Dieser Typ trug ursprünglich
messianischen Charakter, der mehr und mehr dem eines Glücksgottes wich.
Reiche Krone mit Kultgestalten, in der Rechten Rosenkranz mit Quaste. Vergoldet.
China oder Korea. Späte Ming-Zeit. — h. 20 cm.
17 DICKBAUCH-BUDDHA. Typ wie Nr. 16, aber ohne Krone; einfachere Aus-
stattung und gröbere Arbeit. Rosenkranz in der Linken. Reparierter jüngerer
Guß, der japanischen Auffassung nahestehend. — h. 16 cm.
18 STEHENDER BODHISATTVA. Auf Sockel, der ebenso wie die Rückseite des
Nimbus chinesische Inschriften trägt. Lotusranken und reiche Schmuckketten,
Attribute undeutlich. Den Typen der T'ang-Zeit (7.-9. Jahrh.) nachgearbeitet.
H. 12 cm.
19 BODHISATTVA (KUANYIN). Die volkstümlichste (die weibliche Form allmählich
zur Norm erhebende) Gottheit des chinesischen Buddhismus. Dreiköpfige, sechs-
händige Gestalt mit Krone und z. T. erhaltenen Attributen. In traditioneller
Sitzweise mit gekreuzten Beinen, Fußsohlen nach oben. Teilweise vergoldet.
Ungewöhnlicher Typ. Späte Ming-Zeit. — h. 24 cm.
20 DIESELBE GOTTHEIT, in normal-menschlicher Form mit der bekannten
Beigabe des Kindes, das in den Händen getragen wird, und des Buddha im
Diadem, über das ein Kopftuch fällt. Sitzweise wie bei Nr. 19. Um 1700. — h. 20 cm.
21 DIESELBE GOTTHEIT, aber ohne Kind. In der Rechten abgebrochene Lotus-
knospe, in der Linken becherförmige Vase. Sonstige Ausstattung wie bei Nr. 20,
aber einfacher. Spuren von Vergoldung. Um 1800. — h. 20 cm.
22 DIESELBE GOTTHEIT. Ähnlich Nr. 19, hier aber acht Hände und noch ein
vierter Kopf auf dem Scheitel über der Krone. Primitivere Arbeit, wohl
I. Hälfte des 19. Jahrh. — h. 20 cm.
23 DIESELBE GOTTHEIT, einköpfig, achthändig. Unter den Attributen Vogel
und Vase; an dem eigens geformten Sockel die beiden Begleiter auf Lotus-
blüten stehend. Späte Ming-Zeit. — h. 17 cm.
34