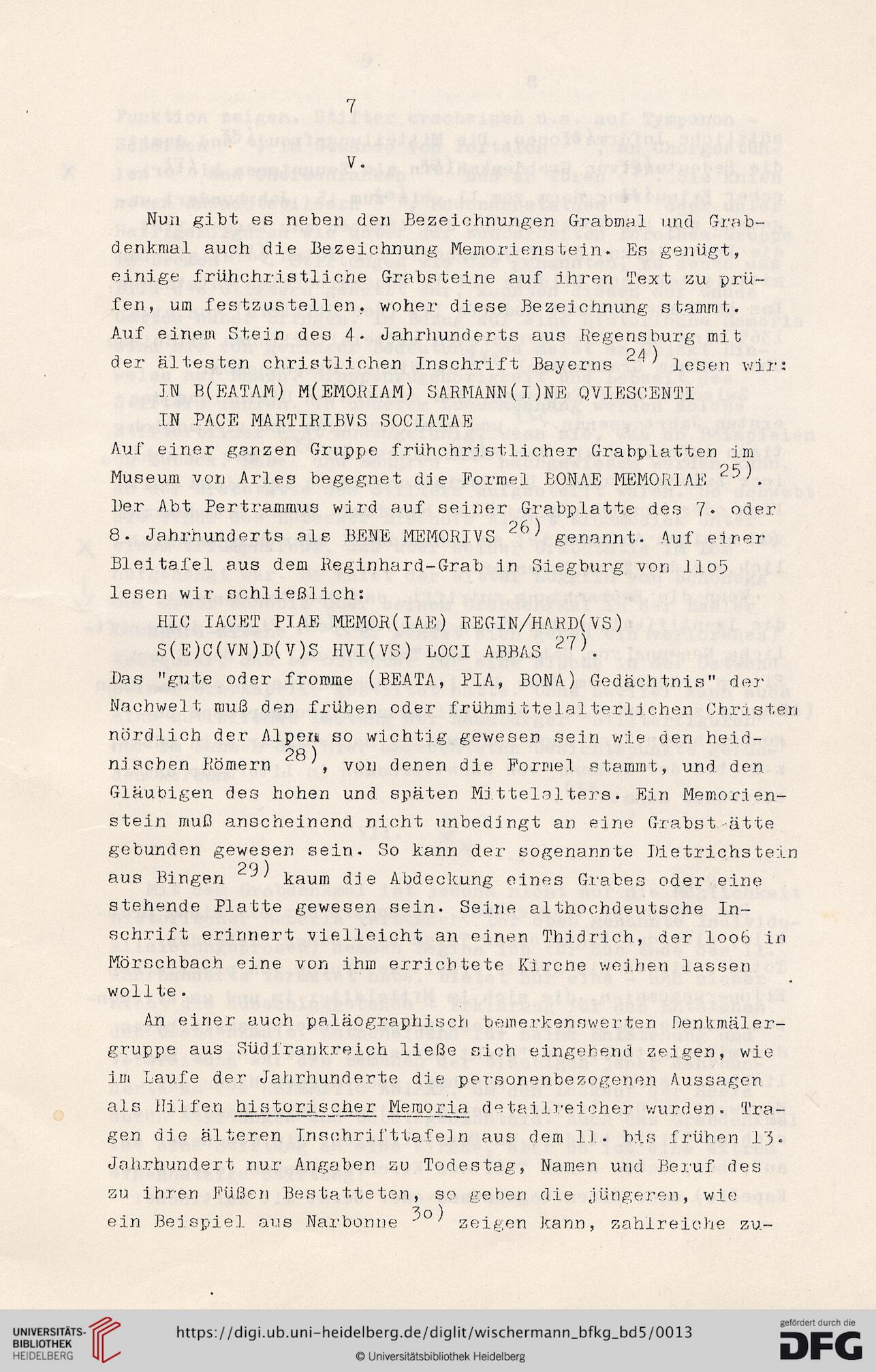7
V.
Nun gibt es neben den Bezeichnungen Grabmal und Grab-
denkmal auch die Bezeichnung Memorienstein. Es genügt,
einige frühchristliche Grabsteine auf ihren Text zu prü-
fen, um festzustellen, woher diese Bezeichnung stammt.
Auf einem Stein des 4- Jahrhunderts aus Regensburg mit
24 )
der- ältesten christlichen Inschrift Bayerns ' lesen wir:
IN B(EATAM) M(EMORIAM) SARMANN(T)NE QVIESCENTI
IN PACE MARTIRIBVS SOCIATAE
Auf einer ganzen Gruppe frühchristlicher Grabplatten im
25 )
Museuni von Arles begegnet die Formel EONAE MEM0R1AE ' .
Der Abt Pertrammus wird auf seiner Grabplatte des 7- oder
8. Jahrhunderts als BENE MEMORIVS 2ogenannt. Auf einer
Blei täfel aus dem Reginhard-Grab in Siegburg von 11 o5
lesen wir schließlich:
HIC IACET PIAE MEMOR(IAE) REGIN/HARD( VS)
S(E)C(VN)D(V)S HVl(VS) LOCI ABBAS 27^.
Das "gute oder fromme (BEATA, PIA, BONA) Gedächtnis" der
Nachwelt muß den frühen oder frühmittelalterlichen Christen
nördlich der Alpen so wichtig gewesen sein wie den heid-
Oß \
nischen Römern ‘ , von denen die Formel stammt, und den
Gläubigen des hohen und späten Mittelalters. Ein Memorien-
stein muß anscheinend nicht unbedingt an eine Gräbst ätte
gebunden gewesen sein. So kann der sogenannte Dietrichstein
29 )
aus Bingen kaum die Abdeckung eines Grabes oder eine
stehende Platte gewesen sein. Seine althochdeutsche In-
schrift erinnert vielleicht an einen Thidrich, der loo6 in
Mörschbach eine von ihm errichtete Kirche weihen lassen
wollte.
An einer auch paläographisch bemerkenswerten Denkmäler-
gruppe aus Südfrankreich ließe sich eingehend zeigen, wie
im Laufe der Jahrhunderte die personenbezogenen Aussagen
als Hilfen historischer Memoria detailreicher wurden. Tra-
gen die älteren Inschrifttafeln aus dem 11. bis frühen 13-
Jahrhundert nur Angaben zu Todestag, Namen und Beruf des
zu ihren Füßen Bestatteten, so geben die jüngeren, wie
3o )
ein Beispiel aus Narbonne ' zeigen kann, zahlreiche zu-
V.
Nun gibt es neben den Bezeichnungen Grabmal und Grab-
denkmal auch die Bezeichnung Memorienstein. Es genügt,
einige frühchristliche Grabsteine auf ihren Text zu prü-
fen, um festzustellen, woher diese Bezeichnung stammt.
Auf einem Stein des 4- Jahrhunderts aus Regensburg mit
24 )
der- ältesten christlichen Inschrift Bayerns ' lesen wir:
IN B(EATAM) M(EMORIAM) SARMANN(T)NE QVIESCENTI
IN PACE MARTIRIBVS SOCIATAE
Auf einer ganzen Gruppe frühchristlicher Grabplatten im
25 )
Museuni von Arles begegnet die Formel EONAE MEM0R1AE ' .
Der Abt Pertrammus wird auf seiner Grabplatte des 7- oder
8. Jahrhunderts als BENE MEMORIVS 2ogenannt. Auf einer
Blei täfel aus dem Reginhard-Grab in Siegburg von 11 o5
lesen wir schließlich:
HIC IACET PIAE MEMOR(IAE) REGIN/HARD( VS)
S(E)C(VN)D(V)S HVl(VS) LOCI ABBAS 27^.
Das "gute oder fromme (BEATA, PIA, BONA) Gedächtnis" der
Nachwelt muß den frühen oder frühmittelalterlichen Christen
nördlich der Alpen so wichtig gewesen sein wie den heid-
Oß \
nischen Römern ‘ , von denen die Formel stammt, und den
Gläubigen des hohen und späten Mittelalters. Ein Memorien-
stein muß anscheinend nicht unbedingt an eine Gräbst ätte
gebunden gewesen sein. So kann der sogenannte Dietrichstein
29 )
aus Bingen kaum die Abdeckung eines Grabes oder eine
stehende Platte gewesen sein. Seine althochdeutsche In-
schrift erinnert vielleicht an einen Thidrich, der loo6 in
Mörschbach eine von ihm errichtete Kirche weihen lassen
wollte.
An einer auch paläographisch bemerkenswerten Denkmäler-
gruppe aus Südfrankreich ließe sich eingehend zeigen, wie
im Laufe der Jahrhunderte die personenbezogenen Aussagen
als Hilfen historischer Memoria detailreicher wurden. Tra-
gen die älteren Inschrifttafeln aus dem 11. bis frühen 13-
Jahrhundert nur Angaben zu Todestag, Namen und Beruf des
zu ihren Füßen Bestatteten, so geben die jüngeren, wie
3o )
ein Beispiel aus Narbonne ' zeigen kann, zahlreiche zu-