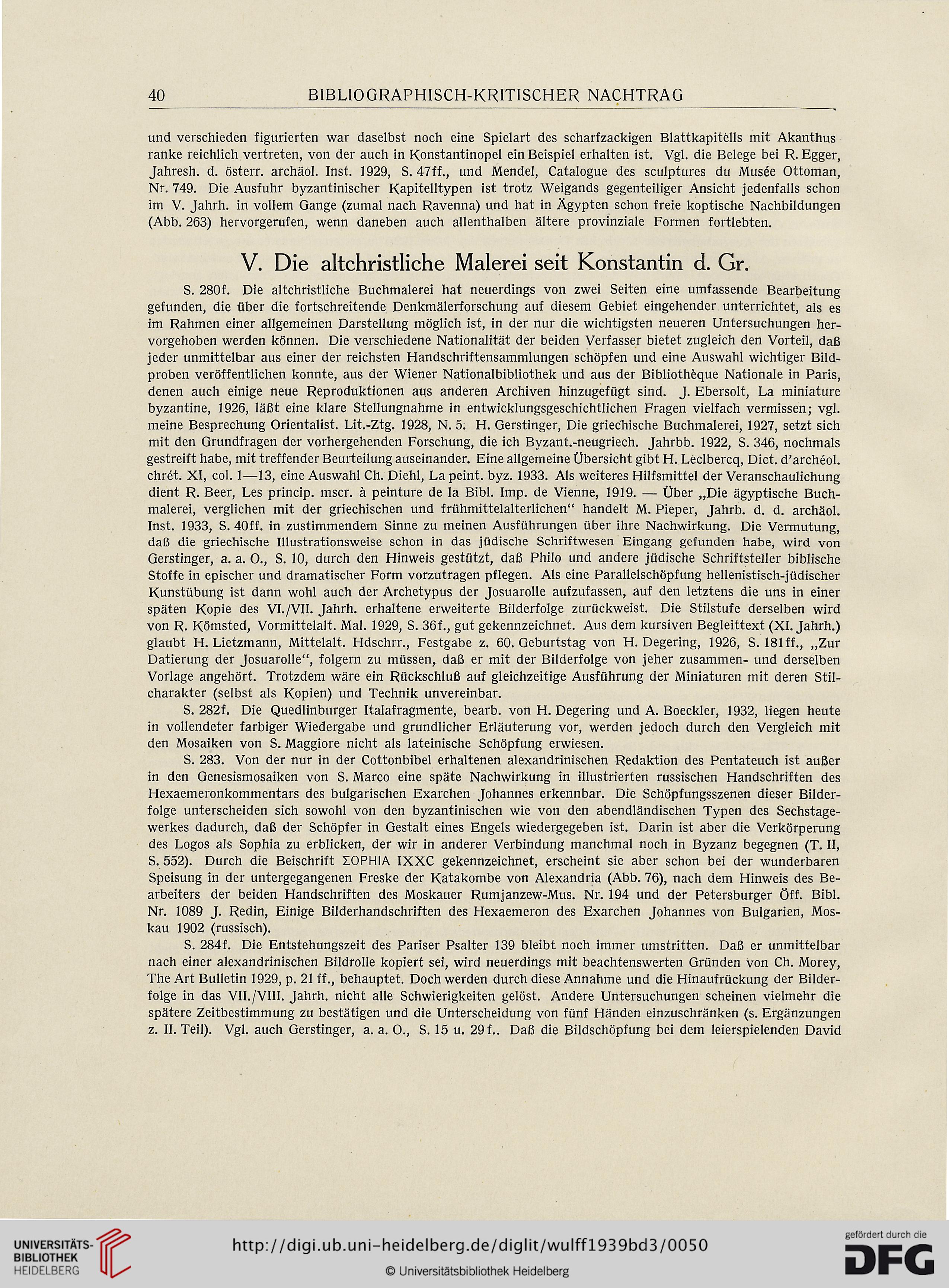40
BIBLIOGRAPHISCH-KRITISCHER NACHTRAG
und verschieden figurierten war daselbst noch eine Spielart des scharfzackigen Blattkapitells mit Akanthus
ranke reichlich vertreten, von der auch in Konstantinopel ein Beispiel erhalten ist. Vgl. die Belege bei R. Egger,
Jahresh. d. österr. archäol. Inst. 1929, S. 47ff., und Mendel, Catalogue des sculptures du Musee Ottoman,
Nr. 749. Die Ausfuhr byzantinischer Kapitelltypen ist trotz Weigands gegenteiliger Ansicht jedenfalls schon
im V. Jahrh. in vollem Gange (zumal nach Ravenna) und hat in Ägypten schon freie koptische Nachbildungen
(Abb. 263) hervorgerufen, wenn daneben auch allenthalben ältere provinziale Formen fortlebten.
V. Die altchristliche Malerei seit Konstantin d. Gr.
S. 280f. Die altchristliche Buchmalerei hat neuerdings von zwei Seiten eine umfassende Bearbeitung
gefunden, die über die fortschreitende Denkmälerforschung auf diesem Gebiet eingehender unterrichtet, als es
im Rahmen einer allgemeinen Darstellung möglich ist, in der nur die wichtigsten neueren Untersuchungen her-
vorgehoben werden können. Die verschiedene Nationalität der beiden Verfasser bietet zugleich den Vorteil, daß
jeder unmittelbar aus einer der reichsten Handschriftensammlungen schöpfen und eine Auswahl wichtiger Bild-
proben veröffentlichen konnte, aus der Wiener Nationalbibliothek und aus der Bibliotheque Nationale in Paris,
denen auch einige neue Reproduktionen aus anderen Archiven hinzugefügt sind. J. Ebersolt, La miniature
byzantine, 1926, läßt eine klare Stellungnahme in entwicklungsgeschichtlichen Fragen vielfach vermissen; vgl.
meine Besprechung Orientalist. Lit.-Ztg. 1928, N. 5. H. Gerstinger, Die griechische Buchmalerei, 1927, setzt sich
mit den Grundfragen der vorhergehenden Forschung, die ich Byzant.-neugriech. Jahrbb. 1922, S. 346, nochmals
gestreift habe, mit treffender Beurteilung auseinander. Eine allgemeine Übersicht gibt H. Leclbercq, Dict. d’archeol.
ehret. XI, col. 1—13, eine Auswahl Ch. Diehl, La peint. byz. 1933. Als weiteres Hilfsmittel der Veranschaulichung
dient R. Beer, Les princip. rnscr. ä peinture de la Bibi. Imp. de Vienne, 1919. — Über „Die ägyptische Buch-
malerei, verglichen mit der griechischen und frühmittelalterlichen“ handelt M. Pieper, Jahrb. d. d. archäol.
Inst. 1933, S. 40ff. in zustimmendem Sinne zu meinen Ausführungen über ihre Nachwirkung. Die Vermutung,
daß die griechische Illustrationsweise schon in das jüdische Schriftwesen Eingang gefunden habe, wird von
Gerstinger, a. a. O., S. 10, durch den Hinweis gestützt, daß Philo und andere jüdische Schriftsteller biblische
Stoffe in epischer und dramatischer Form vorzutragen pflegen. Als eine Parallelschöpfung hellenistisch-jüdischer
Kunstübung ist dann wohl auch der Archetypus der Josuarolle aufzufassen, auf den letztens die uns in einer
späten Kopie des VI./VII. Jahrh. erhaltene erweiterte Bilderfolge zurückweist. Die Stilstufe derselben wird
von R. Kömsted, Vormittelalt. Mal. 1929, S. 36f., gut gekennzeichnet. Aus dem kursiven Begleittext (XI. Jahrh.)
glaubt H. Lietzmann, Mittelalt. Hdschrr., Festgabe z. 60. Geburtstag von H. Degering, 1926, S. 181 ff., „Zur
Datierung der Josuarolle“, folgern zu müssen, daß er mit der Bilderfolge von jeher zusammen- und derselben
Vorlage angehört. Trotzdem wäre ein Rückschluß auf gleichzeitige Ausführung der Miniaturen mit deren Stil-
charakter (selbst als Kopien) und Technik unvereinbar.
S. 282f. Die Quedlinburger Italafragmente, bearb. von H. Degering und A. Boeckler, 1932, liegen heute
in vollendeter farbiger Wiedergabe und gründlicher Erläuterung vor, werden jedoch durch den Vergleich mit
den Mosaiken von S. Maggiore nicht als lateinische Schöpfung erwiesen.
S. 283. Von der nur in der Cottonbibel erhaltenen alexandrinischen Redaktion des Pentateuch ist außer
in den Genesismosaiken von S. Marco eine späte Nachwirkung in illustrierten russischen Handschriften des
Hexaemeronkommentars des bulgarischen Exarchen Johannes erkennbar. Die Schöpfungsszenen dieser Bilder-
folge unterscheiden sich sowohl von den byzantinischen wie von den abendländischen Typen des Sechstage-
werkes dadurch, daß der Schöpfer in Gestalt eines Engels wiedergegeben ist. Darin ist aber die Verkörperung
des Logos als Sophia zu erblicken, der wir in anderer Verbindung manchmal noch in Byzanz begegnen (T. II,
S. 552). Durch die Beischrift IOPHIA IXXC gekennzeichnet, erscheint sie aber schon bei der wunderbaren
Speisung in der untergegangenen Freske der Katakombe von Alexandria (Abb. 76), nach dem Hinweis des Be-
arbeiters der beiden Handschriften des Moskauer Rumjanzew-Mus. Nr. 194 und der Petersburger Öff. Bibi.
Nr. 1089 J. Redin, Einige Bilderhandschriften des Hexaemeron des Exarchen Johannes von Bulgarien, Mos-
kau 1902 (russisch).
S. 284f. Die Entstehungszeit des Pariser Psalter 139 bleibt noch immer umstritten. Daß er unmittelbar
nach einer alexandrinischen Bildrolle kopiert sei, wird neuerdings mit beachtenswerten Gründen von Ch. Morey,
The Art Bulletin 1929, p. 21 ff., behauptet. Doch werden durch diese Annahme und die Hinaufrückung der Bilder-
folge in das VII./VIII. Jahrh. nicht alle Schwierigkeiten gelöst. Andere Untersuchungen scheinen vielmehr die
spätere Zeitbestimmung zu bestätigen und die Unterscheidung von fünf Händen einzuschränken (s. Ergänzungen
z. II. Teil). Vgl. auch Gerstinger, a. a. O., S. 15 u. 29 f.. Daß die Bildschöpfung bei dem leierspielenden David
BIBLIOGRAPHISCH-KRITISCHER NACHTRAG
und verschieden figurierten war daselbst noch eine Spielart des scharfzackigen Blattkapitells mit Akanthus
ranke reichlich vertreten, von der auch in Konstantinopel ein Beispiel erhalten ist. Vgl. die Belege bei R. Egger,
Jahresh. d. österr. archäol. Inst. 1929, S. 47ff., und Mendel, Catalogue des sculptures du Musee Ottoman,
Nr. 749. Die Ausfuhr byzantinischer Kapitelltypen ist trotz Weigands gegenteiliger Ansicht jedenfalls schon
im V. Jahrh. in vollem Gange (zumal nach Ravenna) und hat in Ägypten schon freie koptische Nachbildungen
(Abb. 263) hervorgerufen, wenn daneben auch allenthalben ältere provinziale Formen fortlebten.
V. Die altchristliche Malerei seit Konstantin d. Gr.
S. 280f. Die altchristliche Buchmalerei hat neuerdings von zwei Seiten eine umfassende Bearbeitung
gefunden, die über die fortschreitende Denkmälerforschung auf diesem Gebiet eingehender unterrichtet, als es
im Rahmen einer allgemeinen Darstellung möglich ist, in der nur die wichtigsten neueren Untersuchungen her-
vorgehoben werden können. Die verschiedene Nationalität der beiden Verfasser bietet zugleich den Vorteil, daß
jeder unmittelbar aus einer der reichsten Handschriftensammlungen schöpfen und eine Auswahl wichtiger Bild-
proben veröffentlichen konnte, aus der Wiener Nationalbibliothek und aus der Bibliotheque Nationale in Paris,
denen auch einige neue Reproduktionen aus anderen Archiven hinzugefügt sind. J. Ebersolt, La miniature
byzantine, 1926, läßt eine klare Stellungnahme in entwicklungsgeschichtlichen Fragen vielfach vermissen; vgl.
meine Besprechung Orientalist. Lit.-Ztg. 1928, N. 5. H. Gerstinger, Die griechische Buchmalerei, 1927, setzt sich
mit den Grundfragen der vorhergehenden Forschung, die ich Byzant.-neugriech. Jahrbb. 1922, S. 346, nochmals
gestreift habe, mit treffender Beurteilung auseinander. Eine allgemeine Übersicht gibt H. Leclbercq, Dict. d’archeol.
ehret. XI, col. 1—13, eine Auswahl Ch. Diehl, La peint. byz. 1933. Als weiteres Hilfsmittel der Veranschaulichung
dient R. Beer, Les princip. rnscr. ä peinture de la Bibi. Imp. de Vienne, 1919. — Über „Die ägyptische Buch-
malerei, verglichen mit der griechischen und frühmittelalterlichen“ handelt M. Pieper, Jahrb. d. d. archäol.
Inst. 1933, S. 40ff. in zustimmendem Sinne zu meinen Ausführungen über ihre Nachwirkung. Die Vermutung,
daß die griechische Illustrationsweise schon in das jüdische Schriftwesen Eingang gefunden habe, wird von
Gerstinger, a. a. O., S. 10, durch den Hinweis gestützt, daß Philo und andere jüdische Schriftsteller biblische
Stoffe in epischer und dramatischer Form vorzutragen pflegen. Als eine Parallelschöpfung hellenistisch-jüdischer
Kunstübung ist dann wohl auch der Archetypus der Josuarolle aufzufassen, auf den letztens die uns in einer
späten Kopie des VI./VII. Jahrh. erhaltene erweiterte Bilderfolge zurückweist. Die Stilstufe derselben wird
von R. Kömsted, Vormittelalt. Mal. 1929, S. 36f., gut gekennzeichnet. Aus dem kursiven Begleittext (XI. Jahrh.)
glaubt H. Lietzmann, Mittelalt. Hdschrr., Festgabe z. 60. Geburtstag von H. Degering, 1926, S. 181 ff., „Zur
Datierung der Josuarolle“, folgern zu müssen, daß er mit der Bilderfolge von jeher zusammen- und derselben
Vorlage angehört. Trotzdem wäre ein Rückschluß auf gleichzeitige Ausführung der Miniaturen mit deren Stil-
charakter (selbst als Kopien) und Technik unvereinbar.
S. 282f. Die Quedlinburger Italafragmente, bearb. von H. Degering und A. Boeckler, 1932, liegen heute
in vollendeter farbiger Wiedergabe und gründlicher Erläuterung vor, werden jedoch durch den Vergleich mit
den Mosaiken von S. Maggiore nicht als lateinische Schöpfung erwiesen.
S. 283. Von der nur in der Cottonbibel erhaltenen alexandrinischen Redaktion des Pentateuch ist außer
in den Genesismosaiken von S. Marco eine späte Nachwirkung in illustrierten russischen Handschriften des
Hexaemeronkommentars des bulgarischen Exarchen Johannes erkennbar. Die Schöpfungsszenen dieser Bilder-
folge unterscheiden sich sowohl von den byzantinischen wie von den abendländischen Typen des Sechstage-
werkes dadurch, daß der Schöpfer in Gestalt eines Engels wiedergegeben ist. Darin ist aber die Verkörperung
des Logos als Sophia zu erblicken, der wir in anderer Verbindung manchmal noch in Byzanz begegnen (T. II,
S. 552). Durch die Beischrift IOPHIA IXXC gekennzeichnet, erscheint sie aber schon bei der wunderbaren
Speisung in der untergegangenen Freske der Katakombe von Alexandria (Abb. 76), nach dem Hinweis des Be-
arbeiters der beiden Handschriften des Moskauer Rumjanzew-Mus. Nr. 194 und der Petersburger Öff. Bibi.
Nr. 1089 J. Redin, Einige Bilderhandschriften des Hexaemeron des Exarchen Johannes von Bulgarien, Mos-
kau 1902 (russisch).
S. 284f. Die Entstehungszeit des Pariser Psalter 139 bleibt noch immer umstritten. Daß er unmittelbar
nach einer alexandrinischen Bildrolle kopiert sei, wird neuerdings mit beachtenswerten Gründen von Ch. Morey,
The Art Bulletin 1929, p. 21 ff., behauptet. Doch werden durch diese Annahme und die Hinaufrückung der Bilder-
folge in das VII./VIII. Jahrh. nicht alle Schwierigkeiten gelöst. Andere Untersuchungen scheinen vielmehr die
spätere Zeitbestimmung zu bestätigen und die Unterscheidung von fünf Händen einzuschränken (s. Ergänzungen
z. II. Teil). Vgl. auch Gerstinger, a. a. O., S. 15 u. 29 f.. Daß die Bildschöpfung bei dem leierspielenden David