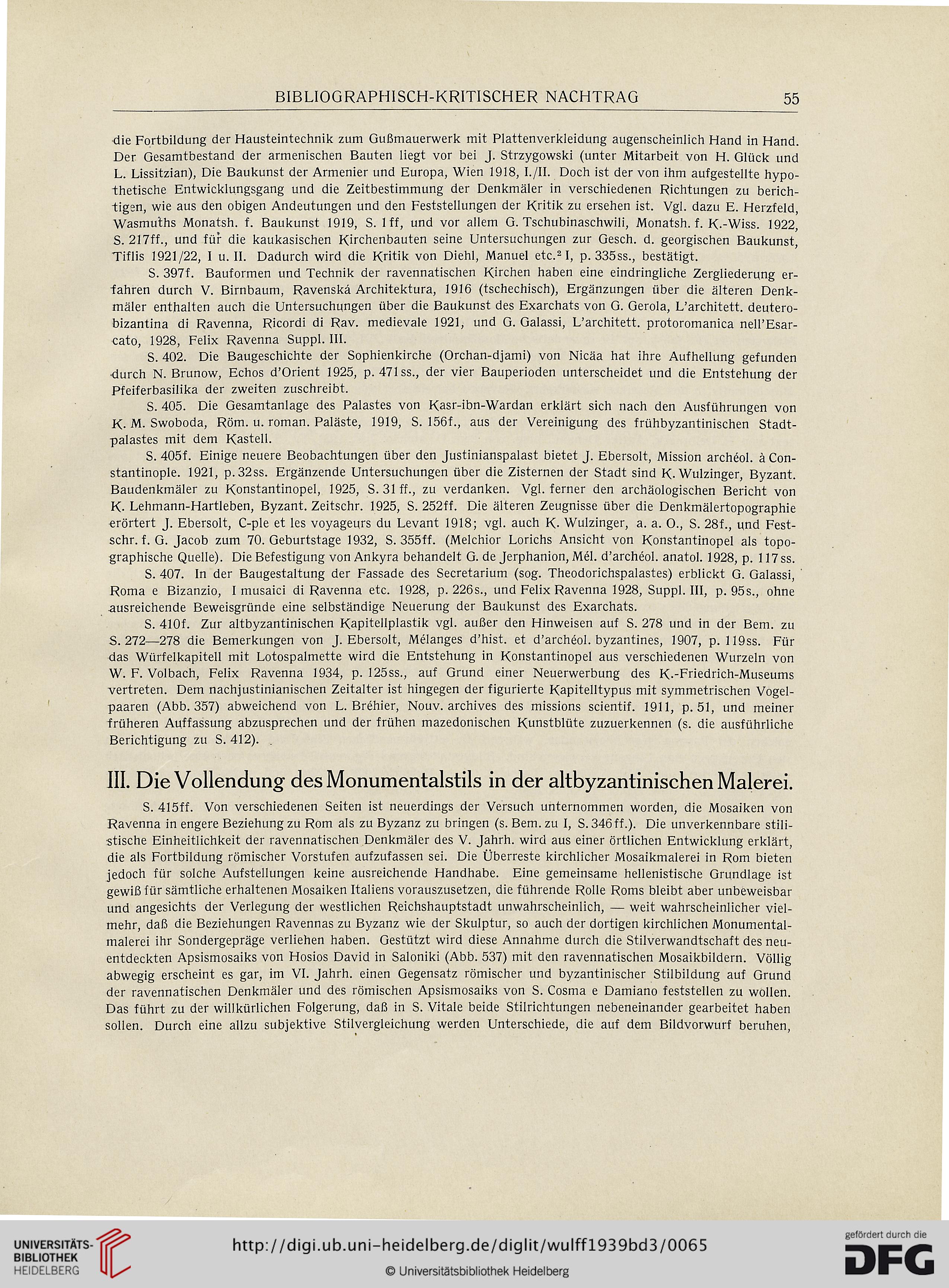BIBLIOGRAPHISCH-KRITISCHER NACHTRAG
55
die Fortbildung der Hausteintechnik zum Gußmauerwerk mit Plattenverkleidung augenscheinlich Hand in Hand.
Der Gesamtbestand der armenischen Bauten liegt vor bei J. Strzygowski (unter Mitarbeit von H. Glück und
L. Lissitzian), Die Baukunst der Armenier und Europa, Wien 1918, I./II. Doch ist der von ihm aufgestellte hypo-
thetische Entwicklungsgang und die Zeitbestimmung der Denkmäler in verschiedenen Richtungen zu berich-
tigen, wie aus den obigen Andeutungen und den Feststellungen der Kritik zu ersehen ist. Vgl. dazu E. Herzfeld,
Wasmuths Monatsh. f. Baukunst 1919, S. lff, und vor allem G. Tschubinaschwili, Monatsh. f. K--Wiss. 1922,
S. 217ff., und für die kaukasischen Kirchenbauten seine Untersuchungen zur Gesch. d. georgischen Baukunst,
Tiflis 1921/22, 1 u. II. Dadurch wird die Kritik von Diehl, Manuel etc.21, p. 335ss., bestätigt.
S. 397f. Bauformen und Technik der ravennatischen Kirchen haben eine eindringliche Zergliederung er-
fahren durch V. Birnbaum, Ravenskä Architektura, 1916 (tschechisch), Ergänzungen über die älteren Denk-
mäler enthalten auch die Untersuchungen über die Baukunst des Exarchats von G. Gerola, L’architett. deutero-
bizantina di Ravenna, Ricordi di Rav. medievaie 1921, und G. Galassi, L’architett. protoromanica nell’Esar-
cato, 1928, Felix Ravenna Suppl. III.
S. 402. Die Baugeschichte der Sophienkirche (Orchan-djami) von Nicäa hat ihre Aufhellung gefunden
durch N. Brunow, Echos d’Orient 1925, p. 471 ss., der vier Bauperioden unterscheidet und die Entstehung der
Pfeiferbasilika der zweiten zuschreibt.
S. 405. Die Gesamtanlage des Palastes von Kasr-ibn-Wardan erklärt sich nach den Ausführungen von
K. M. Swoboda, Rom. u. roman. Paläste, 1919, S. 156f., aus der Vereinigung des frühbyzantinischen Stadt-
palastes mit dem Kastell.
S. 405f. Einige neuere Beobachtungen über den Justinianspalast bietet J. Ebersolt, Mission archeol. ä Con-
stantinople. 1921, p.32ss. Ergänzende Untersuchungen über die Zisternen der Stadt sind K- Wulzinger, Byzant.
Baudenkmäler zu Konstantinopel, 1925, S. 31 ff., zu verdanken. Vgl. ferner den archäologischen Bericht von
K. Lehmann-Hartleben, Byzant. Zeitschr. 1925, S. 252ff. Die älteren Zeugnisse über die Denkmälertopographie
erörtert J. Ebersolt, C-ple et les voyageurs du Levant 1918; vgl. auch K- Wulzinger, a. a. O., S. 28L, und Fest-
schr. f. G. Jacob zum 70. Geburtstage 1932, S. 355ff. (Melchior Lorichs Ansicht von Konstantinopel als topo-
graphische Quelle). Die Befestigung von Ankyra behandelt G. de Jerphanion, Mel. d’archeol. anatol. 1928, p. 117 ss.
S. 407. In der Baugestaltung der Fassade des Secretarium (sog. Theodorichspalastes) erblickt G. Galassi,
Roma e Bizanzio, 1 musaici di Ravenna etc. 1928, p. 226s., und Felix Ravenna 1928, Suppl. III, p. 95s., ohne
ausreichende Beweisgründe eine selbständige Neuerung der Baukunst des Exarchats.
S. 410f. Zur altbyzantinischen Kapitellplastik vgl. außer den Hinweisen auf S. 278 und in der Bern, zu
S. 272—278 die Bemerkungen von J. Ebersolt, Melanges d’hist. et d’archeol. byzantines, 1907, p. 119ss. Für
das Würfelkapitell mit Lotospalmette wird die Entstehung in Konstantinopel aus verschiedenen Wurzeln von
W. F. Volbach, Felix Ravenna 1934, p. 125ss., auf Grund einer Neuerwerbung des K--Friedrich-Museums
vertreten. Dem nachjustinianischen Zeitalter ist hingegen der figurierte Kapitelltypus mit symmetrischen Vogel-
paaren (Abb. 357) abweichend von L. Brehier, Nouv. archives des missions scientif. 1911, p. 51, und meiner
früheren Auffassung abzusprechen und der frühen mazedonischen Kunstblüte zuzuerkennen (s. die ausführliche
Berichtigung zu S. 412). .
III. Die Vollendung des Monumentalstils in der altbyzantinischen Malerei.
S. 415ff. Von verschiedenen Seiten ist neuerdings der Versuch unternommen worden, die Mosaiken von
Ravenna in engere Beziehung zu Rom als zu Byzanz zu bringen (s. Bern, zu I, S. 346 ff.). Die unverkennbare stili-
stische Einheitlichkeit der ravennatischen Denkmäler des V. Jahrh. wird aus einer örtlichen Entwicklung erklärt,
die als Fortbildung römischer Vorstufen aufzufassen sei. Die Überreste kirchlicher Mosaikmalerei in Rom bieten
jedoch für solche Aufstellungen keine ausreichende Handhabe. Eine gemeinsame hellenistische Grundlage ist
gewiß für sämtliche erhaltenen Mosaiken Italiens vorauszusetzen, die führende Rolle Roms bleibt aber unbeweisbar
und angesichts der Verlegung der westlichen Reichshauptstadt unwahrscheinlich, — weit wahrscheinlicher viel-
mehr, daß die Beziehungen Ravennas zu Byzanz wie der Skulptur, so auch der dortigen kirchlichen Monumental-
malerei ihr Sondergepräge verliehen haben. Gestützt wird diese Annahme durch die Stilverwandtschaft des neu-
entdeckten Apsismosaiks von Hosios David in Saloniki (Abb. 537) mit den ravennatischen Mosaikbildern. Völlig
abwegig erscheint es gar, im VI. Jahrh. einen Gegensatz römischer und byzantinischer Stilbildung auf Grund
der ravennatischen Denkmäler und des römischen Apsismosaiks von S. Cosma e Damiano feststellen zu wollen.
Das führt zu der willkürlichen Folgerung, daß in S. Vitale beide Stilrichtungen nebeneinander gearbeitet haben
sollen. Durch eine allzu subjektive Stilvergleichung werden Unterschiede, die auf dem Bildvorwurf beruhen,
55
die Fortbildung der Hausteintechnik zum Gußmauerwerk mit Plattenverkleidung augenscheinlich Hand in Hand.
Der Gesamtbestand der armenischen Bauten liegt vor bei J. Strzygowski (unter Mitarbeit von H. Glück und
L. Lissitzian), Die Baukunst der Armenier und Europa, Wien 1918, I./II. Doch ist der von ihm aufgestellte hypo-
thetische Entwicklungsgang und die Zeitbestimmung der Denkmäler in verschiedenen Richtungen zu berich-
tigen, wie aus den obigen Andeutungen und den Feststellungen der Kritik zu ersehen ist. Vgl. dazu E. Herzfeld,
Wasmuths Monatsh. f. Baukunst 1919, S. lff, und vor allem G. Tschubinaschwili, Monatsh. f. K--Wiss. 1922,
S. 217ff., und für die kaukasischen Kirchenbauten seine Untersuchungen zur Gesch. d. georgischen Baukunst,
Tiflis 1921/22, 1 u. II. Dadurch wird die Kritik von Diehl, Manuel etc.21, p. 335ss., bestätigt.
S. 397f. Bauformen und Technik der ravennatischen Kirchen haben eine eindringliche Zergliederung er-
fahren durch V. Birnbaum, Ravenskä Architektura, 1916 (tschechisch), Ergänzungen über die älteren Denk-
mäler enthalten auch die Untersuchungen über die Baukunst des Exarchats von G. Gerola, L’architett. deutero-
bizantina di Ravenna, Ricordi di Rav. medievaie 1921, und G. Galassi, L’architett. protoromanica nell’Esar-
cato, 1928, Felix Ravenna Suppl. III.
S. 402. Die Baugeschichte der Sophienkirche (Orchan-djami) von Nicäa hat ihre Aufhellung gefunden
durch N. Brunow, Echos d’Orient 1925, p. 471 ss., der vier Bauperioden unterscheidet und die Entstehung der
Pfeiferbasilika der zweiten zuschreibt.
S. 405. Die Gesamtanlage des Palastes von Kasr-ibn-Wardan erklärt sich nach den Ausführungen von
K. M. Swoboda, Rom. u. roman. Paläste, 1919, S. 156f., aus der Vereinigung des frühbyzantinischen Stadt-
palastes mit dem Kastell.
S. 405f. Einige neuere Beobachtungen über den Justinianspalast bietet J. Ebersolt, Mission archeol. ä Con-
stantinople. 1921, p.32ss. Ergänzende Untersuchungen über die Zisternen der Stadt sind K- Wulzinger, Byzant.
Baudenkmäler zu Konstantinopel, 1925, S. 31 ff., zu verdanken. Vgl. ferner den archäologischen Bericht von
K. Lehmann-Hartleben, Byzant. Zeitschr. 1925, S. 252ff. Die älteren Zeugnisse über die Denkmälertopographie
erörtert J. Ebersolt, C-ple et les voyageurs du Levant 1918; vgl. auch K- Wulzinger, a. a. O., S. 28L, und Fest-
schr. f. G. Jacob zum 70. Geburtstage 1932, S. 355ff. (Melchior Lorichs Ansicht von Konstantinopel als topo-
graphische Quelle). Die Befestigung von Ankyra behandelt G. de Jerphanion, Mel. d’archeol. anatol. 1928, p. 117 ss.
S. 407. In der Baugestaltung der Fassade des Secretarium (sog. Theodorichspalastes) erblickt G. Galassi,
Roma e Bizanzio, 1 musaici di Ravenna etc. 1928, p. 226s., und Felix Ravenna 1928, Suppl. III, p. 95s., ohne
ausreichende Beweisgründe eine selbständige Neuerung der Baukunst des Exarchats.
S. 410f. Zur altbyzantinischen Kapitellplastik vgl. außer den Hinweisen auf S. 278 und in der Bern, zu
S. 272—278 die Bemerkungen von J. Ebersolt, Melanges d’hist. et d’archeol. byzantines, 1907, p. 119ss. Für
das Würfelkapitell mit Lotospalmette wird die Entstehung in Konstantinopel aus verschiedenen Wurzeln von
W. F. Volbach, Felix Ravenna 1934, p. 125ss., auf Grund einer Neuerwerbung des K--Friedrich-Museums
vertreten. Dem nachjustinianischen Zeitalter ist hingegen der figurierte Kapitelltypus mit symmetrischen Vogel-
paaren (Abb. 357) abweichend von L. Brehier, Nouv. archives des missions scientif. 1911, p. 51, und meiner
früheren Auffassung abzusprechen und der frühen mazedonischen Kunstblüte zuzuerkennen (s. die ausführliche
Berichtigung zu S. 412). .
III. Die Vollendung des Monumentalstils in der altbyzantinischen Malerei.
S. 415ff. Von verschiedenen Seiten ist neuerdings der Versuch unternommen worden, die Mosaiken von
Ravenna in engere Beziehung zu Rom als zu Byzanz zu bringen (s. Bern, zu I, S. 346 ff.). Die unverkennbare stili-
stische Einheitlichkeit der ravennatischen Denkmäler des V. Jahrh. wird aus einer örtlichen Entwicklung erklärt,
die als Fortbildung römischer Vorstufen aufzufassen sei. Die Überreste kirchlicher Mosaikmalerei in Rom bieten
jedoch für solche Aufstellungen keine ausreichende Handhabe. Eine gemeinsame hellenistische Grundlage ist
gewiß für sämtliche erhaltenen Mosaiken Italiens vorauszusetzen, die führende Rolle Roms bleibt aber unbeweisbar
und angesichts der Verlegung der westlichen Reichshauptstadt unwahrscheinlich, — weit wahrscheinlicher viel-
mehr, daß die Beziehungen Ravennas zu Byzanz wie der Skulptur, so auch der dortigen kirchlichen Monumental-
malerei ihr Sondergepräge verliehen haben. Gestützt wird diese Annahme durch die Stilverwandtschaft des neu-
entdeckten Apsismosaiks von Hosios David in Saloniki (Abb. 537) mit den ravennatischen Mosaikbildern. Völlig
abwegig erscheint es gar, im VI. Jahrh. einen Gegensatz römischer und byzantinischer Stilbildung auf Grund
der ravennatischen Denkmäler und des römischen Apsismosaiks von S. Cosma e Damiano feststellen zu wollen.
Das führt zu der willkürlichen Folgerung, daß in S. Vitale beide Stilrichtungen nebeneinander gearbeitet haben
sollen. Durch eine allzu subjektive Stilvergleichung werden Unterschiede, die auf dem Bildvorwurf beruhen,