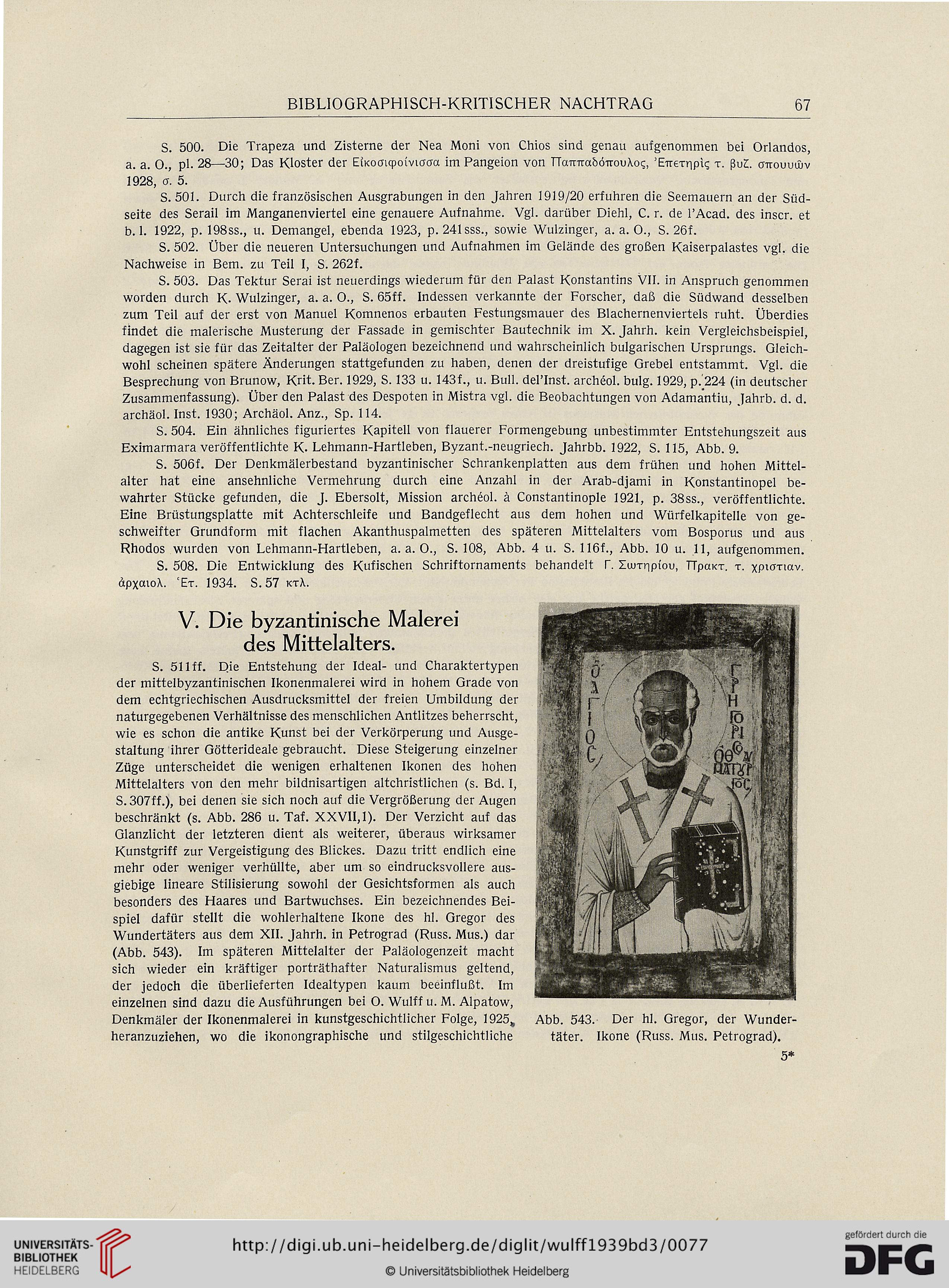BIBLIOGRAPHISCH-KRITISCHER NACHTRAG
67
S. 500. Die Trapeza und Zisterne der Nea Moni von Chios sind genau aufgenommen bei Orlandos,
a. a. O., pl. 28—30; Das Kloster der Eiicoaupoiviffffa im Pangeion von nomxraboTrouAoi;, 'Errexripiq t. ßuZ. a-itouuujv
1928, ff. 5.
S. 501. Durch die französischen Ausgrabungen in den Jahren 1919/20 erfuhren die Seemauern an der Süd-
seite des Serail im Manganenviertel eine genauere Aufnahme. Vgl. darüber Diehl, C. r. de l’Acad. des inscr. et
b. 1. 1922, p. 198ss., u. Demangel, ebenda 1923, p. 241 sss., sowie Wulzinger, a. a. O., S. 26f.
S. 502. Über die neueren Untersuchungen und Aufnahmen im Gelände des großen Kaiserpalastes vgl. die
Nachweise in Bern, zu Teil I, S. 262f.
S. 503. Das Tektur Serai ist neuerdings wiederum für den Palast Konstantins VII. in Anspruch genommen
worden durch K. Wulzinger, a. a. 0., S. 65ff. Indessen verkannte der Forscher, daß die Südwand desselben
zum Teil auf der erst von Manuel Komnenos erbauten Festungsmauer des Blachernenviertels ruht. Überdies
findet die malerische Musterung der Fassade in gemischter Bautechnik im X. Jahrh. kein Vergleichsbeispiel,
dagegen ist sie für das Zeitalter der Paläologen bezeichnend und wahrscheinlich bulgarischen Ursprungs. Gleich-
wohl scheinen spätere Änderungen stattgefunden zu haben, denen der dreistufige Grebel entstammt. Vgl. die
Besprechung von Brunow, Krit. Ber. 1929, S. 133 u. 143f., u. Bull. del’Inst. archeol. bulg. 1929, p.'224 (in deutscher
Zusammenfassung). Über den Palast des Despoten in Mistra vgl. die Beobachtungen von Adamantiu, Jahrb. d. d.
archäol. Inst. 1930; Archäol. Anz., Sp. 114.
S. 504. Ein ähnliches figuriertes Kapitell von flauerer Formengebung unbestimmter Entstehungszeit aus
Eximarmara veröffentlichte K. Lehmann-Hartleben, Byzant.-neugriech. Jahrbb. 1922, S. 115, Abb. 9.
S. 506f. Der Denkmälerbestand byzantinischer Schrankenplatten aus dem frühen und hohen Mittel-
alter hat eine ansehnliche Vermehrung durch eine Anzahl in der Arab-djami in Konstantinopel be-
wahrter Stücke gefunden, die J. Ebersolt, Mission archeol. ä Constantinople 1921, p. 38ss., veröffentlichte.
Eine Brüstungsplatte mit Achterschleife und Bandgeflecht aus dem hohen und Würfelkapitelle von ge-
schweifter Grundform mit flachen Akanthuspalmetten des späteren Mittelalters vom Bosporus und aus
Rhodos wurden von Lehmann-Hartleben, a. a. O., S. 108, Abb. 4 u. S. 116f., Abb. 10 u. 11, aufgenommen.
S. 508. Die Entwicklung des Kritischen Schriftornaments behandelt T. Iwrppiou, FTpcucr. t. xprcmav.
äpxaioA. ‘Er. 1934. S. 57 ktA.
V. Die byzantinische Malerei
des Mittelalters.
S. 511 ff. Die Entstehung der Ideal- und Charaktertypen
der mittelbyzantinischen Ikonenmalerei wird in hohem Grade von
dem echtgriechischen Ausdrucksmittel der freien Umbildung der
naturgegebenen Verhältnisse des menschlichen Antlitzes beherrscht,
wie es schon die antike Kunst bei der Verkörperung und Ausge-
staltung ihrer Götterideale gebraucht. Diese Steigerung einzelner
Züge unterscheidet die wenigen erhaltenen Ikonen des hohen
Mittelalters von den mehr bildnisartigen altchristlichen (s. Bd. I,
S.307ff.), bei denen sie sich noch auf die Vergrößerung der Augen
beschränkt (s. Abb. 286 u. Taf. XXVII,1). Der Verzicht auf das
Glanzlicht der letzteren dient als weiterer, überaus wirksamer
Kunstgriff zur Vergeistigung des Blickes. Dazu tritt endlich eine
mehr oder weniger verhüllte, aber um so eindrucksvollere aus-
giebige lineare Stilisierung sowohl der Gesichtsformen als auch
besonders des Haares und Bartwuchses. Ein bezeichnendes Bei-
spiel dafür stellt die wohlerhaltene Ikone des hl. Gregor des
Wundertäters aus dem XII. Jahrh. in Petrograd (Russ. Mus.) dar
(Abb. 543). Im späteren Mittelalter der Paläologenzeit macht
sich wieder ein kräftiger porträthafter Naturalismus geltend,
der jedoch die überlieferten Idealtypen kaum beeinflußt. Im
einzelnen sind dazu die Ausführungen bei O. Wulff u. M. Alpatow,
Denkmäler der Ikonenmalerei in kunstgeschichtlicher Folge, 1925, Abb. 543. Der hl. Gregor, der Wunder-
heranzuziehen, wo die ikonongraphische und stilgeschichtliche täter. Ikone (Russ. Mus. Petrograd).
5*
67
S. 500. Die Trapeza und Zisterne der Nea Moni von Chios sind genau aufgenommen bei Orlandos,
a. a. O., pl. 28—30; Das Kloster der Eiicoaupoiviffffa im Pangeion von nomxraboTrouAoi;, 'Errexripiq t. ßuZ. a-itouuujv
1928, ff. 5.
S. 501. Durch die französischen Ausgrabungen in den Jahren 1919/20 erfuhren die Seemauern an der Süd-
seite des Serail im Manganenviertel eine genauere Aufnahme. Vgl. darüber Diehl, C. r. de l’Acad. des inscr. et
b. 1. 1922, p. 198ss., u. Demangel, ebenda 1923, p. 241 sss., sowie Wulzinger, a. a. O., S. 26f.
S. 502. Über die neueren Untersuchungen und Aufnahmen im Gelände des großen Kaiserpalastes vgl. die
Nachweise in Bern, zu Teil I, S. 262f.
S. 503. Das Tektur Serai ist neuerdings wiederum für den Palast Konstantins VII. in Anspruch genommen
worden durch K. Wulzinger, a. a. 0., S. 65ff. Indessen verkannte der Forscher, daß die Südwand desselben
zum Teil auf der erst von Manuel Komnenos erbauten Festungsmauer des Blachernenviertels ruht. Überdies
findet die malerische Musterung der Fassade in gemischter Bautechnik im X. Jahrh. kein Vergleichsbeispiel,
dagegen ist sie für das Zeitalter der Paläologen bezeichnend und wahrscheinlich bulgarischen Ursprungs. Gleich-
wohl scheinen spätere Änderungen stattgefunden zu haben, denen der dreistufige Grebel entstammt. Vgl. die
Besprechung von Brunow, Krit. Ber. 1929, S. 133 u. 143f., u. Bull. del’Inst. archeol. bulg. 1929, p.'224 (in deutscher
Zusammenfassung). Über den Palast des Despoten in Mistra vgl. die Beobachtungen von Adamantiu, Jahrb. d. d.
archäol. Inst. 1930; Archäol. Anz., Sp. 114.
S. 504. Ein ähnliches figuriertes Kapitell von flauerer Formengebung unbestimmter Entstehungszeit aus
Eximarmara veröffentlichte K. Lehmann-Hartleben, Byzant.-neugriech. Jahrbb. 1922, S. 115, Abb. 9.
S. 506f. Der Denkmälerbestand byzantinischer Schrankenplatten aus dem frühen und hohen Mittel-
alter hat eine ansehnliche Vermehrung durch eine Anzahl in der Arab-djami in Konstantinopel be-
wahrter Stücke gefunden, die J. Ebersolt, Mission archeol. ä Constantinople 1921, p. 38ss., veröffentlichte.
Eine Brüstungsplatte mit Achterschleife und Bandgeflecht aus dem hohen und Würfelkapitelle von ge-
schweifter Grundform mit flachen Akanthuspalmetten des späteren Mittelalters vom Bosporus und aus
Rhodos wurden von Lehmann-Hartleben, a. a. O., S. 108, Abb. 4 u. S. 116f., Abb. 10 u. 11, aufgenommen.
S. 508. Die Entwicklung des Kritischen Schriftornaments behandelt T. Iwrppiou, FTpcucr. t. xprcmav.
äpxaioA. ‘Er. 1934. S. 57 ktA.
V. Die byzantinische Malerei
des Mittelalters.
S. 511 ff. Die Entstehung der Ideal- und Charaktertypen
der mittelbyzantinischen Ikonenmalerei wird in hohem Grade von
dem echtgriechischen Ausdrucksmittel der freien Umbildung der
naturgegebenen Verhältnisse des menschlichen Antlitzes beherrscht,
wie es schon die antike Kunst bei der Verkörperung und Ausge-
staltung ihrer Götterideale gebraucht. Diese Steigerung einzelner
Züge unterscheidet die wenigen erhaltenen Ikonen des hohen
Mittelalters von den mehr bildnisartigen altchristlichen (s. Bd. I,
S.307ff.), bei denen sie sich noch auf die Vergrößerung der Augen
beschränkt (s. Abb. 286 u. Taf. XXVII,1). Der Verzicht auf das
Glanzlicht der letzteren dient als weiterer, überaus wirksamer
Kunstgriff zur Vergeistigung des Blickes. Dazu tritt endlich eine
mehr oder weniger verhüllte, aber um so eindrucksvollere aus-
giebige lineare Stilisierung sowohl der Gesichtsformen als auch
besonders des Haares und Bartwuchses. Ein bezeichnendes Bei-
spiel dafür stellt die wohlerhaltene Ikone des hl. Gregor des
Wundertäters aus dem XII. Jahrh. in Petrograd (Russ. Mus.) dar
(Abb. 543). Im späteren Mittelalter der Paläologenzeit macht
sich wieder ein kräftiger porträthafter Naturalismus geltend,
der jedoch die überlieferten Idealtypen kaum beeinflußt. Im
einzelnen sind dazu die Ausführungen bei O. Wulff u. M. Alpatow,
Denkmäler der Ikonenmalerei in kunstgeschichtlicher Folge, 1925, Abb. 543. Der hl. Gregor, der Wunder-
heranzuziehen, wo die ikonongraphische und stilgeschichtliche täter. Ikone (Russ. Mus. Petrograd).
5*