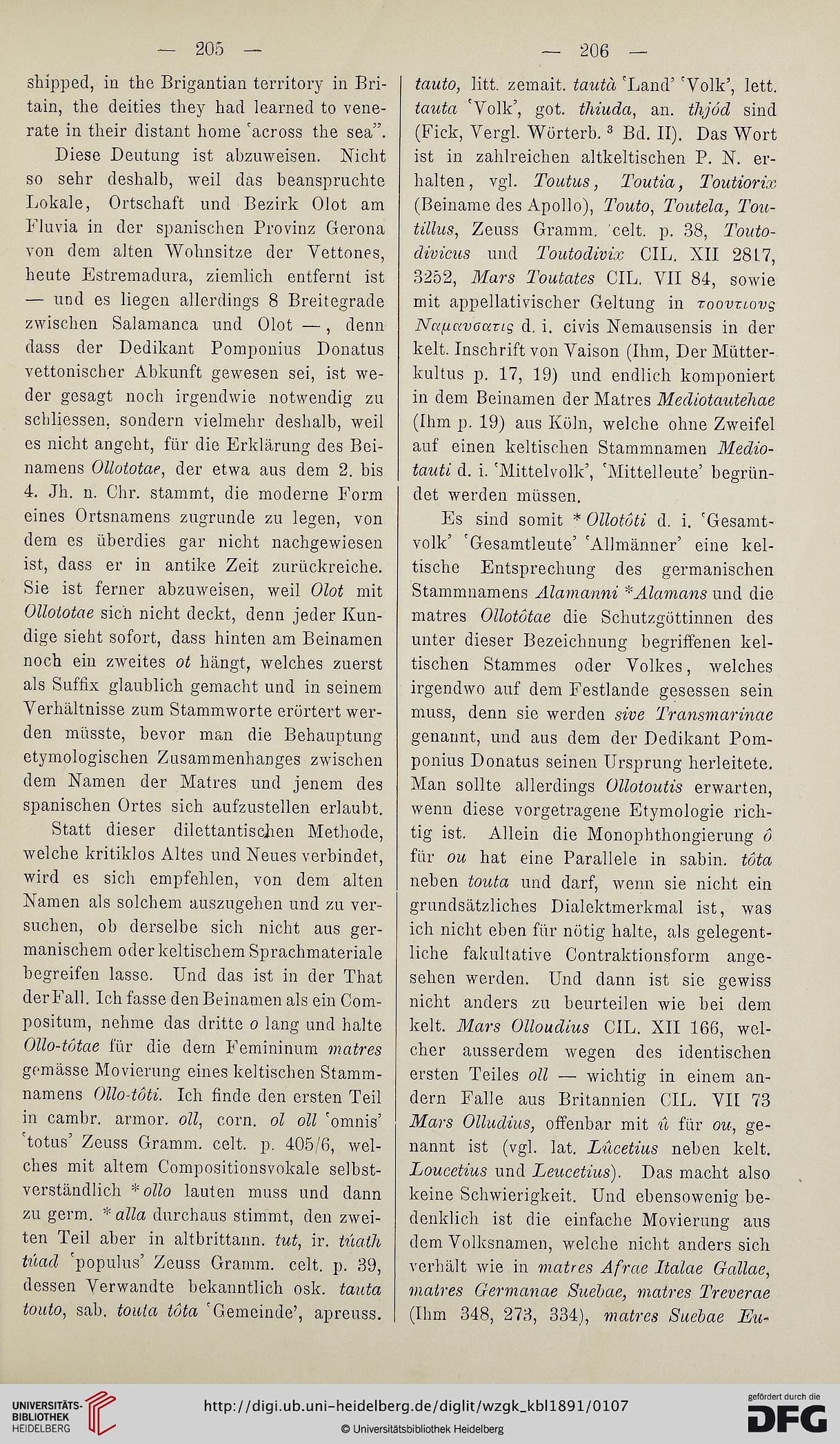205
206
shipped, in the Brigantian territory in Bri-
tain, the cleities they harl learned to vene-
rate in tlieir distant home 'across the sea”.
Diese Deutung ist abzuweisen. Nicht
so sehr deshalb, weil das beanspruchte
Lokale, Ortschaft und Bezirk Olot am
Fluvia in der spanischen Provinz Gerona
von dem alten Wohnsitze der Yettones,
heute Estremadura, ziemlich entfernt ist
— und es liegen allerdings 8 Breitegrade
zwischen Salamanca und Olot —, denn
dass der Dedikant Pomponius Donatus
vettonischer Abkunft gewesen sei, ist we-
der gesagt noch irgendwie notwendig zu
schliessen, sondern vielmehr deshalb, weil
es nicht angeht, für die Erklärung des Bei-
namens Ollototae, der etwa aus dem 2. bis
4. Jh. n. Chr. stammt, die moderne Form
eines Ortsnamens zugrunde zu legen, von
dem es überdies gar nicht nachgewiesen
ist, dass er in antike Zeit zurückreiche.
Sie ist ferner abzuweisen, weil Olot mit
Ollototae sich nicht deckt, denn jeder Kun-
dige sieht sofort, dass hinten am Beinamen
noch ein zweites ot hängt, welches zuerst
als Suffix glaublich gemacht und in seinem
Verhältnisse zum Stammworte erörtert wer-
den müsste, bevor man die Behauptung
etymologischen Zusammenhanges zwischen
dem Namen der Matres und jenem des
spanischen Ortes sich aufzustellen erlaubt.
Statt dieser dilettantischen Methode,
welche kritiklos Altes und Neues verbindet,
wird es sich empfehlen, von dem alten
Namen als solchem auszugehen und zu ver-
suchen, ob derselbe sich nicht aus ger-
manischem oder keltischem Sprachmateriale
hegreifen lasse. Und das ist in der That
derFall, Ich fasse den Beinamen als ein Com-
positum, nehme das dritte o lang und halte
Ollo-totae für die dem Femininum matres
gemässe Movierung eines keltischen Stamm-
namens Ollo-töti. Ich finde den ersten Teil
in cambr. armor. oll, corn. ol oll 'omnis’
totus’ Zeuss Gramm, celt. p. 405/6, wel-
ches mit altem Compositionsvokale selbst-
verständlich * ollo lauten muss und dann
zu germ. * alla durchaus stimmt, den zwei-
ten Teil aber in altbrittann. tut, ir. tüath
tüad populus’ Zeuss Gramm, celt. p. 39,
dessen Verwandte bekanntlich osk. tauta
touto, sab. toula tota 'Gemeinde’, apreuss.
tauto, litt, zemait. tauta 'Land’ 'Volk’, lett.
tauta 'Volk’, got. thiuda, an. tlijud sind
(Fick, Vergl. Wörterb.3 Bd. II). Das Wort
ist in zahlreichen altkeltischen P. N. er-
halten, vgl. Toutus, Toutia, Toutiorix
(Beiname des Apollo), Touto, Toutela, Tou-
tillus, Zeuss Gramm, celt. p. 38, Touto-
divicus und Toutodivix CIL. Nil 2817,
3252, Mars Toutates CIL. VII 84, sowie
mit appellativischer Geltung in toovtlovs
Ndf-icivouTus d. i. civis Nemausensis in der
kelt. Inschrift von Vaison (Ihm, Der Mütter-
kultus p. 17, 19) und endlich komponiert
in dem Beinamen der Matres Mediotautehae
(Ihm p. 19) aus Köln, welche ohne Zweifel
auf einen keltischen Stammnamen Medio-
tauti d. i. 'Mittelvolk’, 'Mittelleute’ begrün-
det werden müssen.
Es sind somit * Ollotöti d. i. 'Gesamt-
volk’ 'Gesamtleute’ 'Allmänner’ eine kel-
tische Entsprechung des germanischen
Stammnamens Alarnanni *Alamans und die
matres Ollototae die Schutzgöttinnen des
unter dieser Bezeichnung begriffenen kel-
tischen Stammes oder Volkes, welches
irgendwo auf dem Festlande gesessen sein
muss, denn sie werden sive Transmarinae
genannt, und aus dem der Dedikant Pom-
ponius Donatus seinen Ursprung herleitete.
Man sollte allerdings Ollotoutis erwarten,
wenn diese vorgetragene Etymologie rich-
tig ist. Allein die Monophthongierung 6
für ou hat eine Parallele in sabin. tota
neben touta und darf, wenn sie nicht ein
grundsätzliches Dialektmerkmal ist, was
ich nicht eben für nötig halte, als gelegent-
liche fakultative Contraktionsform ange-
sehen werden. Und dann ist sie gewiss
nicht anders zu beurteilen wie bei dem
kelt. Mars Olloudius CIL. XII 166, wel-
cher ausserdem wegen des identischen
ersten Teiles oll — wichtig in einem an-
dern Falle aus Britannien CIL. VII 73
Mars Olludius, offenbar mit u für ou, ge-
nannt ist (vgl. lat. Lücetius neben kelt.
Loucetius und Leucetius). Das macht also
keine Schwierigkeit. Und ebensowenig be-
denklich ist die einfache Movierung aus
dem Volksnamen, welche nicht anders sich
verhält wie in matres Afrae Italae Gallae,
matres Germanae Suebae, matres Treverae
(Ihm 348, 273, 334), matres Suebae Eu-
206
shipped, in the Brigantian territory in Bri-
tain, the cleities they harl learned to vene-
rate in tlieir distant home 'across the sea”.
Diese Deutung ist abzuweisen. Nicht
so sehr deshalb, weil das beanspruchte
Lokale, Ortschaft und Bezirk Olot am
Fluvia in der spanischen Provinz Gerona
von dem alten Wohnsitze der Yettones,
heute Estremadura, ziemlich entfernt ist
— und es liegen allerdings 8 Breitegrade
zwischen Salamanca und Olot —, denn
dass der Dedikant Pomponius Donatus
vettonischer Abkunft gewesen sei, ist we-
der gesagt noch irgendwie notwendig zu
schliessen, sondern vielmehr deshalb, weil
es nicht angeht, für die Erklärung des Bei-
namens Ollototae, der etwa aus dem 2. bis
4. Jh. n. Chr. stammt, die moderne Form
eines Ortsnamens zugrunde zu legen, von
dem es überdies gar nicht nachgewiesen
ist, dass er in antike Zeit zurückreiche.
Sie ist ferner abzuweisen, weil Olot mit
Ollototae sich nicht deckt, denn jeder Kun-
dige sieht sofort, dass hinten am Beinamen
noch ein zweites ot hängt, welches zuerst
als Suffix glaublich gemacht und in seinem
Verhältnisse zum Stammworte erörtert wer-
den müsste, bevor man die Behauptung
etymologischen Zusammenhanges zwischen
dem Namen der Matres und jenem des
spanischen Ortes sich aufzustellen erlaubt.
Statt dieser dilettantischen Methode,
welche kritiklos Altes und Neues verbindet,
wird es sich empfehlen, von dem alten
Namen als solchem auszugehen und zu ver-
suchen, ob derselbe sich nicht aus ger-
manischem oder keltischem Sprachmateriale
hegreifen lasse. Und das ist in der That
derFall, Ich fasse den Beinamen als ein Com-
positum, nehme das dritte o lang und halte
Ollo-totae für die dem Femininum matres
gemässe Movierung eines keltischen Stamm-
namens Ollo-töti. Ich finde den ersten Teil
in cambr. armor. oll, corn. ol oll 'omnis’
totus’ Zeuss Gramm, celt. p. 405/6, wel-
ches mit altem Compositionsvokale selbst-
verständlich * ollo lauten muss und dann
zu germ. * alla durchaus stimmt, den zwei-
ten Teil aber in altbrittann. tut, ir. tüath
tüad populus’ Zeuss Gramm, celt. p. 39,
dessen Verwandte bekanntlich osk. tauta
touto, sab. toula tota 'Gemeinde’, apreuss.
tauto, litt, zemait. tauta 'Land’ 'Volk’, lett.
tauta 'Volk’, got. thiuda, an. tlijud sind
(Fick, Vergl. Wörterb.3 Bd. II). Das Wort
ist in zahlreichen altkeltischen P. N. er-
halten, vgl. Toutus, Toutia, Toutiorix
(Beiname des Apollo), Touto, Toutela, Tou-
tillus, Zeuss Gramm, celt. p. 38, Touto-
divicus und Toutodivix CIL. Nil 2817,
3252, Mars Toutates CIL. VII 84, sowie
mit appellativischer Geltung in toovtlovs
Ndf-icivouTus d. i. civis Nemausensis in der
kelt. Inschrift von Vaison (Ihm, Der Mütter-
kultus p. 17, 19) und endlich komponiert
in dem Beinamen der Matres Mediotautehae
(Ihm p. 19) aus Köln, welche ohne Zweifel
auf einen keltischen Stammnamen Medio-
tauti d. i. 'Mittelvolk’, 'Mittelleute’ begrün-
det werden müssen.
Es sind somit * Ollotöti d. i. 'Gesamt-
volk’ 'Gesamtleute’ 'Allmänner’ eine kel-
tische Entsprechung des germanischen
Stammnamens Alarnanni *Alamans und die
matres Ollototae die Schutzgöttinnen des
unter dieser Bezeichnung begriffenen kel-
tischen Stammes oder Volkes, welches
irgendwo auf dem Festlande gesessen sein
muss, denn sie werden sive Transmarinae
genannt, und aus dem der Dedikant Pom-
ponius Donatus seinen Ursprung herleitete.
Man sollte allerdings Ollotoutis erwarten,
wenn diese vorgetragene Etymologie rich-
tig ist. Allein die Monophthongierung 6
für ou hat eine Parallele in sabin. tota
neben touta und darf, wenn sie nicht ein
grundsätzliches Dialektmerkmal ist, was
ich nicht eben für nötig halte, als gelegent-
liche fakultative Contraktionsform ange-
sehen werden. Und dann ist sie gewiss
nicht anders zu beurteilen wie bei dem
kelt. Mars Olloudius CIL. XII 166, wel-
cher ausserdem wegen des identischen
ersten Teiles oll — wichtig in einem an-
dern Falle aus Britannien CIL. VII 73
Mars Olludius, offenbar mit u für ou, ge-
nannt ist (vgl. lat. Lücetius neben kelt.
Loucetius und Leucetius). Das macht also
keine Schwierigkeit. Und ebensowenig be-
denklich ist die einfache Movierung aus
dem Volksnamen, welche nicht anders sich
verhält wie in matres Afrae Italae Gallae,
matres Germanae Suebae, matres Treverae
(Ihm 348, 273, 334), matres Suebae Eu-