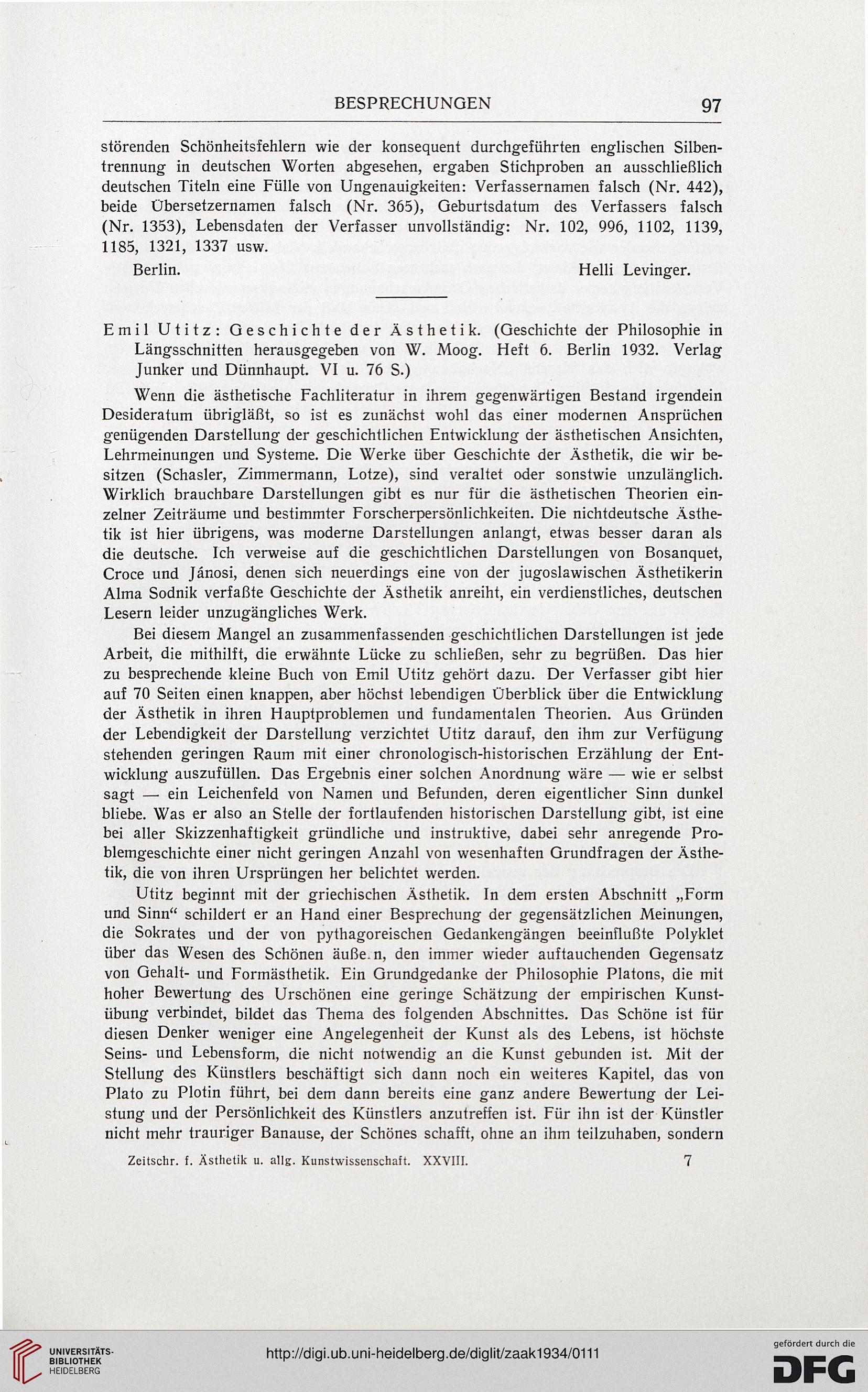BESPRECHUNGEN
97
störenden Schönheitsfehlern wie der konsequent durchgeführten englischen Silben-
trennung in deutschen Worten abgesehen, ergaben Stichproben an ausschließlich
deutschen Titeln eine Fülle von Ungenauigkeiten: Verfassernamen falsch (Nr. 442),
beide Übersetzernamen falsch (Nr. 365), Geburtsdatum des Verfassers falsch
(Nr. 1353), Lebensdaten der Verfasser unvollständig: Nr. 102, 996, 1102, 1139,
1185, 1321, 1337 usw.
Berlin. Helli Levinger.
Emil Utitz: Geschichte der Ästhetik. (Geschichte der Philosophie in
Längsschnitten herausgegeben von W. Moog. Heft 6. Berlin 1932. Verlag
Junker und Dünnhaupt. VI u. 76 S.)
Wenn die ästhetische Fachliteratur in ihrem gegenwärtigen Bestand irgendein
Desideratum übrigläßt, so ist es zunächst wohl das einer modernen Ansprüchen
genügenden Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der ästhetischen Ansichten,
Lehrmeinungen und Systeme. Die Werke über Geschichte der Ästhetik, die wir be-
sitzen (Schasler, Zimmermann, Lotze), sind veraltet oder sonstwie unzulänglich.
Wirklich brauchbare Darstellungen gibt es nur für die ästhetischen Theorien ein-
zelner Zeiträume und bestimmter Forscherpersönlichkeiten. Die nichtdeutsche Ästhe-
tik ist hier übrigens, was moderne Darstellungen anlangt, etwas besser daran als
die deutsche. Ich verweise auf die geschichtlichen Darstellungen von Bosanquet,
Croce und Jänosi, denen sich neuerdings eine von der jugoslawischen Ästhetikerin
Alma Sodnik verfaßte Geschichte der Ästhetik anreiht, ein verdienstliches, deutschen
Lesern leider unzugängliches Werk.
Bei diesem Mangel an zusammenfassenden geschichtlichen Darstellungen ist jede
Arbeit, die mithilft, die erwähnte Lücke zu schließen, sehr zu begrüßen. Das hier
zu besprechende kleine Buch von Emil Utitz gehört dazu. Der Verfasser gibt hier
auf 70 Seiten einen knappen, aber höchst lebendigen Oberblick über die Entwicklung
der Ästhetik in ihren Hauptproblemen und fundamentalen Theorien. Aus Gründen
der Lebendigkeit der Darstellung verzichtet Utitz darauf, den ihm zur Verfügung
stehenden geringen Raum mit einer chronologisch-historischen Erzählung der Ent-
wicklung auszufüllen. Das Ergebnis einer solchen Anordnung wäre — wie er selbst
sagt —■ ein Leichenfeld von Namen und Befunden, deren eigentlicher Sinn dunkel
bliebe. Was er also an Stelle der fortlaufenden historischen Darstellung gibt, ist eine
bei aller Skizzenhaftigkeit gründliche und instruktive, dabei sehr anregende Pro-
blemgeschichte einer nicht geringen Anzahl von wesenhaften Grundfragen der Ästhe-
tik, die von ihren Ursprüngen her belichtet werden.
Utitz beginnt mit der griechischen Ästhetik. In dem ersten Abschnitt „Form
und Sinn" schildert er an Hand einer Besprechung der gegensätzlichen Meinungen,
die Sokrates und der von pythagoreischen Gedankengängen beeinflußte Polyklet
über das Wesen des Schönen auße n, den immer wieder auftauchenden Gegensatz
von Gehalt- und Formästhefik. Ein Grundgedanke der Philosophie Piatons, die mit
hoher Bewertung des Urschönen eine geringe Schätzung der empirischen Kunst-
übung verbindet, bildet das Thema des folgenden Abschnittes. Das Schöne ist für
diesen Denker weniger eine Angelegenheit der Kunst als des Lebens, ist höchste
Seins- und Lebensform, die nicht notwendig an die Kunst gebunden ist. Mit der
Stellung des Künstlers beschäftigt sich dann noch ein weiteres Kapitel, das von
Plato zu Plotin führt, bei dem dann bereits eine ganz andere Bewertung der Lei-
stung und der Persönlichkeit des Künstlers anzutreffen ist. Für ihn ist der Künstler
nicht mehr trauriger Banause, der Schönes schafft, ohne an ihm teilzuhaben, sondern
Zcitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVIII.
7
97
störenden Schönheitsfehlern wie der konsequent durchgeführten englischen Silben-
trennung in deutschen Worten abgesehen, ergaben Stichproben an ausschließlich
deutschen Titeln eine Fülle von Ungenauigkeiten: Verfassernamen falsch (Nr. 442),
beide Übersetzernamen falsch (Nr. 365), Geburtsdatum des Verfassers falsch
(Nr. 1353), Lebensdaten der Verfasser unvollständig: Nr. 102, 996, 1102, 1139,
1185, 1321, 1337 usw.
Berlin. Helli Levinger.
Emil Utitz: Geschichte der Ästhetik. (Geschichte der Philosophie in
Längsschnitten herausgegeben von W. Moog. Heft 6. Berlin 1932. Verlag
Junker und Dünnhaupt. VI u. 76 S.)
Wenn die ästhetische Fachliteratur in ihrem gegenwärtigen Bestand irgendein
Desideratum übrigläßt, so ist es zunächst wohl das einer modernen Ansprüchen
genügenden Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der ästhetischen Ansichten,
Lehrmeinungen und Systeme. Die Werke über Geschichte der Ästhetik, die wir be-
sitzen (Schasler, Zimmermann, Lotze), sind veraltet oder sonstwie unzulänglich.
Wirklich brauchbare Darstellungen gibt es nur für die ästhetischen Theorien ein-
zelner Zeiträume und bestimmter Forscherpersönlichkeiten. Die nichtdeutsche Ästhe-
tik ist hier übrigens, was moderne Darstellungen anlangt, etwas besser daran als
die deutsche. Ich verweise auf die geschichtlichen Darstellungen von Bosanquet,
Croce und Jänosi, denen sich neuerdings eine von der jugoslawischen Ästhetikerin
Alma Sodnik verfaßte Geschichte der Ästhetik anreiht, ein verdienstliches, deutschen
Lesern leider unzugängliches Werk.
Bei diesem Mangel an zusammenfassenden geschichtlichen Darstellungen ist jede
Arbeit, die mithilft, die erwähnte Lücke zu schließen, sehr zu begrüßen. Das hier
zu besprechende kleine Buch von Emil Utitz gehört dazu. Der Verfasser gibt hier
auf 70 Seiten einen knappen, aber höchst lebendigen Oberblick über die Entwicklung
der Ästhetik in ihren Hauptproblemen und fundamentalen Theorien. Aus Gründen
der Lebendigkeit der Darstellung verzichtet Utitz darauf, den ihm zur Verfügung
stehenden geringen Raum mit einer chronologisch-historischen Erzählung der Ent-
wicklung auszufüllen. Das Ergebnis einer solchen Anordnung wäre — wie er selbst
sagt —■ ein Leichenfeld von Namen und Befunden, deren eigentlicher Sinn dunkel
bliebe. Was er also an Stelle der fortlaufenden historischen Darstellung gibt, ist eine
bei aller Skizzenhaftigkeit gründliche und instruktive, dabei sehr anregende Pro-
blemgeschichte einer nicht geringen Anzahl von wesenhaften Grundfragen der Ästhe-
tik, die von ihren Ursprüngen her belichtet werden.
Utitz beginnt mit der griechischen Ästhetik. In dem ersten Abschnitt „Form
und Sinn" schildert er an Hand einer Besprechung der gegensätzlichen Meinungen,
die Sokrates und der von pythagoreischen Gedankengängen beeinflußte Polyklet
über das Wesen des Schönen auße n, den immer wieder auftauchenden Gegensatz
von Gehalt- und Formästhefik. Ein Grundgedanke der Philosophie Piatons, die mit
hoher Bewertung des Urschönen eine geringe Schätzung der empirischen Kunst-
übung verbindet, bildet das Thema des folgenden Abschnittes. Das Schöne ist für
diesen Denker weniger eine Angelegenheit der Kunst als des Lebens, ist höchste
Seins- und Lebensform, die nicht notwendig an die Kunst gebunden ist. Mit der
Stellung des Künstlers beschäftigt sich dann noch ein weiteres Kapitel, das von
Plato zu Plotin führt, bei dem dann bereits eine ganz andere Bewertung der Lei-
stung und der Persönlichkeit des Künstlers anzutreffen ist. Für ihn ist der Künstler
nicht mehr trauriger Banause, der Schönes schafft, ohne an ihm teilzuhaben, sondern
Zcitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVIII.
7