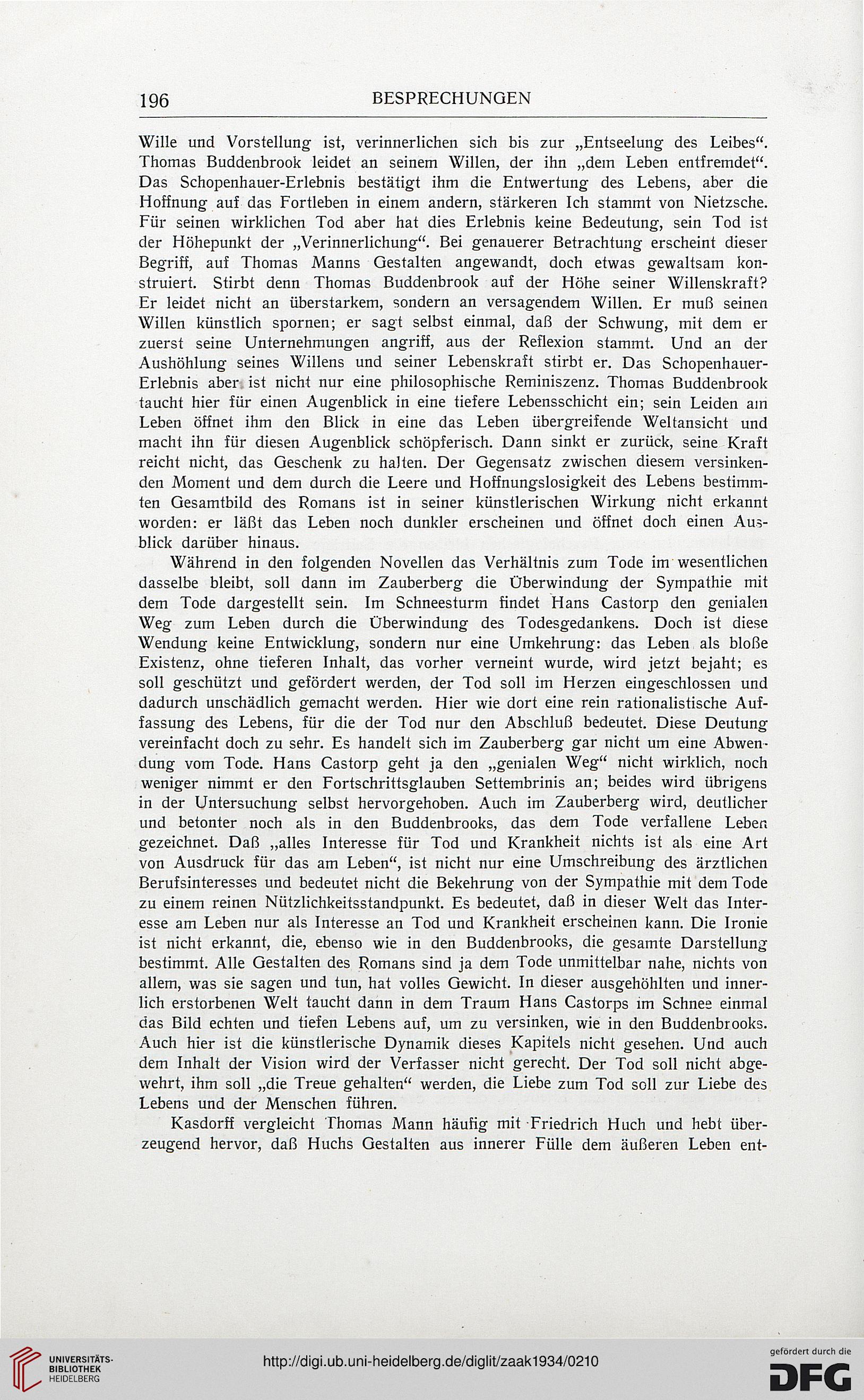196
BESPRECHUNGEN
Wille und Vorstellung ist, verinnerlichen sich bis zur „Entseelung des Leibes".
Thomas Buddenbrook leidet an seinem Willen, der ihn „dem Leben entfremdet".
Das Schopenhauer-Erlebnis bestätigt ihm die Entwertung des Lebens, aber die
Hoffnung auf das Fortleben in einem andern, stärkeren Ich stammt von Nietzsche.
Für seinen wirklichen Tod aber hat dies Erlebnis keine Bedeutung, sein Tod ist
der Höhepunkt der „Verinnerlichung". Bei genauerer Betrachtung erscheint dieser
Begriff, auf Thomas Manns Gestalten angewandt, doch etwas gewaltsam kon-
struiert. Stirbt denn Thomas Buddenbrook auf der Höhe seiner Willenskraft?
Er leidet nicht an überstarkem, sondern an versagendem Willen. Er muß seinen
Willen künstlich spornen; er sagt selbst einmal, daß der Schwung, mit dem er
zuerst seine Unternehmungen angriff, aus der Reflexion stammt. Und an der
Aushöhlung seines Willens und seiner Lebenskraft stirbt er. Das Schopenhauer-
Erlebnis aber ist nicht nur eine philosophische Reminiszenz. Thomas Buddenbrook
taucht hier für einen Augenblick in eine tiefere Lebensschicht ein; sein Leiden am
Leben öffnet ihm den Blick in eine das Leben übergreifende Weltansicht und
macht ihn für diesen Augenblick schöpferisch. Dann sinkt er zurück, seine Kraft
reicht nicht, das Geschenk zu halten. Der Gegensatz zwischen diesem versinken-
den Moment und dem durch die Leere und Hoffnungslosigkeit des Lebens bestimm-
ten Gesamtbild des Romans ist in seiner künstlerischen Wirkung nicht erkannt
worden: er läßt das Leben noch dunkler erscheinen und öffnet doch einen Aus-
blick darüber hinaus.
Während in den folgenden Novellen das Verhältnis zum Tode im wesentlichen
dasselbe bleibt, soll dann im Zauberberg die Überwindung der Sympathie mit
dem Tode dargestellt sein. Im Schneesturm findet Hans Castorp den genialen
Weg zum Leben durch die Überwindung des Todesgedankens. Doch ist diese
Wendung keine Entwicklung, sondern nur eine Umkehrung: das Leben als bloße
Existenz, ohne tieferen Inhalt, das vorher verneint wurde, wird jetzt bejaht; es
soll geschützt und gefördert werden, der Tod soll im Herzen eingeschlossen und
dadurch unschädlich gemacht werden. Hier wie dort eine rein rationalistische Auf-
fassung des Lebens, für die der Tod nur den Abschluß bedeutet. Diese Deutung
vereinfacht doch zu sehr. Es handelt sich im Zauberberg gar nicht um eine Abwen-
dung vom Tode. Hans Castorp geht ja den „genialen Weg" nicht wirklich, noch
weniger nimmt er den Fortschrittsglauben Settembrinis an; beides wird übrigens
in der Untersuchung selbst hervorgehoben. Auch im Zauberberg wird, deutlicher
und betonter noch als in den Buddenbrooks, das dem Tode verfallene Leben
gezeichnet. Daß „alles Interesse für Tod und Krankheit nichts ist als eine Art
von Ausdruck für das am Leben", ist nicht nur eine Umschreibung des ärztlichen
Berufsinteresses und bedeutet nicht die Bekehrung von der Sympathie mit dem Tode
zu einem reinen Nützlichkeitsstandpunkt. Es bedeutet, daß in dieser Welt das Inter-
esse am Leben nur als Interesse an Tod und Krankheit erscheinen kann. Die Ironie
ist nicht erkannt, die, ebenso wie in den Buddenbrooks, die gesamte Darstellung
bestimmt. Alle Gestalten des Romans sind ja dem Tode unmittelbar nahe, nichts von
allem, was sie sagen und tun, hat volles Gewicht. In dieser ausgehöhlten und inner-
lich erstorbenen Welt taucht dann in dem Traum Hans Castorps im Schnee einmal
das Bild echten und tiefen Lebens auf, um zu versinken, wie in den Buddenbrooks.
Auch hier ist die künstlerische Dynamik dieses Kapitels nicht gesehen. Und auch
dem Inhalt der Vision wird der Verfasser nicht gerecht. Der Tod soll nicht abge-
wehrt, ihm soll „die Treue gehalten" werden, die Liebe zum Tod soll zur Liebe des
Lebens und der Menschen führen.
Kasdorff vergleicht Thomas Mann häufig mit Friedrich Huch und hebt über-
zeugend hervor, daß Huchs Gestalten aus innerer Fülle dem äußeren Leben ent-
BESPRECHUNGEN
Wille und Vorstellung ist, verinnerlichen sich bis zur „Entseelung des Leibes".
Thomas Buddenbrook leidet an seinem Willen, der ihn „dem Leben entfremdet".
Das Schopenhauer-Erlebnis bestätigt ihm die Entwertung des Lebens, aber die
Hoffnung auf das Fortleben in einem andern, stärkeren Ich stammt von Nietzsche.
Für seinen wirklichen Tod aber hat dies Erlebnis keine Bedeutung, sein Tod ist
der Höhepunkt der „Verinnerlichung". Bei genauerer Betrachtung erscheint dieser
Begriff, auf Thomas Manns Gestalten angewandt, doch etwas gewaltsam kon-
struiert. Stirbt denn Thomas Buddenbrook auf der Höhe seiner Willenskraft?
Er leidet nicht an überstarkem, sondern an versagendem Willen. Er muß seinen
Willen künstlich spornen; er sagt selbst einmal, daß der Schwung, mit dem er
zuerst seine Unternehmungen angriff, aus der Reflexion stammt. Und an der
Aushöhlung seines Willens und seiner Lebenskraft stirbt er. Das Schopenhauer-
Erlebnis aber ist nicht nur eine philosophische Reminiszenz. Thomas Buddenbrook
taucht hier für einen Augenblick in eine tiefere Lebensschicht ein; sein Leiden am
Leben öffnet ihm den Blick in eine das Leben übergreifende Weltansicht und
macht ihn für diesen Augenblick schöpferisch. Dann sinkt er zurück, seine Kraft
reicht nicht, das Geschenk zu halten. Der Gegensatz zwischen diesem versinken-
den Moment und dem durch die Leere und Hoffnungslosigkeit des Lebens bestimm-
ten Gesamtbild des Romans ist in seiner künstlerischen Wirkung nicht erkannt
worden: er läßt das Leben noch dunkler erscheinen und öffnet doch einen Aus-
blick darüber hinaus.
Während in den folgenden Novellen das Verhältnis zum Tode im wesentlichen
dasselbe bleibt, soll dann im Zauberberg die Überwindung der Sympathie mit
dem Tode dargestellt sein. Im Schneesturm findet Hans Castorp den genialen
Weg zum Leben durch die Überwindung des Todesgedankens. Doch ist diese
Wendung keine Entwicklung, sondern nur eine Umkehrung: das Leben als bloße
Existenz, ohne tieferen Inhalt, das vorher verneint wurde, wird jetzt bejaht; es
soll geschützt und gefördert werden, der Tod soll im Herzen eingeschlossen und
dadurch unschädlich gemacht werden. Hier wie dort eine rein rationalistische Auf-
fassung des Lebens, für die der Tod nur den Abschluß bedeutet. Diese Deutung
vereinfacht doch zu sehr. Es handelt sich im Zauberberg gar nicht um eine Abwen-
dung vom Tode. Hans Castorp geht ja den „genialen Weg" nicht wirklich, noch
weniger nimmt er den Fortschrittsglauben Settembrinis an; beides wird übrigens
in der Untersuchung selbst hervorgehoben. Auch im Zauberberg wird, deutlicher
und betonter noch als in den Buddenbrooks, das dem Tode verfallene Leben
gezeichnet. Daß „alles Interesse für Tod und Krankheit nichts ist als eine Art
von Ausdruck für das am Leben", ist nicht nur eine Umschreibung des ärztlichen
Berufsinteresses und bedeutet nicht die Bekehrung von der Sympathie mit dem Tode
zu einem reinen Nützlichkeitsstandpunkt. Es bedeutet, daß in dieser Welt das Inter-
esse am Leben nur als Interesse an Tod und Krankheit erscheinen kann. Die Ironie
ist nicht erkannt, die, ebenso wie in den Buddenbrooks, die gesamte Darstellung
bestimmt. Alle Gestalten des Romans sind ja dem Tode unmittelbar nahe, nichts von
allem, was sie sagen und tun, hat volles Gewicht. In dieser ausgehöhlten und inner-
lich erstorbenen Welt taucht dann in dem Traum Hans Castorps im Schnee einmal
das Bild echten und tiefen Lebens auf, um zu versinken, wie in den Buddenbrooks.
Auch hier ist die künstlerische Dynamik dieses Kapitels nicht gesehen. Und auch
dem Inhalt der Vision wird der Verfasser nicht gerecht. Der Tod soll nicht abge-
wehrt, ihm soll „die Treue gehalten" werden, die Liebe zum Tod soll zur Liebe des
Lebens und der Menschen führen.
Kasdorff vergleicht Thomas Mann häufig mit Friedrich Huch und hebt über-
zeugend hervor, daß Huchs Gestalten aus innerer Fülle dem äußeren Leben ent-