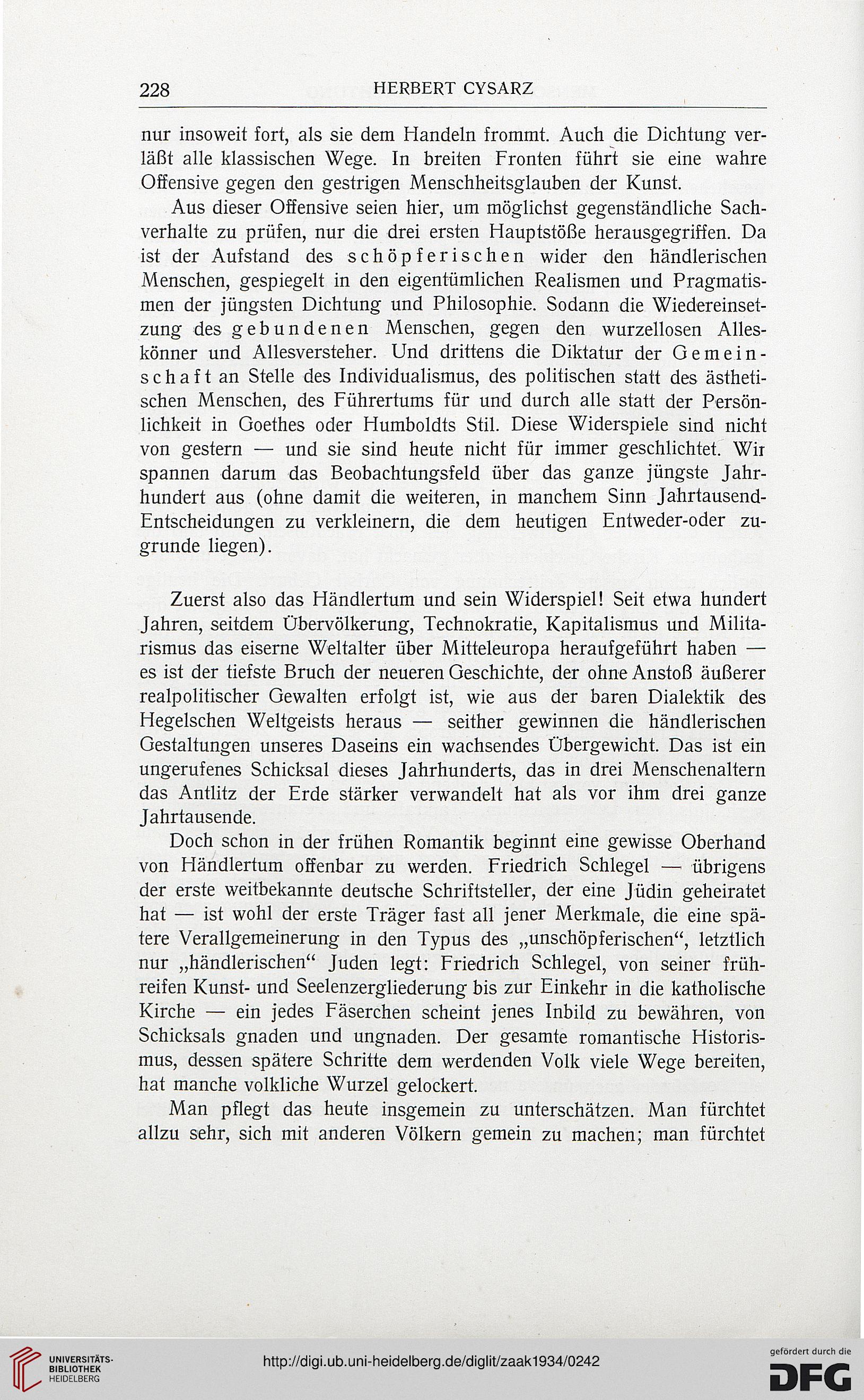228
HERBERT CYSARZ
nur insoweit fort, als sie dem Handeln frommt. Auch die Dichtung ver-
läßt alle klassischen Wege. In breiten Fronten führt sie eine wahre
Offensive gegen den gestrigen Menschheitsglauben der Kunst.
Aus dieser Offensive seien hier, um möglichst gegenständliche Sach-
verhalte zu prüfen, nur die drei ersten Hauptstöße herausgegriffen. Da
ist der Aufstand des schöpferischen wider den händlerischen
Menschen, gespiegelt in den eigentümlichen Realismen und Pragmatis-
men der jüngsten Dichtung und Philosophie. Sodann die Wiedereinset-
zung des gebundenen Menschen, gegen den wurzellosen Alles-
könner und Allesversteher. Und drittens die Diktatur der Gemein-
schaft an Stelle des Individualismus, des politischen statt des ästheti-
schen Menschen, des Führertums für und durch alle statt der Persön-
lichkeit in Goethes oder Humboldts Stil. Diese Widerspiele sind nicht
von gestern — und sie sind heute nicht für immer geschlichtet. Wir
spannen darum das Beobachtungsfeld über das ganze jüngste Jahr-
hundert aus (ohne damit die weiteren, in manchem Sinn Jahrtausend-
Entscheidungen zu verkleinern, die dem heutigen Entweder-oder zu-
grunde liegen).
Zuerst also das Händlertum und sein Widerspiel! Seit etwa hundert
Jahren, seitdem Übervölkerung, Technokratie, Kapitalismus und Milita-
rismus das eiserne Weltalter über Mitteleuropa heraufgeführt haben —
es ist der tiefste Bruch der neueren Geschichte, der ohne Anstoß äußerer
realpolitischer Gewalten erfolgt ist, wie aus der baren Dialektik des
Hegeischen Weltgeists heraus — seither gewinnen die händlerischen
Gestaltungen unseres Daseins ein wachsendes Übergewicht. Das ist ein
ungerufenes Schicksal dieses Jahrhunderts, das in drei Menschenaltern
das Antlitz der Erde stärker verwandelt hat als vor ihm drei ganze
Jahrtausende.
Doch schon in der frühen Romantik beginnt eine gewisse Oberhand
von Händlertum offenbar zu werden. Friedrich Schlegel — übrigens
der erste weitbekannte deutsche Schriftsteller, der eine Jüdin geheiratet
hat — ist wohl der erste Träger fast all jener Merkmale, die eine spä-
tere Verallgemeinerung in den Typus des „unschöpferischen", letztlich
nur „händlerischen" Juden legt: Friedrich Schlegel, von seiner früh-
reifen Kunst- und Seelenzergliederung bis zur Einkehr in die katholische
Kirche — ein jedes Fäserchen scheint jenes Inbild zu bewähren, von
Schicksals gnaden und Ungnaden. Der gesamte romantische Historis-
mus, dessen spätere Schritte dem werdenden Volk viele Wege bereiten,
hat manche volkliche Wurzel gelockert.
Man pflegt das heute insgemein zu unterschätzen. Man fürchtet
allzu sehr, sich mit anderen Völkern gemein zu machen; man fürchtet
HERBERT CYSARZ
nur insoweit fort, als sie dem Handeln frommt. Auch die Dichtung ver-
läßt alle klassischen Wege. In breiten Fronten führt sie eine wahre
Offensive gegen den gestrigen Menschheitsglauben der Kunst.
Aus dieser Offensive seien hier, um möglichst gegenständliche Sach-
verhalte zu prüfen, nur die drei ersten Hauptstöße herausgegriffen. Da
ist der Aufstand des schöpferischen wider den händlerischen
Menschen, gespiegelt in den eigentümlichen Realismen und Pragmatis-
men der jüngsten Dichtung und Philosophie. Sodann die Wiedereinset-
zung des gebundenen Menschen, gegen den wurzellosen Alles-
könner und Allesversteher. Und drittens die Diktatur der Gemein-
schaft an Stelle des Individualismus, des politischen statt des ästheti-
schen Menschen, des Führertums für und durch alle statt der Persön-
lichkeit in Goethes oder Humboldts Stil. Diese Widerspiele sind nicht
von gestern — und sie sind heute nicht für immer geschlichtet. Wir
spannen darum das Beobachtungsfeld über das ganze jüngste Jahr-
hundert aus (ohne damit die weiteren, in manchem Sinn Jahrtausend-
Entscheidungen zu verkleinern, die dem heutigen Entweder-oder zu-
grunde liegen).
Zuerst also das Händlertum und sein Widerspiel! Seit etwa hundert
Jahren, seitdem Übervölkerung, Technokratie, Kapitalismus und Milita-
rismus das eiserne Weltalter über Mitteleuropa heraufgeführt haben —
es ist der tiefste Bruch der neueren Geschichte, der ohne Anstoß äußerer
realpolitischer Gewalten erfolgt ist, wie aus der baren Dialektik des
Hegeischen Weltgeists heraus — seither gewinnen die händlerischen
Gestaltungen unseres Daseins ein wachsendes Übergewicht. Das ist ein
ungerufenes Schicksal dieses Jahrhunderts, das in drei Menschenaltern
das Antlitz der Erde stärker verwandelt hat als vor ihm drei ganze
Jahrtausende.
Doch schon in der frühen Romantik beginnt eine gewisse Oberhand
von Händlertum offenbar zu werden. Friedrich Schlegel — übrigens
der erste weitbekannte deutsche Schriftsteller, der eine Jüdin geheiratet
hat — ist wohl der erste Träger fast all jener Merkmale, die eine spä-
tere Verallgemeinerung in den Typus des „unschöpferischen", letztlich
nur „händlerischen" Juden legt: Friedrich Schlegel, von seiner früh-
reifen Kunst- und Seelenzergliederung bis zur Einkehr in die katholische
Kirche — ein jedes Fäserchen scheint jenes Inbild zu bewähren, von
Schicksals gnaden und Ungnaden. Der gesamte romantische Historis-
mus, dessen spätere Schritte dem werdenden Volk viele Wege bereiten,
hat manche volkliche Wurzel gelockert.
Man pflegt das heute insgemein zu unterschätzen. Man fürchtet
allzu sehr, sich mit anderen Völkern gemein zu machen; man fürchtet