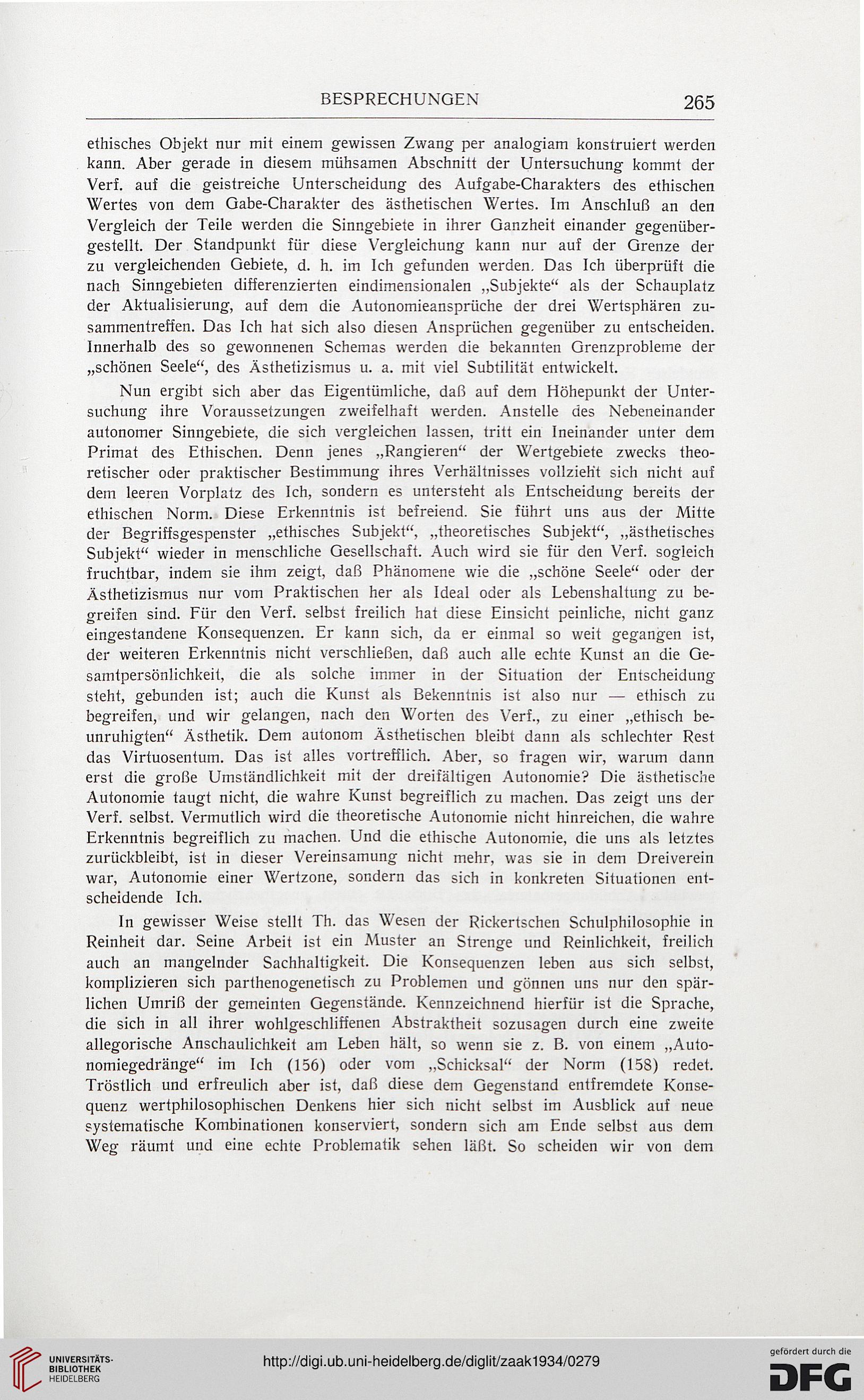BESPRECHUNGEN
265
ethisches Objekt nur mit einem gewissen Zwang per analogiam konstruiert werden
kann. Aber gerade in diesem mühsamen Abschnitt der Untersuchung kommt der
Verf. auf die geistreiche Unterscheidung des Aufgabe-Charakters des ethischen
Wertes von dem Gabe-Charakter des ästhetischen Wertes. Im Anschluß an den
Vergleich der Teile werden die Sinngebiete in ihrer Ganzheit einander gegenüber-
gestellt. Der Standpunkt für diese Vergleichung kann nur auf der Grenze der
zu vergleichenden Gebiete, d. h. im Ich gefunden werden. Das Ich überprüft die
nach Sinngebieten differenzierten eindimensionalen „Subjekte" als der Schauplatz
der Aktualisierung, auf dem die Autonomieansprüche der drei Wertsphären zu-
sammentreffen. Das Ich hat sich also diesen Ansprüchen gegenüber zu entscheiden.
Innerhalb des so gewonnenen Schemas werden die bekannten Grenzprobleme der
„schönen Seele", des Ästhetizismus u. a. mit viel Subtilität entwickelt.
Nun ergibt sich aber das Eigentümliche, daß auf dem Höhepunkt der Unter-
suchung ihre Voraussetzungen zweifelhaft werden. Anstelle des Nebeneinander
autonomer Sinngebiete, die sich vergleichen lassen, tritt ein Ineinander unter dem
Primat des Ethischen. Denn jenes „Rangieren" der Wertgebiete zwecks theo-
retischer oder praktischer Bestimmung ihres Verhältnisses vollzieht sich nicht auf
dem leeren Vorplatz des Ich, sondern es untersteht als Entscheidung bereits der
ethischen Norm. Diese Erkenntnis ist befreiend. Sie führt uns aus der Mitte
der Begriffsgespenster „ethisches Subjekt", „theoretisches Subjekt", „ästhetisches
Subjekt" wieder in menschliche Gesellschaft. Auch wird sie für den Verf. sogleich
fruchtbar, indem sie ihm zeigt, daß Phänomene wie die „schöne Seele" oder der
Ästhetizismus nur vom Praktischen her als Ideal oder als Lebenshaltung zu be-
greifen sind. Für den Verf. selbst freilich hat diese Einsicht peinliche, nicht ganz
eingestandene Konsequenzen. Er kann sich, da er einmal so weit gegangen ist,
der weiteren Erkenntnis nicht verschließen, daß auch alle echte Kunst an die Ge-
samtpersönlichkeit, die als solche immer in der Situation der Entscheidung
steht, gebunden ist; auch die Kunst als Bekenntnis ist also nur — ethisch zu
begreifen, und wir gelangen, nach den Worten des Verf., zu einer „ethisch be-
unruhigten" Ästhetik. Dem autonom Ästhetischen bleibt dann als schlechter Rest
das Virtuosentum. Das ist alles vortrefflich. Aber, so fragen wir, warum dann
erst die große Umständlichkeit mit der dreifältigen Autonomie? Die ästhetische
Autonomie taugt nicht, die wahre Kunst begreiflich zu machen. Das zeigt uns der
Verf. selbst. Vermutlich wird die theoretische Autonomie nicht hinreichen, die wahre
Erkenntnis begreiflich zu machen. Und die ethische Autonomie, die uns als letztes
zurückbleibt, ist in dieser Vereinsamung nicht mehr, was sie in dem Dreiverein
war, Autonomie einer Wertzone, sondern das sich in konkreten Situationen ent-
scheidende Ich.
In gewisser Weise stellt Th. das Wesen der Rickertschen Schulphilosophie in
Reinheit dar. Seine Arbeit ist ein Muster an Strenge und Reinlichkeit, freilich
auch an mangelnder Sachhaltigkeit. Die Konsequenzen leben aus sich selbst,
komplizieren sich parthenogenetisch zu Problemen und gönnen uns nur den spär-
lichen Umriß der gemeinten Gegenstände. Kennzeichnend hierfür ist die Sprache,
die sich in all ihrer wohlgeschliffenen Abstraktheit sozusagen durch eine zweite
allegorische Anschaulichkeit am Leben hält, so wenn sie z. B. von einem „Auto-
nomiegedränge" im Ich (156) oder vom „Schicksal" der Norm (158) redet.
Tröstlich und erfreulich aber ist, daß diese dem Gegenstand entfremdete Konse-
quenz wertphilosophischen Denkens hier sich nicht selbst im Ausblick auf neue
systematische Kombinationen konserviert, sondern sich am Ende selbst aus dem
Weg räumt und eine echte Problematik sehen läßt. So scheiden wir von dem
265
ethisches Objekt nur mit einem gewissen Zwang per analogiam konstruiert werden
kann. Aber gerade in diesem mühsamen Abschnitt der Untersuchung kommt der
Verf. auf die geistreiche Unterscheidung des Aufgabe-Charakters des ethischen
Wertes von dem Gabe-Charakter des ästhetischen Wertes. Im Anschluß an den
Vergleich der Teile werden die Sinngebiete in ihrer Ganzheit einander gegenüber-
gestellt. Der Standpunkt für diese Vergleichung kann nur auf der Grenze der
zu vergleichenden Gebiete, d. h. im Ich gefunden werden. Das Ich überprüft die
nach Sinngebieten differenzierten eindimensionalen „Subjekte" als der Schauplatz
der Aktualisierung, auf dem die Autonomieansprüche der drei Wertsphären zu-
sammentreffen. Das Ich hat sich also diesen Ansprüchen gegenüber zu entscheiden.
Innerhalb des so gewonnenen Schemas werden die bekannten Grenzprobleme der
„schönen Seele", des Ästhetizismus u. a. mit viel Subtilität entwickelt.
Nun ergibt sich aber das Eigentümliche, daß auf dem Höhepunkt der Unter-
suchung ihre Voraussetzungen zweifelhaft werden. Anstelle des Nebeneinander
autonomer Sinngebiete, die sich vergleichen lassen, tritt ein Ineinander unter dem
Primat des Ethischen. Denn jenes „Rangieren" der Wertgebiete zwecks theo-
retischer oder praktischer Bestimmung ihres Verhältnisses vollzieht sich nicht auf
dem leeren Vorplatz des Ich, sondern es untersteht als Entscheidung bereits der
ethischen Norm. Diese Erkenntnis ist befreiend. Sie führt uns aus der Mitte
der Begriffsgespenster „ethisches Subjekt", „theoretisches Subjekt", „ästhetisches
Subjekt" wieder in menschliche Gesellschaft. Auch wird sie für den Verf. sogleich
fruchtbar, indem sie ihm zeigt, daß Phänomene wie die „schöne Seele" oder der
Ästhetizismus nur vom Praktischen her als Ideal oder als Lebenshaltung zu be-
greifen sind. Für den Verf. selbst freilich hat diese Einsicht peinliche, nicht ganz
eingestandene Konsequenzen. Er kann sich, da er einmal so weit gegangen ist,
der weiteren Erkenntnis nicht verschließen, daß auch alle echte Kunst an die Ge-
samtpersönlichkeit, die als solche immer in der Situation der Entscheidung
steht, gebunden ist; auch die Kunst als Bekenntnis ist also nur — ethisch zu
begreifen, und wir gelangen, nach den Worten des Verf., zu einer „ethisch be-
unruhigten" Ästhetik. Dem autonom Ästhetischen bleibt dann als schlechter Rest
das Virtuosentum. Das ist alles vortrefflich. Aber, so fragen wir, warum dann
erst die große Umständlichkeit mit der dreifältigen Autonomie? Die ästhetische
Autonomie taugt nicht, die wahre Kunst begreiflich zu machen. Das zeigt uns der
Verf. selbst. Vermutlich wird die theoretische Autonomie nicht hinreichen, die wahre
Erkenntnis begreiflich zu machen. Und die ethische Autonomie, die uns als letztes
zurückbleibt, ist in dieser Vereinsamung nicht mehr, was sie in dem Dreiverein
war, Autonomie einer Wertzone, sondern das sich in konkreten Situationen ent-
scheidende Ich.
In gewisser Weise stellt Th. das Wesen der Rickertschen Schulphilosophie in
Reinheit dar. Seine Arbeit ist ein Muster an Strenge und Reinlichkeit, freilich
auch an mangelnder Sachhaltigkeit. Die Konsequenzen leben aus sich selbst,
komplizieren sich parthenogenetisch zu Problemen und gönnen uns nur den spär-
lichen Umriß der gemeinten Gegenstände. Kennzeichnend hierfür ist die Sprache,
die sich in all ihrer wohlgeschliffenen Abstraktheit sozusagen durch eine zweite
allegorische Anschaulichkeit am Leben hält, so wenn sie z. B. von einem „Auto-
nomiegedränge" im Ich (156) oder vom „Schicksal" der Norm (158) redet.
Tröstlich und erfreulich aber ist, daß diese dem Gegenstand entfremdete Konse-
quenz wertphilosophischen Denkens hier sich nicht selbst im Ausblick auf neue
systematische Kombinationen konserviert, sondern sich am Ende selbst aus dem
Weg räumt und eine echte Problematik sehen läßt. So scheiden wir von dem