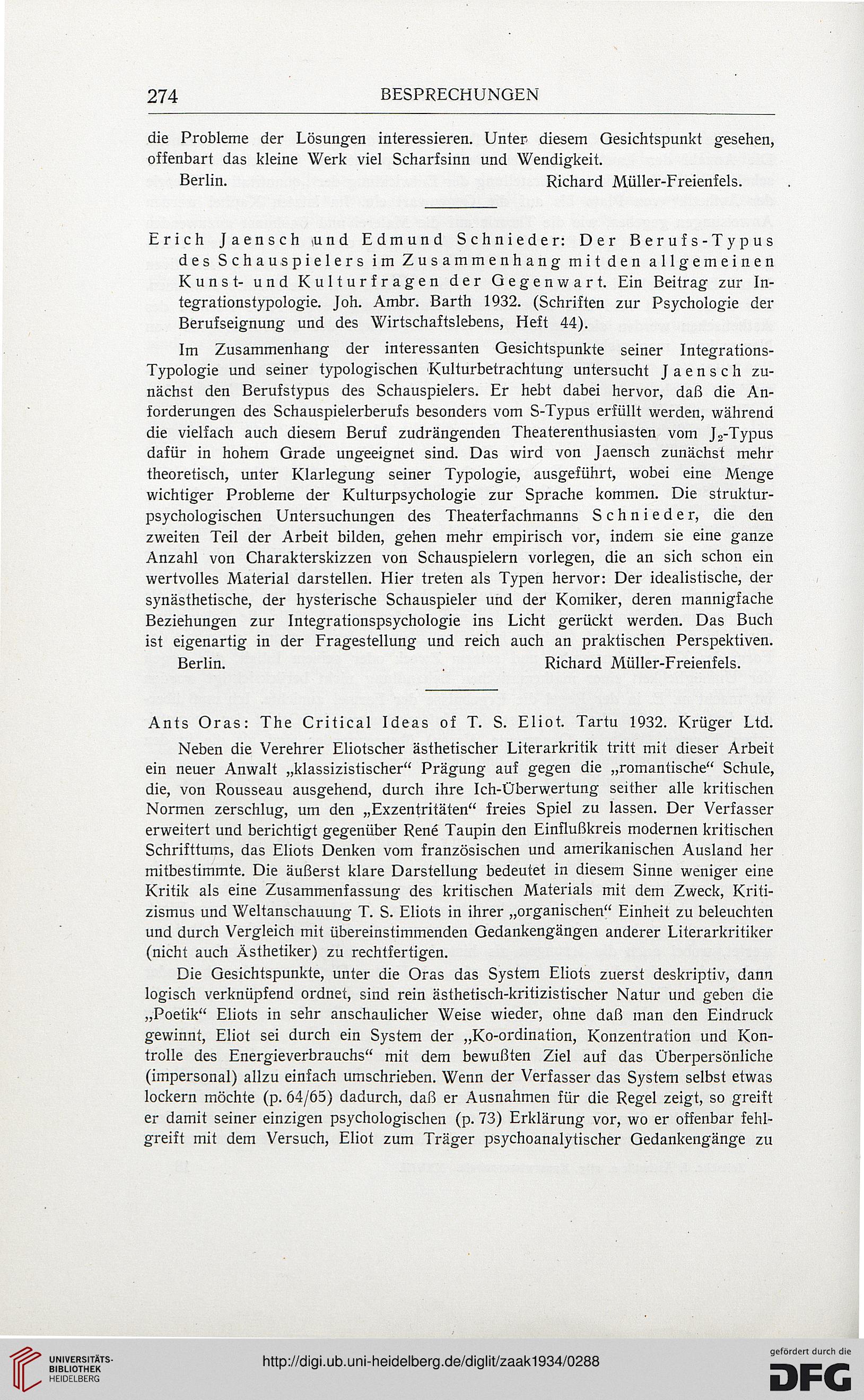274
BESPRECHUNGEN
die Probleme der Lösungen interessieren. Unter diesem Gesichtspunkt gesehen,
offenbart das kleine Werk viel Scharfsinn und Wendigkeit.
Berlin. Richard Müller-Freienfels.
Erich Jaensch und Edmund Schnieder: Der Berufs-Typus
des Schauspielers im Zusammenhang mit den allgemeinen
Kunst- und Kulturfragen der Gegenwart. Ein Beitrag zur In-
tegrationstypologie. Joh. Ambr. Barth 1932. (Schriften zur Psychologie der
Berufseignung und des Wirtschaftslebens, Heft 44).
Im Zusammenhang der interessanten Gesichtspunkte seiner Integrations-
Typologie und seiner typologischen Kulturbetrachtung untersucht Jaensch zu-
nächst den Berufstypus des Schauspielers. Er hebt dabei hervor, daß die An-
forderungen des Schauspielerberufs besonders vom S-Typus erfüllt werden, während
die vielfach auch diesem Beruf zudrängenden Theaterenthusiasten vom J2-Typus
dafür in hohem Grade ungeeignet sind. Das wird von Jaensch zunächst mehr
theoretisch, unter Klarlegung seiner Typologie, ausgeführt, wobei eine Menge
wichtiger Probleme der Kulturpsychologie zur Sprache kommen. Die struktur-
psychologischen Untersuchungen des Theaterfachmanns Schnieder, die den
zweiten Teil der Arbeit bilden, gehen mehr empirisch vor, indem sie eine ganze
Anzahl von Charakterskizzen von Schauspielern vorlegen, die an sich schon ein
wertvolles Material darstellen. Hier treten als Typen hervor: Der idealistische, der
synästhetische, der hysterische Schauspieler und der Komiker, deren mannigfache
Beziehungen zur Integrationspsychologie ins Licht gerückt werden. Das Buch
ist eigenartig in der Fragestellung und reich auch an praktischen Perspektiven.
Berlin. . Richard Müller-Freienfels.
Ants Oras: The Critical Ideas of T. S. Eliot. Tartu 1932. Krüger Ltd.
Neben die Verehrer Eliotscher ästhetischer Literarkritik tritt mit dieser Arbeit
ein neuer Anwalt „klassizistischer" Prägung auf gegen die „romantische" Schule,
die, von Rousseau ausgehend, durch ihre Ich-Überwertung seither alle kritischen
Normen zerschlug, um den „Exzentritäten" freies Spiel zu lassen. Der Verfasser
erweitert und berichtigt gegenüber Rene Taupin den Einflußkreis modernen kritischen
Schrifttums, das Eliots Denken vom französischen und amerikanischen Ausland her
mitbestimmte. Die äußerst klare Darstellung bedeutet in diesem Sinne weniger eine
Kritik als eine Zusammenfassung des kritischen Materials mit dem Zweck, Kriti-
zismus und Weltanschauung T. S. Eliots in ihrer „organischen" Einheit zu beleuchten
und durch Vergleich mit übereinstimmenden Gedankengängen anderer Literarkritiker
(nicht auch Ästhetiker) zu rechtfertigen.
Die Gesichtspunkte, unter die Oras das System Eliots zuerst deskriptiv, dann
logisch verknüpfend ordnet, sind rein ästhetisch-kritizistischer Natur und geben die
„Poetik" Eliots in sehr anschaulicher Weise wieder, ohne daß man den Eindruck
gewinnt, Eliot sei durch ein System der „Ko-ordination, Konzentration und Kon-
trolle des Energieverbrauchs" mit dem bewußten Ziel auf das Überpersönliche
(impersonal) allzu einfach umschrieben. Wenn der Verfasser das System selbst etwas
lockern möchte (p. 64/65) dadurch, daß er Ausnahmen für die Regel zeigt, so greift
er damit seiner einzigen psychologischen (p. 73) Erklärung vor, wo er offenbar fehl-
greift mit dem Versuch, Eliot zum Träger psychoanalytischer Gedankengänge zu
BESPRECHUNGEN
die Probleme der Lösungen interessieren. Unter diesem Gesichtspunkt gesehen,
offenbart das kleine Werk viel Scharfsinn und Wendigkeit.
Berlin. Richard Müller-Freienfels.
Erich Jaensch und Edmund Schnieder: Der Berufs-Typus
des Schauspielers im Zusammenhang mit den allgemeinen
Kunst- und Kulturfragen der Gegenwart. Ein Beitrag zur In-
tegrationstypologie. Joh. Ambr. Barth 1932. (Schriften zur Psychologie der
Berufseignung und des Wirtschaftslebens, Heft 44).
Im Zusammenhang der interessanten Gesichtspunkte seiner Integrations-
Typologie und seiner typologischen Kulturbetrachtung untersucht Jaensch zu-
nächst den Berufstypus des Schauspielers. Er hebt dabei hervor, daß die An-
forderungen des Schauspielerberufs besonders vom S-Typus erfüllt werden, während
die vielfach auch diesem Beruf zudrängenden Theaterenthusiasten vom J2-Typus
dafür in hohem Grade ungeeignet sind. Das wird von Jaensch zunächst mehr
theoretisch, unter Klarlegung seiner Typologie, ausgeführt, wobei eine Menge
wichtiger Probleme der Kulturpsychologie zur Sprache kommen. Die struktur-
psychologischen Untersuchungen des Theaterfachmanns Schnieder, die den
zweiten Teil der Arbeit bilden, gehen mehr empirisch vor, indem sie eine ganze
Anzahl von Charakterskizzen von Schauspielern vorlegen, die an sich schon ein
wertvolles Material darstellen. Hier treten als Typen hervor: Der idealistische, der
synästhetische, der hysterische Schauspieler und der Komiker, deren mannigfache
Beziehungen zur Integrationspsychologie ins Licht gerückt werden. Das Buch
ist eigenartig in der Fragestellung und reich auch an praktischen Perspektiven.
Berlin. . Richard Müller-Freienfels.
Ants Oras: The Critical Ideas of T. S. Eliot. Tartu 1932. Krüger Ltd.
Neben die Verehrer Eliotscher ästhetischer Literarkritik tritt mit dieser Arbeit
ein neuer Anwalt „klassizistischer" Prägung auf gegen die „romantische" Schule,
die, von Rousseau ausgehend, durch ihre Ich-Überwertung seither alle kritischen
Normen zerschlug, um den „Exzentritäten" freies Spiel zu lassen. Der Verfasser
erweitert und berichtigt gegenüber Rene Taupin den Einflußkreis modernen kritischen
Schrifttums, das Eliots Denken vom französischen und amerikanischen Ausland her
mitbestimmte. Die äußerst klare Darstellung bedeutet in diesem Sinne weniger eine
Kritik als eine Zusammenfassung des kritischen Materials mit dem Zweck, Kriti-
zismus und Weltanschauung T. S. Eliots in ihrer „organischen" Einheit zu beleuchten
und durch Vergleich mit übereinstimmenden Gedankengängen anderer Literarkritiker
(nicht auch Ästhetiker) zu rechtfertigen.
Die Gesichtspunkte, unter die Oras das System Eliots zuerst deskriptiv, dann
logisch verknüpfend ordnet, sind rein ästhetisch-kritizistischer Natur und geben die
„Poetik" Eliots in sehr anschaulicher Weise wieder, ohne daß man den Eindruck
gewinnt, Eliot sei durch ein System der „Ko-ordination, Konzentration und Kon-
trolle des Energieverbrauchs" mit dem bewußten Ziel auf das Überpersönliche
(impersonal) allzu einfach umschrieben. Wenn der Verfasser das System selbst etwas
lockern möchte (p. 64/65) dadurch, daß er Ausnahmen für die Regel zeigt, so greift
er damit seiner einzigen psychologischen (p. 73) Erklärung vor, wo er offenbar fehl-
greift mit dem Versuch, Eliot zum Träger psychoanalytischer Gedankengänge zu