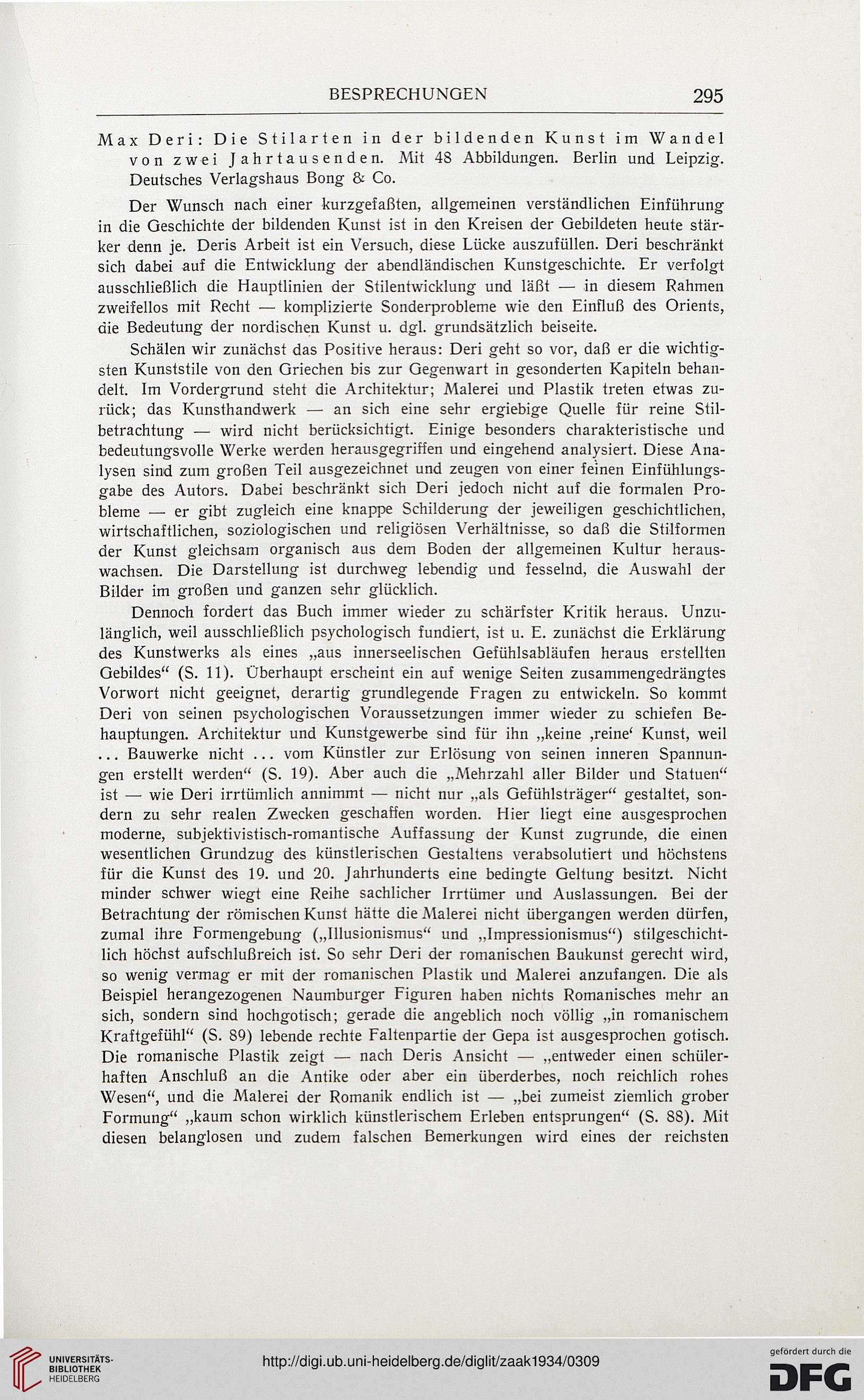BESPRECHUNGEN
295
Max Deri: Die Stilarten in der bildenden Kunst im Wandel
von zwei Jahrtausenden. Mit 48 Abbildungen. Berlin und Leipzig.
Deutsches Verlagshaus Bong & Co.
Der Wunsch nach einer kurzgefaßten, allgemeinen verständlichen Einführung
in die Geschichte der bildenden Kunst ist in den Kreisen der Gebildeten heute stär-
ker denn je. Deris Arbeit ist ein Versuch, diese Lücke auszufüllen. Deri beschränkt
sich dabei auf die Entwicklung der abendländischen Kunstgeschichte. Er verfolgt
ausschließlich die Hauptlinien der Stilentwicklung und läßt — in diesem Rahmen
zweifellos mit Recht — komplizierte Sonderprobleme wie den Einfluß des Orients,
die Bedeutung der nordischen Kunst u. dgl. grundsätzlich beiseite.
Schälen wir zunächst das Positive heraus: Deri geht so vor, daß er die wichtig-
sten Kunststile von den Griechen bis zur Gegenwart in gesonderten Kapiteln behan-
delt. Im Vordergrund steht die Architektur; Malerei und Plastik treten etwas zu-
rück; das Kunsthandwerk — an sich eine sehr ergiebige Quelle für reine Stil-
betrachtung — wird nicht berücksichtigt. Einige besonders charakteristische und
bedeutungsvolle Werke werden herausgegriffen und eingehend analysiert. Diese Ana-
lysen sind zum großen Teil ausgezeichnet und zeugen von einer feinen Einfühlungs-
gabe des Autors. Dabei beschränkt sich Deri jedoch nicht auf die formalen Pro-
bleme — er gibt zugleich eine knappe Schilderung der jeweiligen geschichtlichen,
wirtschaftlichen, soziologischen und religiösen Verhältnisse, so daß die Stilformen
der Kunst gleichsam organisch aus dem Boden der allgemeinen Kultur heraus-
wachsen. Die Darstellung ist durchweg lebendig und fesselnd, die Auswahl der
Bilder im großen und ganzen sehr glücklich.
Dennoch fordert das Buch immer wieder zu schärfster Kritik heraus. Unzu-
länglich, weil ausschließlich psychologisch fundiert, ist u. E. zunächst die Erklärung
des Kunstwerks als eines „aus innerseelischen Gefühlsabläufen heraus erstellten
Gebildes" (S. 11). Überhaupt erscheint ein auf wenige Seiten zusammengedrängtes
Vorwort nicht geeignet, derartig grundlegende Fragen zu entwickeln. So kommt
Deri von seinen psychologischen Voraussetzungen immer wieder zu schiefen Be-
hauptungen. Architektur und Kunstgewerbe sind für ihn „keine ,reine' Kunst, weil
... Bauwerke nicht ... vom Künstler zur Erlösung von seinen inneren Spannun-
gen erstellt werden" (S. 1°). Aber auch die „Mehrzahl aller Bilder und Statuen"
ist — wie Deri irrtümlich annimmt — nicht nur „als Gefühlsträger" gestaltet, son-
dern zu sehr realen Zwecken geschaffen worden. Hier liegt eine ausgesprochen
moderne, subjektivistisch-romantische Auffassung der Kunst zugrunde, die einen
wesentlichen Grundzug des künstlerischen Gestaltens verabsolutiert und höchstens
für die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts eine bedingte Geltung besitzt. Nicht
minder schwer wiegt eine Reihe sachlicher Irrtümer und Auslassungen. Bei der
Betrachtung der römischen Kunst hätte die Malerei nicht übergangen werden dürfen,
zumal ihre Formengebung („Illusionismus" und „Impressionismus") stilgeschicht-
lich höchst aufschlußreich ist. So sehr Deri der romanischen Baukunst gerecht wird,
so wenig vermag er mit der romanischen Plastik und Malerei anzufangen. Die als
Beispiel herangezogenen Naumburger Figuren haben nichts Romanisches mehr an
sich, sondern sind hochgotisch; gerade die angeblich noch völlig „in romanischem
Kraftgefühl" (S. 89) lebende rechte Faltenpartie der Gepa ist ausgesprochen gotisch.
Die romanische Plastik zeigt — nach Deris Ansicht — „entweder einen schüler-
haften Anschluß an die Antike oder aber ein überderbes, noch reichlich rohes
Wesen", und die Malerei der Romanik endlich ist — „bei zumeist ziemlich grober
Formung" „kaum schon wirklich künstlerischem Erleben entsprungen" (S. 88). Mit
diesen belanglosen und zudem falschen Bemerkungen wird eines der reichsten
295
Max Deri: Die Stilarten in der bildenden Kunst im Wandel
von zwei Jahrtausenden. Mit 48 Abbildungen. Berlin und Leipzig.
Deutsches Verlagshaus Bong & Co.
Der Wunsch nach einer kurzgefaßten, allgemeinen verständlichen Einführung
in die Geschichte der bildenden Kunst ist in den Kreisen der Gebildeten heute stär-
ker denn je. Deris Arbeit ist ein Versuch, diese Lücke auszufüllen. Deri beschränkt
sich dabei auf die Entwicklung der abendländischen Kunstgeschichte. Er verfolgt
ausschließlich die Hauptlinien der Stilentwicklung und läßt — in diesem Rahmen
zweifellos mit Recht — komplizierte Sonderprobleme wie den Einfluß des Orients,
die Bedeutung der nordischen Kunst u. dgl. grundsätzlich beiseite.
Schälen wir zunächst das Positive heraus: Deri geht so vor, daß er die wichtig-
sten Kunststile von den Griechen bis zur Gegenwart in gesonderten Kapiteln behan-
delt. Im Vordergrund steht die Architektur; Malerei und Plastik treten etwas zu-
rück; das Kunsthandwerk — an sich eine sehr ergiebige Quelle für reine Stil-
betrachtung — wird nicht berücksichtigt. Einige besonders charakteristische und
bedeutungsvolle Werke werden herausgegriffen und eingehend analysiert. Diese Ana-
lysen sind zum großen Teil ausgezeichnet und zeugen von einer feinen Einfühlungs-
gabe des Autors. Dabei beschränkt sich Deri jedoch nicht auf die formalen Pro-
bleme — er gibt zugleich eine knappe Schilderung der jeweiligen geschichtlichen,
wirtschaftlichen, soziologischen und religiösen Verhältnisse, so daß die Stilformen
der Kunst gleichsam organisch aus dem Boden der allgemeinen Kultur heraus-
wachsen. Die Darstellung ist durchweg lebendig und fesselnd, die Auswahl der
Bilder im großen und ganzen sehr glücklich.
Dennoch fordert das Buch immer wieder zu schärfster Kritik heraus. Unzu-
länglich, weil ausschließlich psychologisch fundiert, ist u. E. zunächst die Erklärung
des Kunstwerks als eines „aus innerseelischen Gefühlsabläufen heraus erstellten
Gebildes" (S. 11). Überhaupt erscheint ein auf wenige Seiten zusammengedrängtes
Vorwort nicht geeignet, derartig grundlegende Fragen zu entwickeln. So kommt
Deri von seinen psychologischen Voraussetzungen immer wieder zu schiefen Be-
hauptungen. Architektur und Kunstgewerbe sind für ihn „keine ,reine' Kunst, weil
... Bauwerke nicht ... vom Künstler zur Erlösung von seinen inneren Spannun-
gen erstellt werden" (S. 1°). Aber auch die „Mehrzahl aller Bilder und Statuen"
ist — wie Deri irrtümlich annimmt — nicht nur „als Gefühlsträger" gestaltet, son-
dern zu sehr realen Zwecken geschaffen worden. Hier liegt eine ausgesprochen
moderne, subjektivistisch-romantische Auffassung der Kunst zugrunde, die einen
wesentlichen Grundzug des künstlerischen Gestaltens verabsolutiert und höchstens
für die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts eine bedingte Geltung besitzt. Nicht
minder schwer wiegt eine Reihe sachlicher Irrtümer und Auslassungen. Bei der
Betrachtung der römischen Kunst hätte die Malerei nicht übergangen werden dürfen,
zumal ihre Formengebung („Illusionismus" und „Impressionismus") stilgeschicht-
lich höchst aufschlußreich ist. So sehr Deri der romanischen Baukunst gerecht wird,
so wenig vermag er mit der romanischen Plastik und Malerei anzufangen. Die als
Beispiel herangezogenen Naumburger Figuren haben nichts Romanisches mehr an
sich, sondern sind hochgotisch; gerade die angeblich noch völlig „in romanischem
Kraftgefühl" (S. 89) lebende rechte Faltenpartie der Gepa ist ausgesprochen gotisch.
Die romanische Plastik zeigt — nach Deris Ansicht — „entweder einen schüler-
haften Anschluß an die Antike oder aber ein überderbes, noch reichlich rohes
Wesen", und die Malerei der Romanik endlich ist — „bei zumeist ziemlich grober
Formung" „kaum schon wirklich künstlerischem Erleben entsprungen" (S. 88). Mit
diesen belanglosen und zudem falschen Bemerkungen wird eines der reichsten