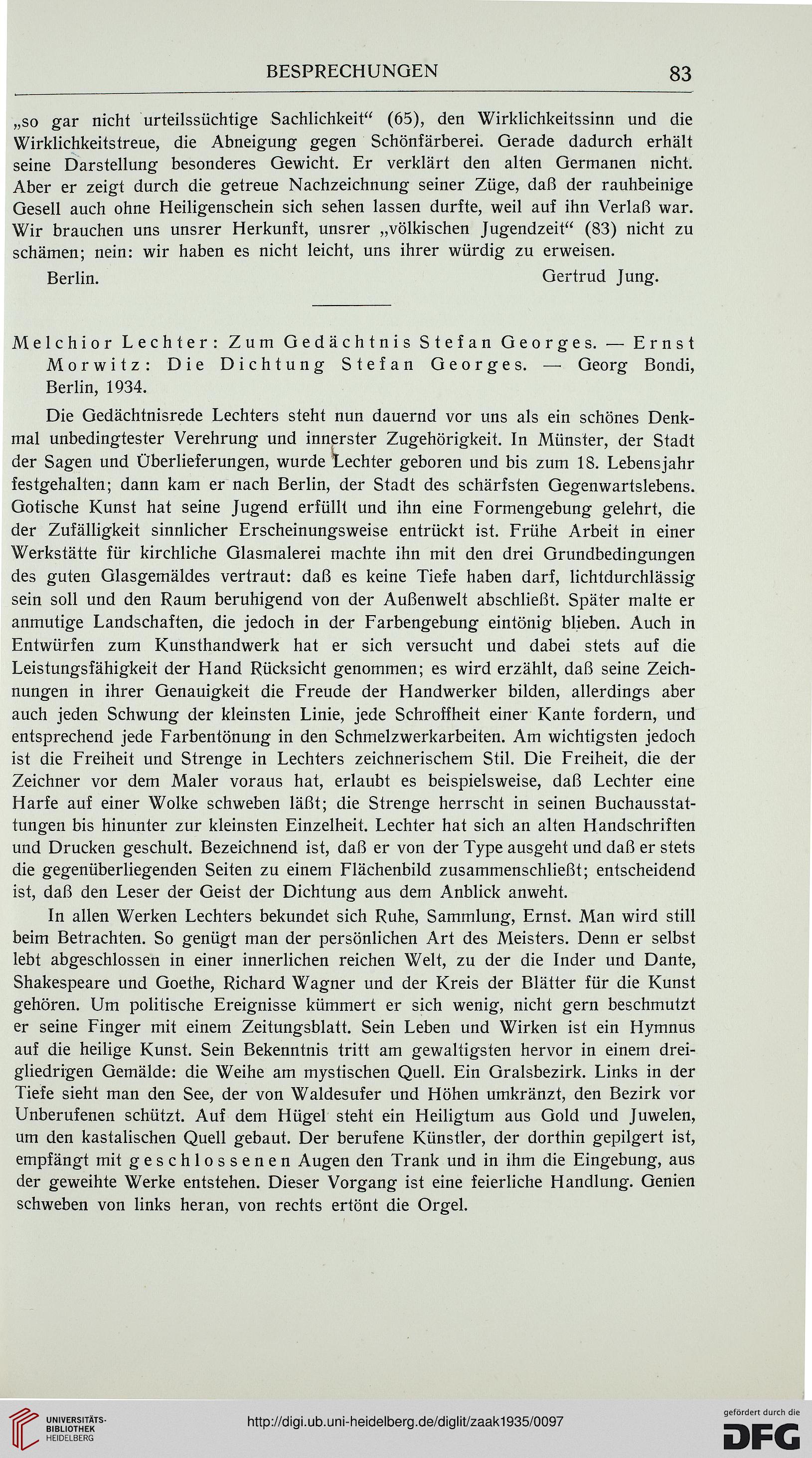BESPRECHUNGEN
83
„so gar nicht urteilssüchtige Sachlichkeit" (65), den Wirklichkeitssinn und die
Wirklichkeitstreue, die Abneigung gegen Schönfärberei. Gerade dadurch erhält
seine Darstellung besonderes Gewicht. Er verklärt den alten Germanen nicht.
Aber er zeigt durch die getreue Nachzeichnung seiner Züge, daß der rauhbeinige
Gesell auch ohne Heiligenschein sich sehen lassen durfte, weil auf ihn Verlaß war.
Wir brauchen uns unsrer Herkunft, unsrer „völkischen Jugendzeit" (83) nicht zu
schämen; nein: wir haben es nicht leicht, uns ihrer würdig zu erweisen.
Berlin. Gertrud Jung.
Melchior Lechter: Zum Gedächtnis Stefan Georges. — Ernst
Morwitz: Die Dichtung Stefan Georges. — Georg Bondi,
Berlin, 1934.
Die Gedächtnisrede Lechters steht nun dauernd vor uns als ein schönes Denk-
mal unbedingtester Verehrung und innerster Zugehörigkeit. In Münster, der Stadt
der Sagen und Überlieferungen, wurde Lechter geboren und bis zum 18. Lebensjahr
festgehalten; dann kam er nach Berlin, der Stadt des schärfsten Gegenwartslebens.
Gotische Kunst hat seine Jugend erfüllt und ihn eine Formengebung gelehrt, die
der Zufälligkeit sinnlicher Erscheinungsweise entrückt ist. Frühe Arbeit in einer
Werkstätte für kirchliche Glasmalerei machte ihn mit den drei Grundbedingungen
des guten Glasgemäldes vertraut: daß es keine Tiefe haben darf, lichtdurchlässig
sein soll und den Raum beruhigend von der Außenwelt abschließt. Später malte er
anmutige Landschaften, die jedoch in der Farbengebung eintönig blieben. Auch in
Entwürfen zum Kunsthandwerk hat er sich versucht und dabei stets auf die
Leistungsfähigkeit der Hand Rücksicht genommen; es wird erzählt, daß seine Zeich-
nungen in ihrer Genauigkeit die Freude der Handwerker bilden, allerdings aber
auch jeden Schwung der kleinsten Linie, jede Schroffheit einer Kante fordern, und
entsprechend jede Farbentönung in den Schmelzwerkarbeiten. Am wichtigsten jedoch
ist die Freiheit und Strenge in Lechters zeichnerischem Stil. Die Freiheit, die der
Zeichner vor dem Maler voraus hat, erlaubt es beispielsweise, daß Lechter eine
Harfe auf einer Wolke schweben läßt; die Strenge herrscht in seinen Buchausstat-
tungen bis hinunter zur kleinsten Einzelheit. Lechter hat sich an alten Handschriften
und Drucken geschult. Bezeichnend ist, daß er von der Type ausgeht und daß er stets
die gegenüberliegenden Seiten zu einem Flächenbild zusammenschließt; entscheidend
ist, daß den Leser der Geist der Dichtung aus dem Anblick anweht.
In allen Werken Lechters bekundet sich Ruhe, Sammlung, Ernst. Man wird still
beim Betrachten. So genügt man der persönlichen Art des Meisters. Denn er selbst
lebt abgeschlossen in einer innerlichen reichen Welt, zu der die Inder und Dante,
Shakespeare und Goethe, Richard Wagner und der Kreis der Blätter für die Kunst
gehören. Um politische Ereignisse kümmert er sich wenig, nicht gern beschmutzt
er seine Finger mit einem Zeitungsblatt. Sein Leben und Wirken ist ein Hymnus
auf die heilige Kunst. Sein Bekenntnis tritt am gewaltigsten hervor in einem drei-
gliedrigen Gemälde: die Weihe am mystischen Quell. Ein Gralsbezirk. Links in der
Tiefe sieht man den See, der von Waldesufer und Höhen umkränzt, den Bezirk vor
Unberufenen schützt. Auf dem Hügel steht ein Heiligtum aus Gold und Juwelen,
um den kastalischen Quell gebaut. Der berufene Künstler, der dorthin gepilgert ist,
empfängt mit geschlossenen Augen den Trank und in ihm die Eingebung, aus
der geweihte Werke entstehen. Dieser Vorgang ist eine feierliche Handlung. Genien
schweben von links heran, von rechts ertönt die Orgel.
83
„so gar nicht urteilssüchtige Sachlichkeit" (65), den Wirklichkeitssinn und die
Wirklichkeitstreue, die Abneigung gegen Schönfärberei. Gerade dadurch erhält
seine Darstellung besonderes Gewicht. Er verklärt den alten Germanen nicht.
Aber er zeigt durch die getreue Nachzeichnung seiner Züge, daß der rauhbeinige
Gesell auch ohne Heiligenschein sich sehen lassen durfte, weil auf ihn Verlaß war.
Wir brauchen uns unsrer Herkunft, unsrer „völkischen Jugendzeit" (83) nicht zu
schämen; nein: wir haben es nicht leicht, uns ihrer würdig zu erweisen.
Berlin. Gertrud Jung.
Melchior Lechter: Zum Gedächtnis Stefan Georges. — Ernst
Morwitz: Die Dichtung Stefan Georges. — Georg Bondi,
Berlin, 1934.
Die Gedächtnisrede Lechters steht nun dauernd vor uns als ein schönes Denk-
mal unbedingtester Verehrung und innerster Zugehörigkeit. In Münster, der Stadt
der Sagen und Überlieferungen, wurde Lechter geboren und bis zum 18. Lebensjahr
festgehalten; dann kam er nach Berlin, der Stadt des schärfsten Gegenwartslebens.
Gotische Kunst hat seine Jugend erfüllt und ihn eine Formengebung gelehrt, die
der Zufälligkeit sinnlicher Erscheinungsweise entrückt ist. Frühe Arbeit in einer
Werkstätte für kirchliche Glasmalerei machte ihn mit den drei Grundbedingungen
des guten Glasgemäldes vertraut: daß es keine Tiefe haben darf, lichtdurchlässig
sein soll und den Raum beruhigend von der Außenwelt abschließt. Später malte er
anmutige Landschaften, die jedoch in der Farbengebung eintönig blieben. Auch in
Entwürfen zum Kunsthandwerk hat er sich versucht und dabei stets auf die
Leistungsfähigkeit der Hand Rücksicht genommen; es wird erzählt, daß seine Zeich-
nungen in ihrer Genauigkeit die Freude der Handwerker bilden, allerdings aber
auch jeden Schwung der kleinsten Linie, jede Schroffheit einer Kante fordern, und
entsprechend jede Farbentönung in den Schmelzwerkarbeiten. Am wichtigsten jedoch
ist die Freiheit und Strenge in Lechters zeichnerischem Stil. Die Freiheit, die der
Zeichner vor dem Maler voraus hat, erlaubt es beispielsweise, daß Lechter eine
Harfe auf einer Wolke schweben läßt; die Strenge herrscht in seinen Buchausstat-
tungen bis hinunter zur kleinsten Einzelheit. Lechter hat sich an alten Handschriften
und Drucken geschult. Bezeichnend ist, daß er von der Type ausgeht und daß er stets
die gegenüberliegenden Seiten zu einem Flächenbild zusammenschließt; entscheidend
ist, daß den Leser der Geist der Dichtung aus dem Anblick anweht.
In allen Werken Lechters bekundet sich Ruhe, Sammlung, Ernst. Man wird still
beim Betrachten. So genügt man der persönlichen Art des Meisters. Denn er selbst
lebt abgeschlossen in einer innerlichen reichen Welt, zu der die Inder und Dante,
Shakespeare und Goethe, Richard Wagner und der Kreis der Blätter für die Kunst
gehören. Um politische Ereignisse kümmert er sich wenig, nicht gern beschmutzt
er seine Finger mit einem Zeitungsblatt. Sein Leben und Wirken ist ein Hymnus
auf die heilige Kunst. Sein Bekenntnis tritt am gewaltigsten hervor in einem drei-
gliedrigen Gemälde: die Weihe am mystischen Quell. Ein Gralsbezirk. Links in der
Tiefe sieht man den See, der von Waldesufer und Höhen umkränzt, den Bezirk vor
Unberufenen schützt. Auf dem Hügel steht ein Heiligtum aus Gold und Juwelen,
um den kastalischen Quell gebaut. Der berufene Künstler, der dorthin gepilgert ist,
empfängt mit geschlossenen Augen den Trank und in ihm die Eingebung, aus
der geweihte Werke entstehen. Dieser Vorgang ist eine feierliche Handlung. Genien
schweben von links heran, von rechts ertönt die Orgel.