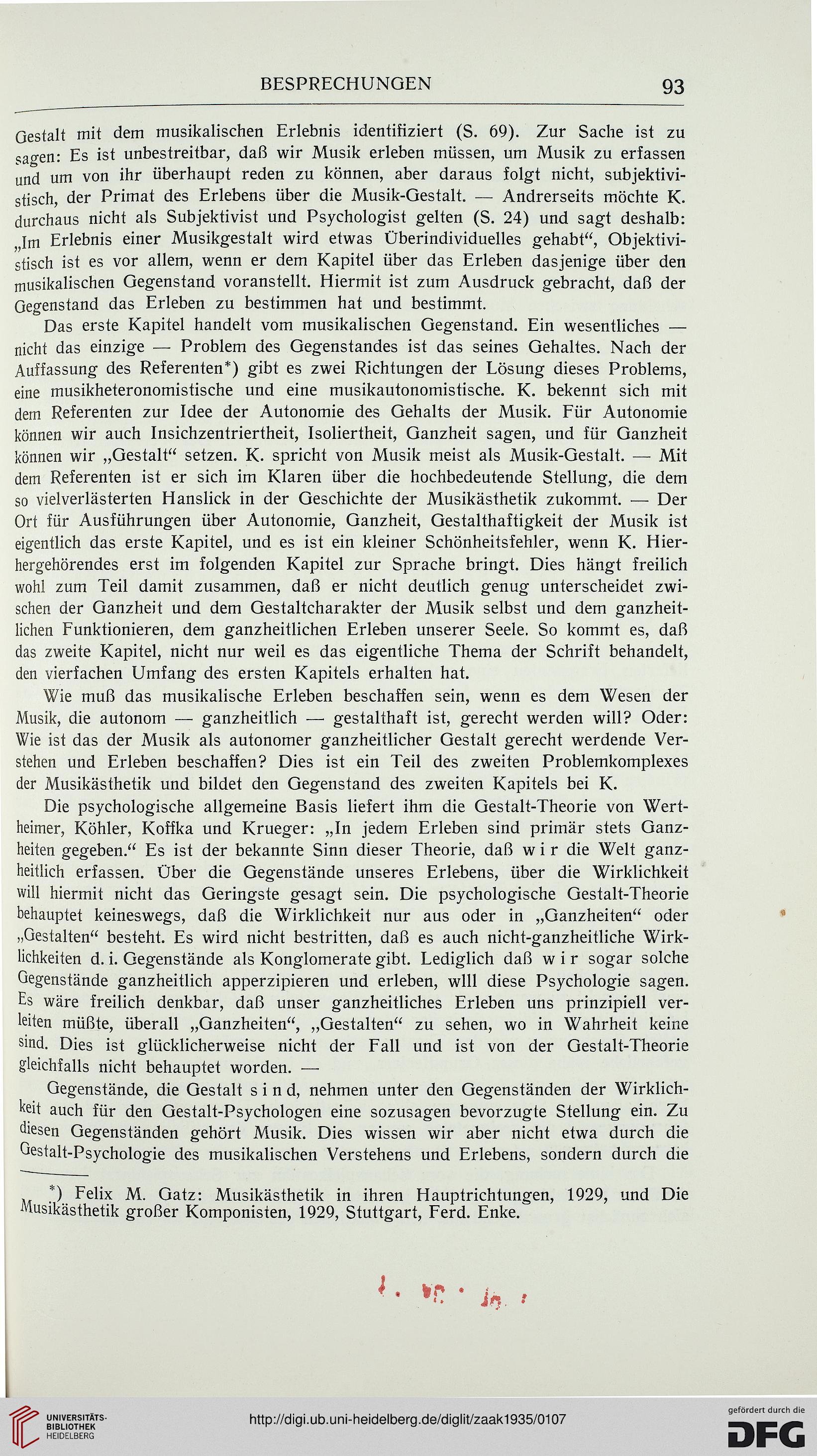BESPRECHUNGEN
93
Gestalt mit dem musikalischen Erlebnis identifiziert (S. 69). Zur Sache ist zu
sagen: Es ist unbestreitbar, daß wir Musik erleben müssen, um Musik zu erfassen
und um von ihr überhaupt reden zu können, aber daraus folgt nicht, subjektivi-
stisch, der Primat des Erlebens über die Musik-Gestalt. — Andrerseits möchte K.
durchaus nicht als Subjektivist und Psychologist gelten (S. 24) und sagt deshalb:
„Im Erlebnis einer Musikgestalt wird etwas Überindividuelles gehabt", Objektivi-
stisch ist es vor allem, wenn er dem Kapitel über das Erleben dasjenige über den
musikalischen Gegenstand voranstellt. Hiermit ist zum Ausdruck gebracht, daß der
Gegenstand das Erleben zu bestimmen hat und bestimmt.
Das erste Kapitel handelt vom musikalischen Gegenstand. Ein wesentliches —
nicht das einzige — Problem des Gegenstandes ist das seines Gehaltes. Nach der
Auffassung des Referenten*) gibt es zwei Richtungen der Lösung dieses Problems,
eine musikheteronomistische und eine musikautonomistische. K. bekennt sich mit
dem Referenten zur Idee der Autonomie des Gehalts der Musik. Für Autonomie
können wir auch Insichzentriertheit, Isoliertheit, Ganzheit sagen, und für Ganzheit
können wir „Gestalt" setzen. K. spricht von Musik meist als Musik-Gestalt. — Mit
dem Referenten ist er sich im Klaren über die hochbedeutende Stellung, die dem
so vielverlästerten Hanslick in der Geschichte der Musikästhetik zukommt. — Der
Ort für Ausführungen über Autonomie, Ganzheit, Gestalthaftigkeit der Musik ist
eigentlich das erste Kapitel, und es ist ein kleiner Schönheitsfehler, wenn K. Hier-
hergehörendes erst im folgenden Kapitel zur Sprache bringt. Dies hängt freilich
wohl zum Teil damit zusammen, daß er nicht deutlich genug unterscheidet zwi-
schen der Ganzheit und dem Gestaltcharakter der Musik selbst und dem ganzheit-
lichen Funktionieren, dem ganzheitlichen Erleben unserer Seele. So kommt es, daß
das zweite Kapitel, nicht nur weil es das eigentliche Thema der Schrift behandelt,
den vierfachen Umfang des ersten Kapitels erhalten hat.
Wie muß das musikalische Erleben beschaffen sein, wenn es dem Wesen der
Musik, die autonom — ganzheitlich — gestalthaft ist, gerecht werden will? Oder:
Wie ist das der Musik als autonomer ganzheitlicher Gestalt gerecht werdende Ver-
stehen und Erleben beschaffen? Dies ist ein Teil des zweiten Problemkomplexes
der Musikästhetik und bildet den Gegenstand des zweiten Kapitels bei K.
Die psychologische allgemeine Basis liefert ihm die Gestalt-Theorie von Wert-
heimer, Köhler, Koffka und Krueger: „In jedem Erleben sind primär stets Ganz-
heiten gegeben." Es ist der bekannte Sinn dieser Theorie, daß wir die Welt ganz-
heitlich erfassen. Über die Gegenstände unseres Erlebens, über die Wirklichkeit
will hiermit nicht das Geringste gesagt sein. Die psychologische Gestalt-Theorie
behauptet keineswegs, daß die Wirklichkeit nur aus oder in „Ganzheiten" oder
»Gestalten" besteht. Es wird nicht bestritten, daß es auch nicht-ganzheitliche Wirk-
lichkeiten d. i. Gegenstände als Konglomerate gibt. Lediglich daß w i r sogar solche
Gegenstände ganzheitlich apperzipieren und erleben, will diese Psychologie sagen.
Es wäre freilich denkbar, daß unser ganzheitliches Erleben uns prinzipiell ver-
leiten müßte, überall „Ganzheiten", „Gestalten" zu sehen, wo in Wahrheit keine
sind. Dies ist glücklicherweise nicht der Fall und ist von der Gestalt-Theorie
gleichfalls nicht behauptet worden. —
Gegenstände, die Gestalt sind, nehmen unter den Gegenständen der Wirklich-
keit auch für den Gestalt-Psychologen eine sozusagen bevorzugte Stellung ein. Zu
diesen Gegenständen gehört Musik. Dies wissen wir aber nicht etwa durch die
Gestalt-Psychologie des musikalischen Verstehens und Erlebens, sondern durch die
*) Felix M. Gatz: Musikästhetik in ihren Hauptrichtungen, 1929, und Die
Musikästhetik großer Komponisten, 1929, Stuttgart, Ferd. Enke.
93
Gestalt mit dem musikalischen Erlebnis identifiziert (S. 69). Zur Sache ist zu
sagen: Es ist unbestreitbar, daß wir Musik erleben müssen, um Musik zu erfassen
und um von ihr überhaupt reden zu können, aber daraus folgt nicht, subjektivi-
stisch, der Primat des Erlebens über die Musik-Gestalt. — Andrerseits möchte K.
durchaus nicht als Subjektivist und Psychologist gelten (S. 24) und sagt deshalb:
„Im Erlebnis einer Musikgestalt wird etwas Überindividuelles gehabt", Objektivi-
stisch ist es vor allem, wenn er dem Kapitel über das Erleben dasjenige über den
musikalischen Gegenstand voranstellt. Hiermit ist zum Ausdruck gebracht, daß der
Gegenstand das Erleben zu bestimmen hat und bestimmt.
Das erste Kapitel handelt vom musikalischen Gegenstand. Ein wesentliches —
nicht das einzige — Problem des Gegenstandes ist das seines Gehaltes. Nach der
Auffassung des Referenten*) gibt es zwei Richtungen der Lösung dieses Problems,
eine musikheteronomistische und eine musikautonomistische. K. bekennt sich mit
dem Referenten zur Idee der Autonomie des Gehalts der Musik. Für Autonomie
können wir auch Insichzentriertheit, Isoliertheit, Ganzheit sagen, und für Ganzheit
können wir „Gestalt" setzen. K. spricht von Musik meist als Musik-Gestalt. — Mit
dem Referenten ist er sich im Klaren über die hochbedeutende Stellung, die dem
so vielverlästerten Hanslick in der Geschichte der Musikästhetik zukommt. — Der
Ort für Ausführungen über Autonomie, Ganzheit, Gestalthaftigkeit der Musik ist
eigentlich das erste Kapitel, und es ist ein kleiner Schönheitsfehler, wenn K. Hier-
hergehörendes erst im folgenden Kapitel zur Sprache bringt. Dies hängt freilich
wohl zum Teil damit zusammen, daß er nicht deutlich genug unterscheidet zwi-
schen der Ganzheit und dem Gestaltcharakter der Musik selbst und dem ganzheit-
lichen Funktionieren, dem ganzheitlichen Erleben unserer Seele. So kommt es, daß
das zweite Kapitel, nicht nur weil es das eigentliche Thema der Schrift behandelt,
den vierfachen Umfang des ersten Kapitels erhalten hat.
Wie muß das musikalische Erleben beschaffen sein, wenn es dem Wesen der
Musik, die autonom — ganzheitlich — gestalthaft ist, gerecht werden will? Oder:
Wie ist das der Musik als autonomer ganzheitlicher Gestalt gerecht werdende Ver-
stehen und Erleben beschaffen? Dies ist ein Teil des zweiten Problemkomplexes
der Musikästhetik und bildet den Gegenstand des zweiten Kapitels bei K.
Die psychologische allgemeine Basis liefert ihm die Gestalt-Theorie von Wert-
heimer, Köhler, Koffka und Krueger: „In jedem Erleben sind primär stets Ganz-
heiten gegeben." Es ist der bekannte Sinn dieser Theorie, daß wir die Welt ganz-
heitlich erfassen. Über die Gegenstände unseres Erlebens, über die Wirklichkeit
will hiermit nicht das Geringste gesagt sein. Die psychologische Gestalt-Theorie
behauptet keineswegs, daß die Wirklichkeit nur aus oder in „Ganzheiten" oder
»Gestalten" besteht. Es wird nicht bestritten, daß es auch nicht-ganzheitliche Wirk-
lichkeiten d. i. Gegenstände als Konglomerate gibt. Lediglich daß w i r sogar solche
Gegenstände ganzheitlich apperzipieren und erleben, will diese Psychologie sagen.
Es wäre freilich denkbar, daß unser ganzheitliches Erleben uns prinzipiell ver-
leiten müßte, überall „Ganzheiten", „Gestalten" zu sehen, wo in Wahrheit keine
sind. Dies ist glücklicherweise nicht der Fall und ist von der Gestalt-Theorie
gleichfalls nicht behauptet worden. —
Gegenstände, die Gestalt sind, nehmen unter den Gegenständen der Wirklich-
keit auch für den Gestalt-Psychologen eine sozusagen bevorzugte Stellung ein. Zu
diesen Gegenständen gehört Musik. Dies wissen wir aber nicht etwa durch die
Gestalt-Psychologie des musikalischen Verstehens und Erlebens, sondern durch die
*) Felix M. Gatz: Musikästhetik in ihren Hauptrichtungen, 1929, und Die
Musikästhetik großer Komponisten, 1929, Stuttgart, Ferd. Enke.