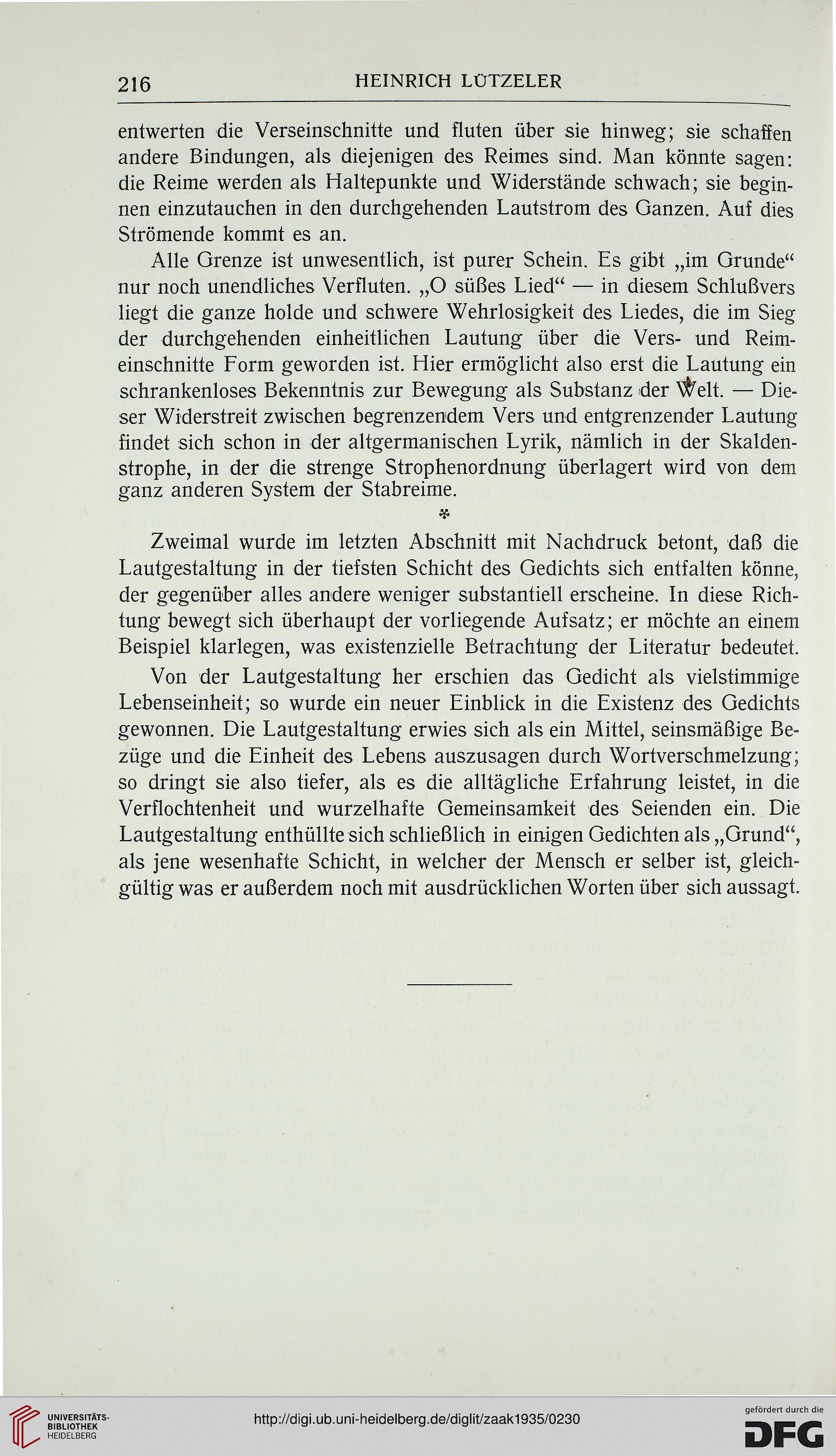216
HEINRICH LÜTZELER
entwerten die Verseinschnitte und fluten über sie hinweg; sie schaffen
andere Bindungen, als diejenigen des Reimes sind. Man könnte sagen:
die Reime werden als Haltepunkte und Widerstände schwach; sie begin-
nen einzutauchen in den durchgehenden Lautstrom des Ganzen. Auf dies
Strömende kommt es an.
Alle Grenze ist unwesentlich, ist purer Schein. Es gibt „im Grunde"
nur noch unendliches Verfluten. „O süßes Lied" — in diesem Schlußvers
liegt die ganze holde und schwere Wehrlosigkeit des Liedes, die im Sieg
der durchgehenden einheitlichen Lautung über die Vers- und Reim-
einschnitte Form geworden ist. Hier ermöglicht also erst die Lautung ein
schrankenloses Bekenntnis zur Bewegung als Substanz der ^elt. — Die-
ser Widerstreit zwischen begrenzendem Vers und entgrenzender Lautung
findet sich schon in der altgermanischen Lyrik, nämlich in der Skalden-
strophe, in der die strenge Strophenordnung überlagert wird von dem
ganz anderen System der Stabreime.
Zweimal wurde im letzten Abschnitt mit Nachdruck betont, daß die
Lautgestaltung in der tiefsten Schicht des Gedichts sich entfalten könne,
der gegenüber alles andere weniger substantiell erscheine. In diese Rich-
tung bewegt sich überhaupt der vorliegende Aufsatz; er möchte an einem
Beispiel klarlegen, was existenzielle Betrachtung der Literatur bedeutet.
Von der Lautgestaltung her erschien das Gedicht als vielstimmige
Lebenseinheit; so wurde ein neuer Einblick in die Existenz des Gedichts
gewonnen. Die Lautgestaltung erwies sich als ein Mittel, seinsmäßige Be-
züge und die Einheit des Lebens auszusagen durch Wortverschmelzung;
so dringt sie also tiefer, als es die alltägliche Erfahrung leistet, in die
Verflochtenheit und wurzelhafte Gemeinsamkeit des Seienden ein. Die
Lautgestaltung enthüllte sich schließlich in einigen Gedichten als „Grund",
als jene wesenhafte Schicht, in welcher der Mensch er selber ist, gleich-
gültig was er außerdem noch mit ausdrücklichen Worten über sich aussagt.
HEINRICH LÜTZELER
entwerten die Verseinschnitte und fluten über sie hinweg; sie schaffen
andere Bindungen, als diejenigen des Reimes sind. Man könnte sagen:
die Reime werden als Haltepunkte und Widerstände schwach; sie begin-
nen einzutauchen in den durchgehenden Lautstrom des Ganzen. Auf dies
Strömende kommt es an.
Alle Grenze ist unwesentlich, ist purer Schein. Es gibt „im Grunde"
nur noch unendliches Verfluten. „O süßes Lied" — in diesem Schlußvers
liegt die ganze holde und schwere Wehrlosigkeit des Liedes, die im Sieg
der durchgehenden einheitlichen Lautung über die Vers- und Reim-
einschnitte Form geworden ist. Hier ermöglicht also erst die Lautung ein
schrankenloses Bekenntnis zur Bewegung als Substanz der ^elt. — Die-
ser Widerstreit zwischen begrenzendem Vers und entgrenzender Lautung
findet sich schon in der altgermanischen Lyrik, nämlich in der Skalden-
strophe, in der die strenge Strophenordnung überlagert wird von dem
ganz anderen System der Stabreime.
Zweimal wurde im letzten Abschnitt mit Nachdruck betont, daß die
Lautgestaltung in der tiefsten Schicht des Gedichts sich entfalten könne,
der gegenüber alles andere weniger substantiell erscheine. In diese Rich-
tung bewegt sich überhaupt der vorliegende Aufsatz; er möchte an einem
Beispiel klarlegen, was existenzielle Betrachtung der Literatur bedeutet.
Von der Lautgestaltung her erschien das Gedicht als vielstimmige
Lebenseinheit; so wurde ein neuer Einblick in die Existenz des Gedichts
gewonnen. Die Lautgestaltung erwies sich als ein Mittel, seinsmäßige Be-
züge und die Einheit des Lebens auszusagen durch Wortverschmelzung;
so dringt sie also tiefer, als es die alltägliche Erfahrung leistet, in die
Verflochtenheit und wurzelhafte Gemeinsamkeit des Seienden ein. Die
Lautgestaltung enthüllte sich schließlich in einigen Gedichten als „Grund",
als jene wesenhafte Schicht, in welcher der Mensch er selber ist, gleich-
gültig was er außerdem noch mit ausdrücklichen Worten über sich aussagt.