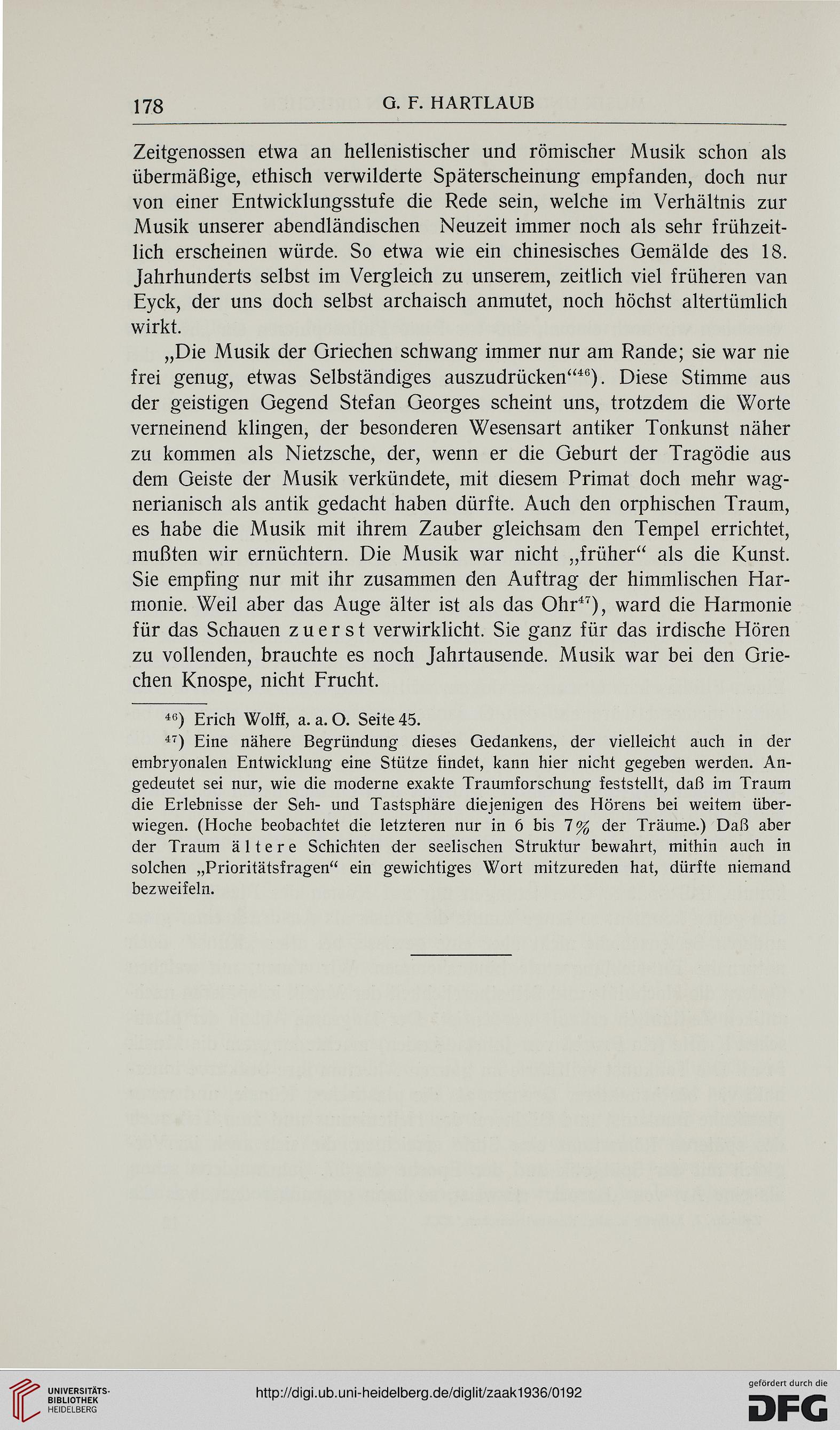Zeitgenossen etwa an hellenistischer und römischer Musik schon als
übermäßige, ethisch verwilderte Späterscheinung empfanden, doch nur
von einer Entwicklungsstufe die Rede sein, welche im Verhältnis zur
Musik unserer abendländischen Neuzeit immer noch als sehr frühzeit-
lich erscheinen würde. So etwa wie ein chinesisches Gemälde des 18.
Jahrhunderts selbst im Vergleich zu unserem, zeitlich viel früheren van
Eyck, der uns doch selbst archaisch anmutet, noch höchst altertümlich
wirkt.
„Die Musik der Griechen schwang immer nur am Rande; sie war nie
frei genug, etwas Selbständiges auszudrücken"46). Diese Stimme aus
der geistigen Gegend Stefan Georges scheint uns, trotzdem die Worte
verneinend klingen, der besonderen Wesensart antiker Tonkunst näher
zu kommen als Nietzsche, der, wenn er die Geburt der Tragödie aus
dem Geiste der Musik verkündete, mit diesem Primat doch mehr wag-
nerianisch als antik gedacht haben dürfte. Auch den orphischen Traum,
es habe die Musik mit ihrem Zauber gleichsam den Tempel errichtet,
mußten wir ernüchtern. Die Musik war nicht „früher" als die Kunst.
Sie empfing nur mit ihr zusammen den Auftrag der himmlischen Har-
monie. Weil aber das Auge älter ist als das Ohr47), ward die Harmonie
für das Schauen zuerst verwirklicht. Sie ganz für das irdische Hören
zu vollenden, brauchte es noch Jahrtausende. Musik war bei den Grie-
chen Knospe, nicht Frucht.
4(i) Erich Wolff, a. a. O. Seite 45.
47) Eine nähere Begründung dieses Gedankens, der vielleicht auch in der
embryonalen Entwicklung eine Stütze findet, kann hier nicht gegeben werden. An-
gedeutet sei nur, wie die moderne exakte Traumforschung feststellt, daß im Traum
die Erlebnisse der Seh- und Tastsphäre diejenigen des Hörens bei weitem über-
wiegen. (Hoche beobachtet die letzteren nur in 6 bis 1% der Träume.) Daß aber
der Traum ältere Schichten der seelischen Struktur bewahrt, mithin auch in
solchen „Prioritätsfragen" ein gewichtiges Wort mitzureden hat, dürfte niemand
bezweifeln.
übermäßige, ethisch verwilderte Späterscheinung empfanden, doch nur
von einer Entwicklungsstufe die Rede sein, welche im Verhältnis zur
Musik unserer abendländischen Neuzeit immer noch als sehr frühzeit-
lich erscheinen würde. So etwa wie ein chinesisches Gemälde des 18.
Jahrhunderts selbst im Vergleich zu unserem, zeitlich viel früheren van
Eyck, der uns doch selbst archaisch anmutet, noch höchst altertümlich
wirkt.
„Die Musik der Griechen schwang immer nur am Rande; sie war nie
frei genug, etwas Selbständiges auszudrücken"46). Diese Stimme aus
der geistigen Gegend Stefan Georges scheint uns, trotzdem die Worte
verneinend klingen, der besonderen Wesensart antiker Tonkunst näher
zu kommen als Nietzsche, der, wenn er die Geburt der Tragödie aus
dem Geiste der Musik verkündete, mit diesem Primat doch mehr wag-
nerianisch als antik gedacht haben dürfte. Auch den orphischen Traum,
es habe die Musik mit ihrem Zauber gleichsam den Tempel errichtet,
mußten wir ernüchtern. Die Musik war nicht „früher" als die Kunst.
Sie empfing nur mit ihr zusammen den Auftrag der himmlischen Har-
monie. Weil aber das Auge älter ist als das Ohr47), ward die Harmonie
für das Schauen zuerst verwirklicht. Sie ganz für das irdische Hören
zu vollenden, brauchte es noch Jahrtausende. Musik war bei den Grie-
chen Knospe, nicht Frucht.
4(i) Erich Wolff, a. a. O. Seite 45.
47) Eine nähere Begründung dieses Gedankens, der vielleicht auch in der
embryonalen Entwicklung eine Stütze findet, kann hier nicht gegeben werden. An-
gedeutet sei nur, wie die moderne exakte Traumforschung feststellt, daß im Traum
die Erlebnisse der Seh- und Tastsphäre diejenigen des Hörens bei weitem über-
wiegen. (Hoche beobachtet die letzteren nur in 6 bis 1% der Träume.) Daß aber
der Traum ältere Schichten der seelischen Struktur bewahrt, mithin auch in
solchen „Prioritätsfragen" ein gewichtiges Wort mitzureden hat, dürfte niemand
bezweifeln.