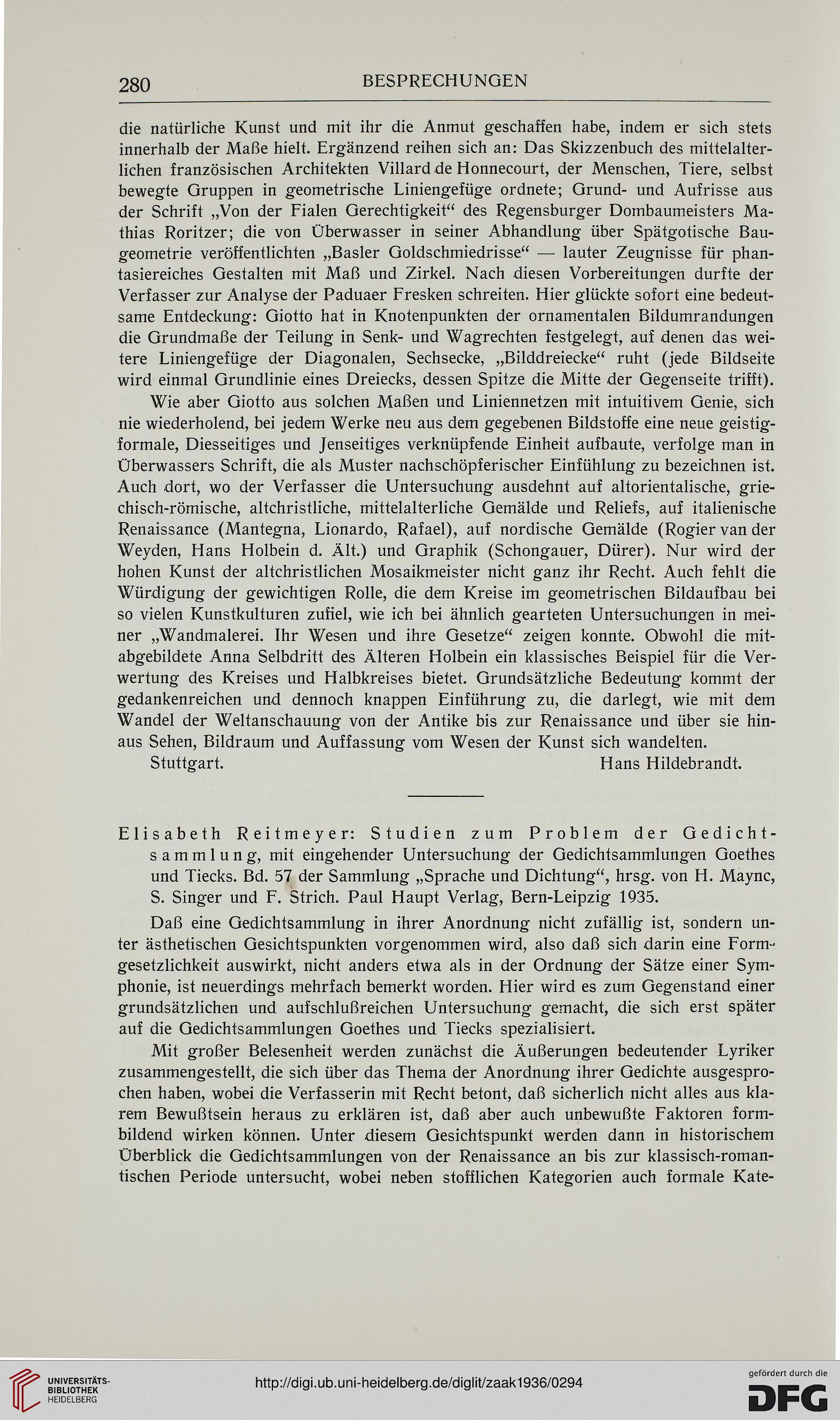die natürliche Kunst und mit ihr die Anmut geschaffen habe, indem er sich stets
innerhalb der Maße hielt. Ergänzend reihen sich an: Das Skizzenbuch des mittelalter-
lichen französischen Architekten Villard de Honnecourt, der Menschen, Tiere, selbst
bewegte Gruppen in geometrische Liniengefüge ordnete; Grund- und Aufrisse aus
der Schrift „Von der Fialen Gerechtigkeit" des Regensburger Dombaumeisters Ma-
thias Roritzer; die von Überwasser in seiner Abhandlung über Spätgotische Bau-
geometrie veröffentlichten „Basler Goldschmiedrisse" — lauter Zeugnisse für phan-
tasiereiches Gestalten mit Maß und Zirkel. Nach diesen Vorbereitungen durfte der
Verfasser zur Analyse der Paduaer Fresken schreiten. Hier glückte sofort eine bedeut-
same Entdeckung: Giotto hat in Knotenpunkten der ornamentalen Bildumrandungen
die Grundmaße der Teilung in Senk- und Wagrechten festgelegt, auf denen das wei-
tere Liniengefüge der Diagonalen, Sechsecke, „Bilddreiecke" ruht (jede Bildseite
wird einmal Grundlinie eines Dreiecks, dessen Spitze die Mitte der Gegenseite trifft).
Wie aber Giotto aus solchen Maßen und Liniennetzen mit intuitivem Genie, sich
nie wiederholend, bei jedem Werke neu aus dem gegebenen Bildstoffe eine neue geistig-
formale, Diesseitiges und Jenseitiges verknüpfende Einheit aufbaute, verfolge man in
Überwassers Schrift, die als Muster nachschöpferischer Einfühlung zu bezeichnen ist.
Auch dort, wo der Verfasser die Untersuchung ausdehnt auf altorientalische, grie-
chisch-römische, altchristliche, mittelalterliche Gemälde und Reliefs, auf italienische
Renaissance (Mantegna, Lionardo, Rafael), auf nordische Gemälde (Rogier van der
Weyden, Hans Holbein d. Ält.) und Graphik (Schongauer, Dürer). Nur wird der
hohen Kunst der altchristlichen Mosaikmeister nicht ganz ihr Recht. Auch fehlt die
Würdigung der gewichtigen Rolle, die dem Kreise im geometrischen Bildaufbau bei
so vielen Kunstkulturen zufiel, wie ich bei ähnlich gearteten Untersuchungen in mei-
ner „Wandmalerei. Ihr Wesen und ihre Gesetze" zeigen konnte. Obwohl die mit-
abgebildete Anna Selbdritt des Älteren Holbein ein klassisches Beispiel für die Ver-
wertung des Kreises und Halbkreises bietet. Grundsätzliche Bedeutung kommt der
gedankenreichen und dennoch knappen Einführung zu, die darlegt, wie mit dem
Wandel der Weltanschauung von der Antike bis zur Renaissance und über sie hin-
aus Sehen, Bildraum und Auffassung vom Wesen der Kunst sich wandelten.
Stuttgart. Hans Hildebrandt.
Elisabeth Reitmeyer: Studien zum Problem der Gedicht-
sammlung, mit eingehender Untersuchung der Gedichtsammlungen Goethes
und Tiecks. Bd. 57 der Sammlung „Sprache und Dichtung", hrsg. von H. Maync,
S. Singer und F. Strich. Paul Haupt Verlag, Bern-Leipzig 1935.
Daß eine Gedichtsammlung in ihrer Anordnung nicht zufällig ist, sondern un-
ter ästhetischen Gesichtspunkten vorgenommen wird, also daß sich darin eine Form-
gesetzlichkeit auswirkt, nicht anders etwa als in der Ordnung der Sätze einer Sym-
phonie, ist neuerdings mehrfach bemerkt worden. Hier wird es zum Gegenstand einer
grundsätzlichen und aufschlußreichen Untersuchung gemacht, die sich erst später
auf die Gedichtsammlungen Goethes und Tiecks spezialisiert.
Mit großer Belesenheit werden zunächst die Äußerungen bedeutender Lyriker
zusammengestellt, die sich über das Thema der Anordnung ihrer Gedichte ausgespro-
chen haben, wobei die Verfasserin mit Recht betont, daß sicherlich nicht alles aus kla-
rem Bewußtsein heraus zu erklären ist, daß aber auch unbewußte Faktoren form-
bildend wirken können. Unter diesem Gesichtspunkt werden dann in historischem
Überblick die Gedichtsammlungen von der Renaissance an bis zur klassisch-roman-
tischen Periode untersucht, wobei neben stofflichen Kategorien auch formale Kate-
innerhalb der Maße hielt. Ergänzend reihen sich an: Das Skizzenbuch des mittelalter-
lichen französischen Architekten Villard de Honnecourt, der Menschen, Tiere, selbst
bewegte Gruppen in geometrische Liniengefüge ordnete; Grund- und Aufrisse aus
der Schrift „Von der Fialen Gerechtigkeit" des Regensburger Dombaumeisters Ma-
thias Roritzer; die von Überwasser in seiner Abhandlung über Spätgotische Bau-
geometrie veröffentlichten „Basler Goldschmiedrisse" — lauter Zeugnisse für phan-
tasiereiches Gestalten mit Maß und Zirkel. Nach diesen Vorbereitungen durfte der
Verfasser zur Analyse der Paduaer Fresken schreiten. Hier glückte sofort eine bedeut-
same Entdeckung: Giotto hat in Knotenpunkten der ornamentalen Bildumrandungen
die Grundmaße der Teilung in Senk- und Wagrechten festgelegt, auf denen das wei-
tere Liniengefüge der Diagonalen, Sechsecke, „Bilddreiecke" ruht (jede Bildseite
wird einmal Grundlinie eines Dreiecks, dessen Spitze die Mitte der Gegenseite trifft).
Wie aber Giotto aus solchen Maßen und Liniennetzen mit intuitivem Genie, sich
nie wiederholend, bei jedem Werke neu aus dem gegebenen Bildstoffe eine neue geistig-
formale, Diesseitiges und Jenseitiges verknüpfende Einheit aufbaute, verfolge man in
Überwassers Schrift, die als Muster nachschöpferischer Einfühlung zu bezeichnen ist.
Auch dort, wo der Verfasser die Untersuchung ausdehnt auf altorientalische, grie-
chisch-römische, altchristliche, mittelalterliche Gemälde und Reliefs, auf italienische
Renaissance (Mantegna, Lionardo, Rafael), auf nordische Gemälde (Rogier van der
Weyden, Hans Holbein d. Ält.) und Graphik (Schongauer, Dürer). Nur wird der
hohen Kunst der altchristlichen Mosaikmeister nicht ganz ihr Recht. Auch fehlt die
Würdigung der gewichtigen Rolle, die dem Kreise im geometrischen Bildaufbau bei
so vielen Kunstkulturen zufiel, wie ich bei ähnlich gearteten Untersuchungen in mei-
ner „Wandmalerei. Ihr Wesen und ihre Gesetze" zeigen konnte. Obwohl die mit-
abgebildete Anna Selbdritt des Älteren Holbein ein klassisches Beispiel für die Ver-
wertung des Kreises und Halbkreises bietet. Grundsätzliche Bedeutung kommt der
gedankenreichen und dennoch knappen Einführung zu, die darlegt, wie mit dem
Wandel der Weltanschauung von der Antike bis zur Renaissance und über sie hin-
aus Sehen, Bildraum und Auffassung vom Wesen der Kunst sich wandelten.
Stuttgart. Hans Hildebrandt.
Elisabeth Reitmeyer: Studien zum Problem der Gedicht-
sammlung, mit eingehender Untersuchung der Gedichtsammlungen Goethes
und Tiecks. Bd. 57 der Sammlung „Sprache und Dichtung", hrsg. von H. Maync,
S. Singer und F. Strich. Paul Haupt Verlag, Bern-Leipzig 1935.
Daß eine Gedichtsammlung in ihrer Anordnung nicht zufällig ist, sondern un-
ter ästhetischen Gesichtspunkten vorgenommen wird, also daß sich darin eine Form-
gesetzlichkeit auswirkt, nicht anders etwa als in der Ordnung der Sätze einer Sym-
phonie, ist neuerdings mehrfach bemerkt worden. Hier wird es zum Gegenstand einer
grundsätzlichen und aufschlußreichen Untersuchung gemacht, die sich erst später
auf die Gedichtsammlungen Goethes und Tiecks spezialisiert.
Mit großer Belesenheit werden zunächst die Äußerungen bedeutender Lyriker
zusammengestellt, die sich über das Thema der Anordnung ihrer Gedichte ausgespro-
chen haben, wobei die Verfasserin mit Recht betont, daß sicherlich nicht alles aus kla-
rem Bewußtsein heraus zu erklären ist, daß aber auch unbewußte Faktoren form-
bildend wirken können. Unter diesem Gesichtspunkt werden dann in historischem
Überblick die Gedichtsammlungen von der Renaissance an bis zur klassisch-roman-
tischen Periode untersucht, wobei neben stofflichen Kategorien auch formale Kate-