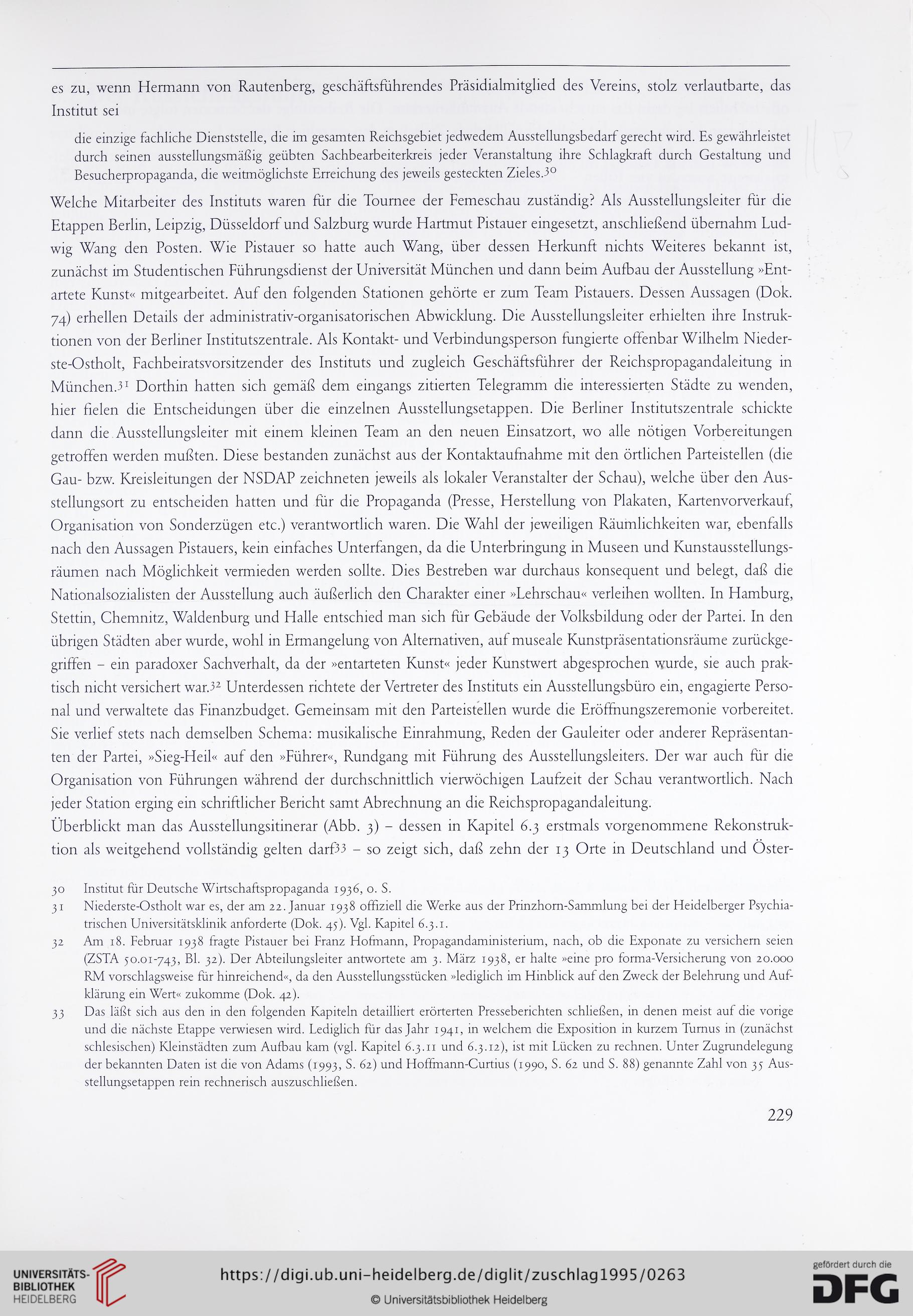es zu, wenn Hermann von Rautenberg, geschäftsführendes Präsidialmitglied des Vereins, stolz verlautbarte, das
Institut sei
die einzige fachliche Dienststelle, die im gesamten Reichsgebiet jedwedem Ausstellungsbedarf gerecht wird. Es gewährleistet
durch seinen ausstellungsmäßig geübten Sachbearbeiterkreis jeder Veranstaltung ihre Schlagkraft durch Gestaltung und
Besucherpropaganda, die weitmöglichste Erreichung des jeweils gesteckten Zieles.3°
Welche Mitarbeiter des Instituts waren für die Tournee der Femeschau zuständig? Als Ausstellungsleiter für die
Etappen Berlin, Leipzig, Düsseldorf und Salzburg wurde Hartmut Pistauer eingesetzt, anschließend übernahm Lud-
wig Wang den Posten. Wie Pistauer so hatte auch Wang, über dessen Herkunft nichts Weiteres bekannt ist,
zunächst im Studentischen Führungsdienst der Universität München und dann beim Aufbau der Ausstellung »Ent-
artete Kunst« mitgearbeitet. Auf den folgenden Stationen gehörte er zum Team Pistauers. Dessen Aussagen (Dok.
74) erhellen Details der administrativ-organisatorischen Abwicklung. Die Ausstellungsleiter erhielten ihre Instruk-
tionen von der Berliner Institutszentrale. Als Kontakt- und Verbindungsperson fungierte offenbar Wilhelm Nieder-
ste-Ostholt, Fachbeiratsvorsitzender des Instituts und zugleich Geschäftsführer der Reichspropagandaleitung in
München.31 Dorthin hatten sich gemäß dem eingangs zitierten Telegramm die interessierten Städte zu wenden,
hier fielen die Entscheidungen über die einzelnen Ausstellungsetappen. Die Berliner Institutszentrale schickte
dann die Ausstellungsleiter mit einem kleinen Team an den neuen Einsatzort, wo alle nötigen Vorbereitungen
getroffen werden mußten. Diese bestanden zunächst aus der Kontaktaufhahme mit den örtlichen Parteistellen (die
Gau- bzw. Kreisleitungen der NSDAP zeichneten jeweils als lokaler Veranstalter der Schau), welche über den Aus-
stellungsort zu entscheiden hatten und für die Propaganda (Presse, Herstellung von Plakaten, Kartenvorverkauf,
Organisation von Sonderzügen etc.) verantwortlich waren. Die Wahl der jeweiligen Räumlichkeiten war, ebenfalls
nach den Aussagen Pistauers, kein einfaches Unterfangen, da die Unterbringung in Museen und Kunstausstellungs-
räumen nach Möglichkeit vermieden werden sollte. Dies Bestreben war durchaus konsequent und belegt, daß die
Nationalsozialisten der Ausstellung auch äußerlich den Charakter einer »Lehrschau« verleihen wollten. In Hamburg,
Stettin, Chemnitz, Waldenburg und Halle entschied man sich für Gebäude der Volksbildung oder der Partei. In den
übrigen Städten aber wurde, wohl in Ermangelung von Alternativen, auf museale Kunstpräsentationsräume zurückge-
griffen - ein paradoxer Sachverhalt, da der »entarteten Kunst« jeder Kunstwert abgesprochen wurde, sie auch prak-
tisch nicht versichert war.32 Unterdessen richtete der Vertreter des Instituts ein Ausstellungsbüro em, engagierte Perso-
nal und verwaltete das Finanzbudget. Gemeinsam mit den Parteistellen wurde die Eröffhungszeremonie vorbereitet.
Sie verlief stets nach demselben Schema: musikalische Einrahmung, Reden der Gauleiter oder anderer Repräsentan-
ten der Partei, »Sieg-Heil« auf den »Führer«, Rundgang mit Führung des Ausstellungsleiters. Der war auch für die
Organisation von Führungen während der durchschnittlich vierwöchigen Laufzeit der Schau verantwortlich. Nach
jeder Station erging ein schriftlicher Bericht samt Abrechnung an die Reichspropagandaleitung.
Überblickt man das Ausstellungsitinerar (Abb. 3) - dessen in Kapitel 6.3 erstmals vorgenommene Rekonstruk-
tion als weitgehend vollständig gelten darf33 - so zeigt sich, daß zehn der 13 Orte in Deutschland und Oster-
30 Institut für Deutsche Wirtschaftspropaganda 1936, o. S.
31 Niederste-Ostholt war es, der am 22. Januar 1938 offiziell die Werke aus der Prinzhom-Sammlung bei der Heidelberger Psychia-
trischen Universitätsklinik anforderte (Dok. 45). Vgl. Kapitel 6.3.1.
32 Am 18. Februar 1938 fragte Pistauer bei Franz Hofmann, Propagandaministerium, nach, ob die Exponate zu versichern seien
(ZSTA 50.01-743, Bl. 32). Der Abteilungsleiter antwortete am 3. März 1938, er halte »eine pro forma-Versicherung von 20.000
RM vorschlagsweise für hinreichend«, da den Ausstellungsstücken »lediglich im Hinblick auf den Zweck der Belehrung und Auf-
klärung ein Wert« zukomme (Dok. 42).
33 Das läßt sich aus den in den folgenden Kapiteln detailliert erörterten Presseberichten schließen, in denen meist auf die vorige
und die nächste Etappe verwiesen wird. Lediglich für das Jahr 1941, in welchem die Exposition in kurzem Turnus in (zunächst
schlesischen) Kleinstädten zum Aufbau kam (vgl. Kapitel 6.3.11 und 6.3.12), ist mit Lücken zu rechnen. Unter Zugrundelegung
der bekannten Daten ist die von Adams (1993, S. 62) und Hoffmann-Curtius (1990, S. 62 und S. 88) genannte Zahl von 35 Aus-
stellungsetappen rein rechnerisch auszuschließen.
229
Institut sei
die einzige fachliche Dienststelle, die im gesamten Reichsgebiet jedwedem Ausstellungsbedarf gerecht wird. Es gewährleistet
durch seinen ausstellungsmäßig geübten Sachbearbeiterkreis jeder Veranstaltung ihre Schlagkraft durch Gestaltung und
Besucherpropaganda, die weitmöglichste Erreichung des jeweils gesteckten Zieles.3°
Welche Mitarbeiter des Instituts waren für die Tournee der Femeschau zuständig? Als Ausstellungsleiter für die
Etappen Berlin, Leipzig, Düsseldorf und Salzburg wurde Hartmut Pistauer eingesetzt, anschließend übernahm Lud-
wig Wang den Posten. Wie Pistauer so hatte auch Wang, über dessen Herkunft nichts Weiteres bekannt ist,
zunächst im Studentischen Führungsdienst der Universität München und dann beim Aufbau der Ausstellung »Ent-
artete Kunst« mitgearbeitet. Auf den folgenden Stationen gehörte er zum Team Pistauers. Dessen Aussagen (Dok.
74) erhellen Details der administrativ-organisatorischen Abwicklung. Die Ausstellungsleiter erhielten ihre Instruk-
tionen von der Berliner Institutszentrale. Als Kontakt- und Verbindungsperson fungierte offenbar Wilhelm Nieder-
ste-Ostholt, Fachbeiratsvorsitzender des Instituts und zugleich Geschäftsführer der Reichspropagandaleitung in
München.31 Dorthin hatten sich gemäß dem eingangs zitierten Telegramm die interessierten Städte zu wenden,
hier fielen die Entscheidungen über die einzelnen Ausstellungsetappen. Die Berliner Institutszentrale schickte
dann die Ausstellungsleiter mit einem kleinen Team an den neuen Einsatzort, wo alle nötigen Vorbereitungen
getroffen werden mußten. Diese bestanden zunächst aus der Kontaktaufhahme mit den örtlichen Parteistellen (die
Gau- bzw. Kreisleitungen der NSDAP zeichneten jeweils als lokaler Veranstalter der Schau), welche über den Aus-
stellungsort zu entscheiden hatten und für die Propaganda (Presse, Herstellung von Plakaten, Kartenvorverkauf,
Organisation von Sonderzügen etc.) verantwortlich waren. Die Wahl der jeweiligen Räumlichkeiten war, ebenfalls
nach den Aussagen Pistauers, kein einfaches Unterfangen, da die Unterbringung in Museen und Kunstausstellungs-
räumen nach Möglichkeit vermieden werden sollte. Dies Bestreben war durchaus konsequent und belegt, daß die
Nationalsozialisten der Ausstellung auch äußerlich den Charakter einer »Lehrschau« verleihen wollten. In Hamburg,
Stettin, Chemnitz, Waldenburg und Halle entschied man sich für Gebäude der Volksbildung oder der Partei. In den
übrigen Städten aber wurde, wohl in Ermangelung von Alternativen, auf museale Kunstpräsentationsräume zurückge-
griffen - ein paradoxer Sachverhalt, da der »entarteten Kunst« jeder Kunstwert abgesprochen wurde, sie auch prak-
tisch nicht versichert war.32 Unterdessen richtete der Vertreter des Instituts ein Ausstellungsbüro em, engagierte Perso-
nal und verwaltete das Finanzbudget. Gemeinsam mit den Parteistellen wurde die Eröffhungszeremonie vorbereitet.
Sie verlief stets nach demselben Schema: musikalische Einrahmung, Reden der Gauleiter oder anderer Repräsentan-
ten der Partei, »Sieg-Heil« auf den »Führer«, Rundgang mit Führung des Ausstellungsleiters. Der war auch für die
Organisation von Führungen während der durchschnittlich vierwöchigen Laufzeit der Schau verantwortlich. Nach
jeder Station erging ein schriftlicher Bericht samt Abrechnung an die Reichspropagandaleitung.
Überblickt man das Ausstellungsitinerar (Abb. 3) - dessen in Kapitel 6.3 erstmals vorgenommene Rekonstruk-
tion als weitgehend vollständig gelten darf33 - so zeigt sich, daß zehn der 13 Orte in Deutschland und Oster-
30 Institut für Deutsche Wirtschaftspropaganda 1936, o. S.
31 Niederste-Ostholt war es, der am 22. Januar 1938 offiziell die Werke aus der Prinzhom-Sammlung bei der Heidelberger Psychia-
trischen Universitätsklinik anforderte (Dok. 45). Vgl. Kapitel 6.3.1.
32 Am 18. Februar 1938 fragte Pistauer bei Franz Hofmann, Propagandaministerium, nach, ob die Exponate zu versichern seien
(ZSTA 50.01-743, Bl. 32). Der Abteilungsleiter antwortete am 3. März 1938, er halte »eine pro forma-Versicherung von 20.000
RM vorschlagsweise für hinreichend«, da den Ausstellungsstücken »lediglich im Hinblick auf den Zweck der Belehrung und Auf-
klärung ein Wert« zukomme (Dok. 42).
33 Das läßt sich aus den in den folgenden Kapiteln detailliert erörterten Presseberichten schließen, in denen meist auf die vorige
und die nächste Etappe verwiesen wird. Lediglich für das Jahr 1941, in welchem die Exposition in kurzem Turnus in (zunächst
schlesischen) Kleinstädten zum Aufbau kam (vgl. Kapitel 6.3.11 und 6.3.12), ist mit Lücken zu rechnen. Unter Zugrundelegung
der bekannten Daten ist die von Adams (1993, S. 62) und Hoffmann-Curtius (1990, S. 62 und S. 88) genannte Zahl von 35 Aus-
stellungsetappen rein rechnerisch auszuschließen.
229