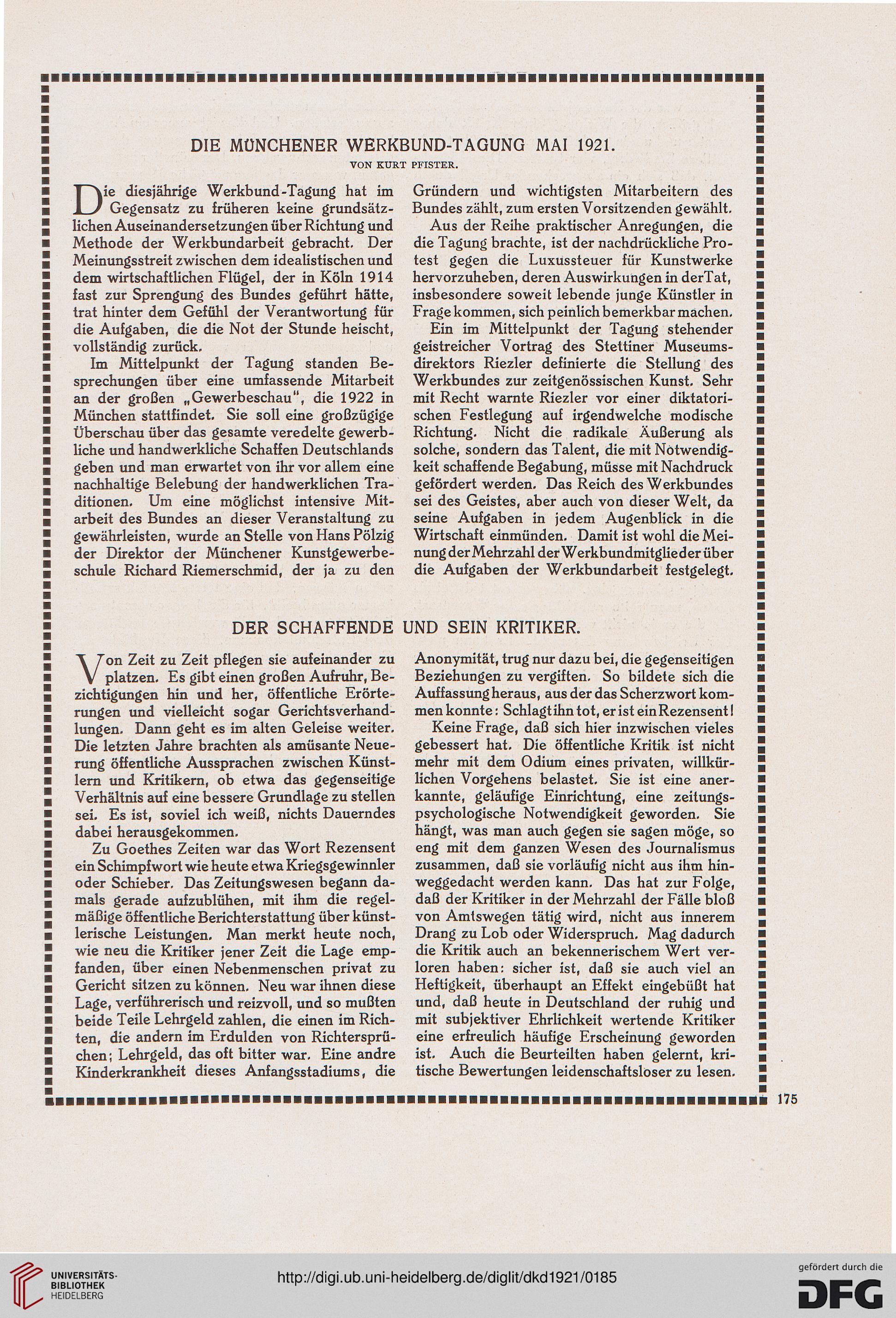DIE MÜNCHENER WERKBUND-TAGUNG MAI 1921.
VON KURT PFISTER.
Die diesjährige Werkbund-Tagung hat im
Gegensatz zu früheren keine grundsätz-
lichen Auseinandersetzungen über Richtung und
Methode der Werkbundarbeit gebracht. Der
Meinungsstreit zwischen dem idealistischen und
dem wirtschaftlichen Flügel, der in Köln 1914
fast zur Sprengung des Bundes geführt hätte,
trat hinter dem Gefühl der Verantwortung für
die Aufgaben, die die Not der Stunde heischt,
vollständig zurück.
Im Mittelpunkt der Tagung standen Be-
sprechungen über eine umfassende Mitarbeit
an der großen „Gewerbeschau", die 1922 in
München stattfindet. Sie soll eine großzügige
Überschau über das gesamte veredelte gewerb-
liche und handwerkliche Schaffen Deutschlands
geben und man erwartet von ihr vor allem eine
nachhaltige Belebung der handwerklichen Tra-
ditionen. Um eine möglichst intensive Mit-
arbeit des Bundes an dieser Veranstaltung zu
gewährleisten, wurde an Stelle von Hans Pölzig
der Direktor der Münchener Kunstgewerbe-
schule Richard Riemerschmid, der ja zu den
Gründern und wichtigsten Mitarbeitern des
Bundes zählt, zum ersten Vorsitzenden gewählt.
Aus der Reihe praktischer Anregungen, die
die Tagung brachte, ist der nachdrückliche Pro-
test gegen die Luxussteuer für Kunstwerke
hervorzuheben, deren Auswirkungen in derTat,
insbesondere soweit lebende junge Künstler in
Frage kommen, sich peinlich bemerkbar machen.
Ein im Mittelpunkt der Tagung stehender
geistreicher Vortrag des Stettiner Museums-
direktors Riezler definierte die Stellung des
Werkbundes zur zeitgenössischen Kunst. Sehr
mit Recht warnte Riezler vor einer diktatori-
schen Festlegung auf irgendwelche modische
Richtung. Nicht die radikale Äußerung als
solche, sondern das Talent, die mit Notwendig-
keit schaffende Begabung, müsse mit Nachdruck
gefördert werden. Das Reich des Werkbundes
sei des Geistes, aber auch von dieser Welt, da
seine Aufgaben in jedem Augenblick in die
Wirtschaft einmünden. Damit ist wohl die Mei-
nung der Mehrz ahl der Werkb undmitglie d er üb er
die Aufgaben der Werkbundarbeit festgelegt.
DER SCHAFFENDE UND SEIN KRITIKER.
Von Zeit zu Zeit pflegen sie aufeinander zu
platzen. Es gibt einen großen Aufruhr, Be-
zichtigungen hin und her, öffentliche Erörte-
rungen und vielleicht sogar Gerichtsverhand-
lungen. Dann geht es im alten Geleise weiter.
Die letzten Jahre brachten als amüsante Neue-
rung öffentliche Aussprachen zwischen Künst-
lern und Kritikern, ob etwa das gegenseitige
Verhältnis auf eine bessere Grundlage zu stellen
sei. Es ist, soviel ich weiß, nichts Dauerndes
dabei herausgekommen.
Zu Goethes Zeiten war das Wort Rezensent
ein Schimpfwort wie heute etwa Kriegsgewinnler
oder Schieber. Das Zeitungswesen begann da-
mals gerade aufzublühen, mit ihm die regel-
mäßige öffentliche Berichterstattung über künst-
lerische Leistungen. Man merkt heute noch,
wie neu die Kritiker jener Zeit die Lage emp-
fanden, über einen Nebenmenschen privat zu
Gericht sitzen zu können. Neu war ihnen diese
Lage, verführerisch und reizvoll, und so mußten
beide Teile Lehrgeld zahlen, die einen im Rich-
ten, die andern im Erdulden von Richtersprü-
chen; Lehrgeld, das oft bitter war. Eine andre
Kinderkrankheit dieses Anfangsstadiums, die
Anonymität, trug nur dazu bei, die gegenseitigen
Beziehungen zu vergiften. So bildete sich die
Auffassung heraus, aus der das Scherzwort kom-
men konnte: Schlagt ihn tot, er ist ein Rezensent I
Keine Frage, daß sich hier inzwischen vieles
gebessert hat. Die öffentliche Kritik ist nicht
mehr mit dem Odium eines privaten, willkür-
lichen Vorgehens belastet. Sie ist eine aner-
kannte, geläufige Einrichtung, eine zeitungs-
psychologische Notwendigkeit geworden. Sie
hängt, was man auch gegen sie sagen möge, so
eng mit dem ganzen Wesen des Journalismus
zusammen, daß sie vorläufig nicht aus ihm hin-
weggedacht werden kann. Das hat zur Folge,
daß der Kritiker in der Mehrzahl der Fälle bloß
von Amtswegen tätig wird, nicht aus innerem
Drang zu Lob oder Widerspruch. Mag dadurch
die Kritik auch an bekennerischem Wert ver-
loren haben: sicher ist, daß sie auch viel an
Heftigkeit, überhaupt an Effekt eingebüßt hat
und, daß heute in Deutschland der ruhig und
mit subjektiver Ehrlichkeit wertende Kritiker
eine erfreulich häufige Erscheinung geworden
ist. Auch die Beurteilten haben gelernt, kri-
tische Bewertungen leidenschaftsloser zu lesen.
VON KURT PFISTER.
Die diesjährige Werkbund-Tagung hat im
Gegensatz zu früheren keine grundsätz-
lichen Auseinandersetzungen über Richtung und
Methode der Werkbundarbeit gebracht. Der
Meinungsstreit zwischen dem idealistischen und
dem wirtschaftlichen Flügel, der in Köln 1914
fast zur Sprengung des Bundes geführt hätte,
trat hinter dem Gefühl der Verantwortung für
die Aufgaben, die die Not der Stunde heischt,
vollständig zurück.
Im Mittelpunkt der Tagung standen Be-
sprechungen über eine umfassende Mitarbeit
an der großen „Gewerbeschau", die 1922 in
München stattfindet. Sie soll eine großzügige
Überschau über das gesamte veredelte gewerb-
liche und handwerkliche Schaffen Deutschlands
geben und man erwartet von ihr vor allem eine
nachhaltige Belebung der handwerklichen Tra-
ditionen. Um eine möglichst intensive Mit-
arbeit des Bundes an dieser Veranstaltung zu
gewährleisten, wurde an Stelle von Hans Pölzig
der Direktor der Münchener Kunstgewerbe-
schule Richard Riemerschmid, der ja zu den
Gründern und wichtigsten Mitarbeitern des
Bundes zählt, zum ersten Vorsitzenden gewählt.
Aus der Reihe praktischer Anregungen, die
die Tagung brachte, ist der nachdrückliche Pro-
test gegen die Luxussteuer für Kunstwerke
hervorzuheben, deren Auswirkungen in derTat,
insbesondere soweit lebende junge Künstler in
Frage kommen, sich peinlich bemerkbar machen.
Ein im Mittelpunkt der Tagung stehender
geistreicher Vortrag des Stettiner Museums-
direktors Riezler definierte die Stellung des
Werkbundes zur zeitgenössischen Kunst. Sehr
mit Recht warnte Riezler vor einer diktatori-
schen Festlegung auf irgendwelche modische
Richtung. Nicht die radikale Äußerung als
solche, sondern das Talent, die mit Notwendig-
keit schaffende Begabung, müsse mit Nachdruck
gefördert werden. Das Reich des Werkbundes
sei des Geistes, aber auch von dieser Welt, da
seine Aufgaben in jedem Augenblick in die
Wirtschaft einmünden. Damit ist wohl die Mei-
nung der Mehrz ahl der Werkb undmitglie d er üb er
die Aufgaben der Werkbundarbeit festgelegt.
DER SCHAFFENDE UND SEIN KRITIKER.
Von Zeit zu Zeit pflegen sie aufeinander zu
platzen. Es gibt einen großen Aufruhr, Be-
zichtigungen hin und her, öffentliche Erörte-
rungen und vielleicht sogar Gerichtsverhand-
lungen. Dann geht es im alten Geleise weiter.
Die letzten Jahre brachten als amüsante Neue-
rung öffentliche Aussprachen zwischen Künst-
lern und Kritikern, ob etwa das gegenseitige
Verhältnis auf eine bessere Grundlage zu stellen
sei. Es ist, soviel ich weiß, nichts Dauerndes
dabei herausgekommen.
Zu Goethes Zeiten war das Wort Rezensent
ein Schimpfwort wie heute etwa Kriegsgewinnler
oder Schieber. Das Zeitungswesen begann da-
mals gerade aufzublühen, mit ihm die regel-
mäßige öffentliche Berichterstattung über künst-
lerische Leistungen. Man merkt heute noch,
wie neu die Kritiker jener Zeit die Lage emp-
fanden, über einen Nebenmenschen privat zu
Gericht sitzen zu können. Neu war ihnen diese
Lage, verführerisch und reizvoll, und so mußten
beide Teile Lehrgeld zahlen, die einen im Rich-
ten, die andern im Erdulden von Richtersprü-
chen; Lehrgeld, das oft bitter war. Eine andre
Kinderkrankheit dieses Anfangsstadiums, die
Anonymität, trug nur dazu bei, die gegenseitigen
Beziehungen zu vergiften. So bildete sich die
Auffassung heraus, aus der das Scherzwort kom-
men konnte: Schlagt ihn tot, er ist ein Rezensent I
Keine Frage, daß sich hier inzwischen vieles
gebessert hat. Die öffentliche Kritik ist nicht
mehr mit dem Odium eines privaten, willkür-
lichen Vorgehens belastet. Sie ist eine aner-
kannte, geläufige Einrichtung, eine zeitungs-
psychologische Notwendigkeit geworden. Sie
hängt, was man auch gegen sie sagen möge, so
eng mit dem ganzen Wesen des Journalismus
zusammen, daß sie vorläufig nicht aus ihm hin-
weggedacht werden kann. Das hat zur Folge,
daß der Kritiker in der Mehrzahl der Fälle bloß
von Amtswegen tätig wird, nicht aus innerem
Drang zu Lob oder Widerspruch. Mag dadurch
die Kritik auch an bekennerischem Wert ver-
loren haben: sicher ist, daß sie auch viel an
Heftigkeit, überhaupt an Effekt eingebüßt hat
und, daß heute in Deutschland der ruhig und
mit subjektiver Ehrlichkeit wertende Kritiker
eine erfreulich häufige Erscheinung geworden
ist. Auch die Beurteilten haben gelernt, kri-
tische Bewertungen leidenschaftsloser zu lesen.