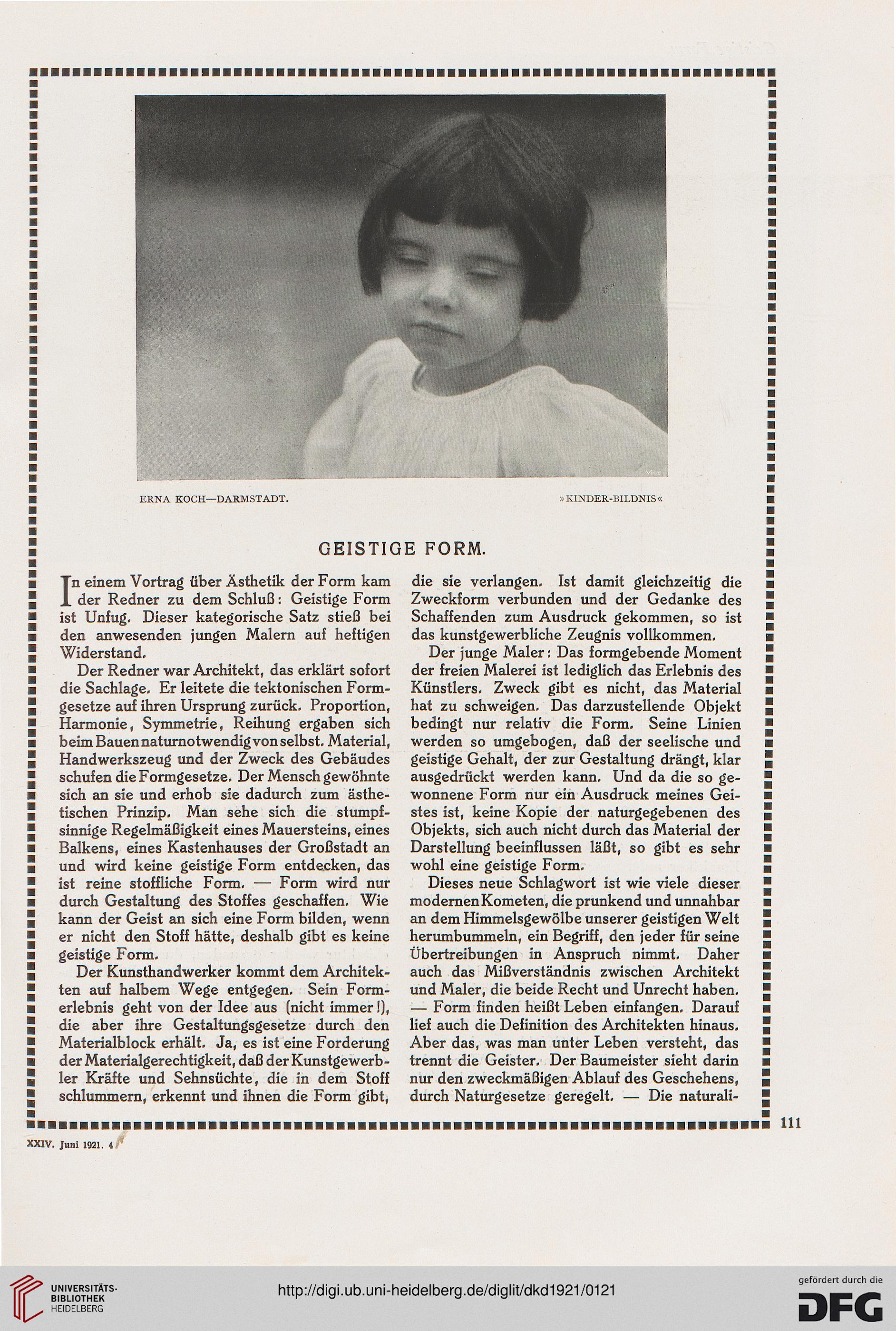ERNA KOCH—DARMSTADT.
»KINDER-BILDNIS«
GEISTIGE FORM.
In einem Vortrag über Ästhetik der Form kam
der Redner zu dem Schluß: Geistige Form
ist Unfug. Dieser kategorische Satz stieß bei
den anwesenden jungen Malern auf heftigen
Widerstand.
Der Redner war Architekt, das erklärt sofort
die Sachlage. Er leitete die tektonischen Form-
gesetze auf ihren Ursprung zurück. Proportion,
Harmonie, Symmetrie, Reihung ergaben sich
beim Bauen naturnotwendig vonselbst. Material,
Handwerkszeug und der Zweck des Gebäudes
schufen die Formgesetze. Der Mensch gewöhnte
sich an sie und erhob sie dadurch zum ästhe-
tischen Prinzip. Man sehe sich die stumpf-
sinnige Regelmäßigkeit eines Mauersteins, eines
Balkens, eines Kastenhauses der Großstadt an
und wird keine geistige Form entdecken, das
ist reine stoffliche Form. — Form wird nur
durch Gestaltung des Stoffes geschaffen. Wie
kann der Geist an sich eine Form bilden, wenn
er nicht den Stoff hätte, deshalb gibt es keine
geistige Form.
Der Kunsthandwerker kommt dem Architek-
ten auf halbem Wege entgegen. Sein Form-
erlebnis geht von der Idee aus (nicht immer!),
die aber ihre Gestaltungsgesetze durch den
Materialblock erhält. Ja, es ist eine Forderung
der Materialgerechtigkeit, daß der Kunstgewerb-
ler Kräfte und Sehnsüchte, die in dem Stoff
schlummern, erkennt und ihnen die Form gibt,
die sie verlangen. Ist damit gleichzeitig die
Zweckform verbunden und der Gedanke des
Schaffenden zum Ausdruck gekommen, so ist
das kunstgewerbliche Zeugnis vollkommen.
Der junge Maler: Das formgebende Moment
der freien Malerei ist lediglich das Erlebnis des
Künstlers. Zweck gibt es nicht, das Material
hat zu schweigen. Das darzustellende Objekt
bedingt nur relativ die Form. Seine Linien
werden so umgebogen, daß der seelische und
geistige Gehalt, der zur Gestaltung drängt, klar
ausgedrückt werden kann. Und da die so ge-
wonnene Form nur ein Ausdruck meines Gei-
stes ist, keine Kopie der naturgegebenen des
Objekts, sich auch nicht durch das Material der
Darstellung beeinflussen läßt, so gibt es sehr
wohl eine geistige Form.
Dieses neue Schlagwort ist wie viele dieser
modernen Kometen, die prunkend und unnahbar
an dem Himmelsgewölbe unserer geistigen Welt
herumbummeln, ein Begriff, den jeder für seine
Übertreibungen in Anspruch nimmt. Daher
auch das Mißverständnis zwischen Architekt
und Maler, die beide Recht und Unrecht haben.
— Form finden heißt Leben einfangen. Darauf
lief auch die Definition des Architekten hinaus.
Aber das, was man unter Leben versteht, das
trennt die Geister. Der Baumeister sieht darin
nur den zweckmäßigen Ablauf des Geschehens,
durch Naturgesetze geregelt. — Die naturali-
111
XXIV. Juni 1921. 4 ""
»KINDER-BILDNIS«
GEISTIGE FORM.
In einem Vortrag über Ästhetik der Form kam
der Redner zu dem Schluß: Geistige Form
ist Unfug. Dieser kategorische Satz stieß bei
den anwesenden jungen Malern auf heftigen
Widerstand.
Der Redner war Architekt, das erklärt sofort
die Sachlage. Er leitete die tektonischen Form-
gesetze auf ihren Ursprung zurück. Proportion,
Harmonie, Symmetrie, Reihung ergaben sich
beim Bauen naturnotwendig vonselbst. Material,
Handwerkszeug und der Zweck des Gebäudes
schufen die Formgesetze. Der Mensch gewöhnte
sich an sie und erhob sie dadurch zum ästhe-
tischen Prinzip. Man sehe sich die stumpf-
sinnige Regelmäßigkeit eines Mauersteins, eines
Balkens, eines Kastenhauses der Großstadt an
und wird keine geistige Form entdecken, das
ist reine stoffliche Form. — Form wird nur
durch Gestaltung des Stoffes geschaffen. Wie
kann der Geist an sich eine Form bilden, wenn
er nicht den Stoff hätte, deshalb gibt es keine
geistige Form.
Der Kunsthandwerker kommt dem Architek-
ten auf halbem Wege entgegen. Sein Form-
erlebnis geht von der Idee aus (nicht immer!),
die aber ihre Gestaltungsgesetze durch den
Materialblock erhält. Ja, es ist eine Forderung
der Materialgerechtigkeit, daß der Kunstgewerb-
ler Kräfte und Sehnsüchte, die in dem Stoff
schlummern, erkennt und ihnen die Form gibt,
die sie verlangen. Ist damit gleichzeitig die
Zweckform verbunden und der Gedanke des
Schaffenden zum Ausdruck gekommen, so ist
das kunstgewerbliche Zeugnis vollkommen.
Der junge Maler: Das formgebende Moment
der freien Malerei ist lediglich das Erlebnis des
Künstlers. Zweck gibt es nicht, das Material
hat zu schweigen. Das darzustellende Objekt
bedingt nur relativ die Form. Seine Linien
werden so umgebogen, daß der seelische und
geistige Gehalt, der zur Gestaltung drängt, klar
ausgedrückt werden kann. Und da die so ge-
wonnene Form nur ein Ausdruck meines Gei-
stes ist, keine Kopie der naturgegebenen des
Objekts, sich auch nicht durch das Material der
Darstellung beeinflussen läßt, so gibt es sehr
wohl eine geistige Form.
Dieses neue Schlagwort ist wie viele dieser
modernen Kometen, die prunkend und unnahbar
an dem Himmelsgewölbe unserer geistigen Welt
herumbummeln, ein Begriff, den jeder für seine
Übertreibungen in Anspruch nimmt. Daher
auch das Mißverständnis zwischen Architekt
und Maler, die beide Recht und Unrecht haben.
— Form finden heißt Leben einfangen. Darauf
lief auch die Definition des Architekten hinaus.
Aber das, was man unter Leben versteht, das
trennt die Geister. Der Baumeister sieht darin
nur den zweckmäßigen Ablauf des Geschehens,
durch Naturgesetze geregelt. — Die naturali-
111
XXIV. Juni 1921. 4 ""