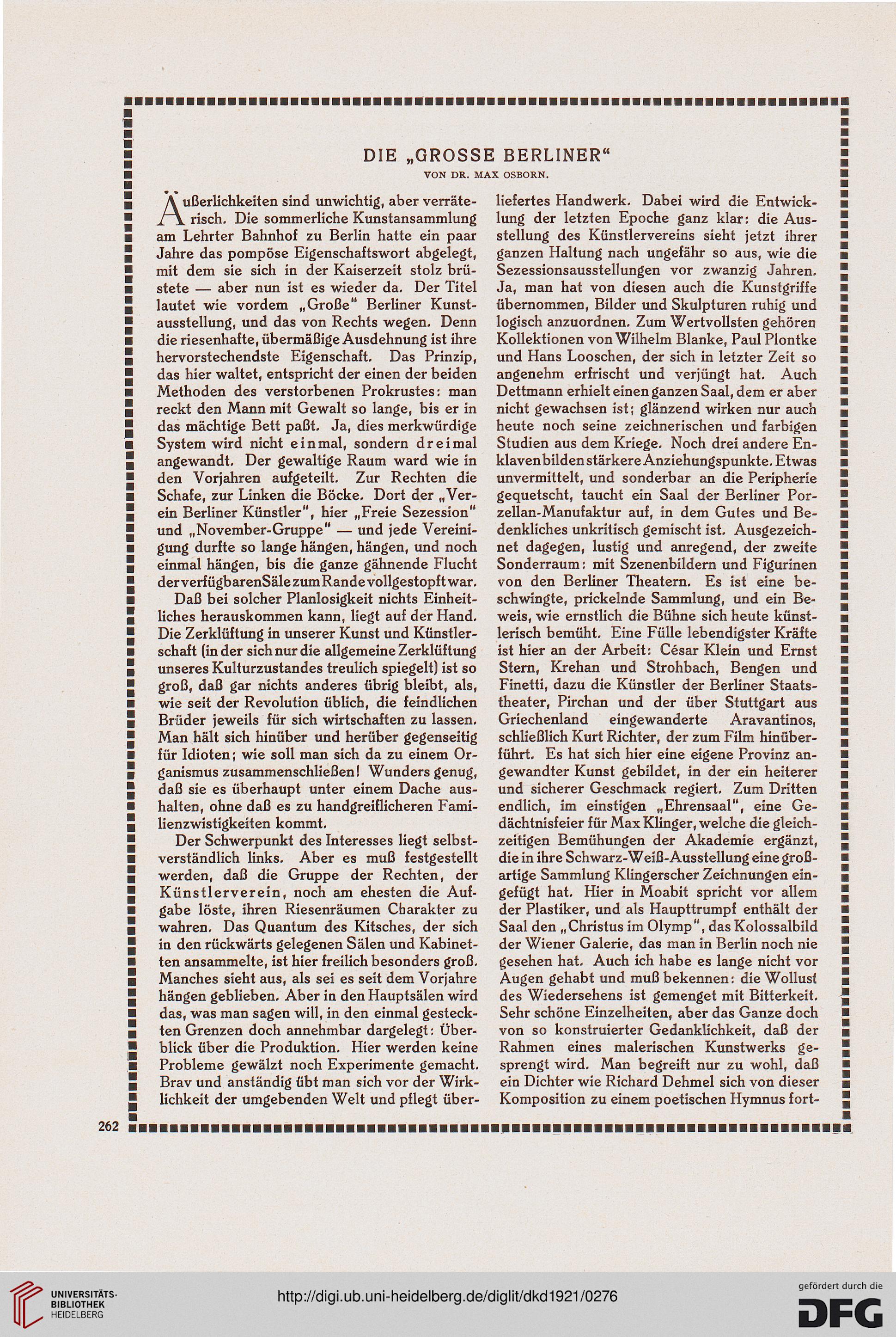DIE „GROSSE BERLINER"
VON DR. MAX OSBORN.
Äußerlichkeiten sind unwichtig, aber verräte-
. risch. Die sommerliche Kunstansammlung
am Lehrter Bahnhof zu Berlin hatte ein paar
Jahre das pompöse Eigenschaftswort abgelegt,
mit dem sie sich in der Kaiserzeit stolz brü-
stete — aber nun ist es wieder da. Der Titel
lautet wie vordem „Große" Berliner Kunst-
ausstellung, und das von Rechts wegen. Denn
die riesenhafte, übermäßige Ausdehnung ist ihre
hervorstechendste Eigenschaft. Das Prinzip,
das hier waltet, entspricht der einen der beiden
Methoden des verstorbenen Prokrustes: man
reckt den Mann mit Gewalt so lange, bis er in
das mächtige Bett paßt. Ja, dies merkwürdige
System wird nicht einmal, sondern dreimal
angewandt. Der gewaltige Raum ward wie in
den Vorjahren aufgeteilt. Zur Rechten die
Schafe, zur Linken die Böcke. Dort der „Ver-
ein Berliner Künstler", hier „Freie Sezession"
und „November-Gruppe" — und jede Vereini-
gung durfte so lange hängen, hängen, und noch
einmal hängen, bis die ganze gähnende Flucht
derverfügbarenSälezumRande vollgestopft war.
Daß bei solcher Planlosigkeit nichts Einheit-
liches herauskommen kann, liegt auf der Hand.
Die Zerklüftung in unserer Kunst und Künstler-
schaft (in der sich nur die allgemeine Zerklüftung
unseres Kulturzustandes treulich spiegelt) ist so
groß, daß gar nichts anderes übrig bleibt, als,
wie seit der Revolution üblich, die feindlichen
Brüder jeweils für sich wirtschaften zu lassen.
Man hält sich hinüber und herüber gegenseitig
für Idioten; wie soll man sich da zu einem Or-
ganismus zusammenschließen! Wunders genug,
daß sie es überhaupt unter einem Dache aus-
halten, ohne daß es zu handgreiflicheren Fami-
lienzwistigkeiten kommt.
Der Schwerpunkt des Interesses liegt selbst-
verständlich links. Aber es muß festgestellt
werden, daß die Gruppe der Rechten, der
Künstlerverein, noch am ehesten die Auf-
gabe löste, ihren Riesenräumen Charakter zu
wahren. Das Quantum des Kitsches, der sich
in den rückwärts gelegenen Sälen und Kabinet-
ten ansammelte, ist hier freilich besonders groß.
Manches sieht aus, als sei es seit dem Vorjahre
hängen geblieben. Aber in den Hauptsälen wird
das, was man sagen will, in den einmal gesteck-
ten Grenzen doch annehmbar dargelegt: Über-
blick über die Produktion. Hier werden keine
Probleme gewälzt noch Experimente gemacht.
Brav und anständig übt man sich vor der Wirk-
lichkeit der umgebenden Welt und pflegt über-
liefertes Handwerk. Dabei wird die Entwick-
lung der letzten Epoche ganz klar: die Aus-
stellung des Künstlervereins sieht jetzt ihrer
ganzen Haltung nach ungefähr so aus, wie die
Sezessionsausstellungen vor zwanzig Jahren.
Ja, man hat von diesen auch die Kunstgriffe
übernommen, Bilder und Skulpturen ruhig und
logisch anzuordnen. Zum Wertvollsten gehören
Kollektionen von Wilhelm Blanke, Paul Plontke
und Hans Looschen, der sich in letzter Zeit so
angenehm erfrischt und verjüngt hat. Auch
Dettmann erhielt einen ganzen Saal, dem er aber
nicht gewachsen ist; glänzend wirken nur auch
heute noch seine zeichnerischen und farbigen
Studien aus dem Kriege. Noch drei andere En-
klavenbilden stärkere Anziehungspunkte. Etwas
unvermittelt, und sonderbar an die Peripherie
gequetscht, taucht ein Saal der Berliner Por-
zellan-Manufaktur auf, in dem Gutes und Be-
denkliches unkritisch gemischt ist. Ausgezeich-
net dagegen, lustig und anregend, der zweite
Sonderraum: mit Szenenbildern und Figurinen
von den Berliner Theatern. Es ist eine be-
schwingte, prickelnde Sammlung, und ein Be-
weis, wie ernstlich die Bühne sich heute künst-
lerisch bemüht. Eine Fülle lebendigster Kräfte
ist hier an der Arbeit: Cesar Klein und Ernst
Stern, Krehan und Strohbach, Bengen und
Finetti, dazu die Künstler der Berliner Staats-
theater, Pirchan und der über Stuttgart aus
Griechenland eingewanderte Aravantinos,
schließlich Kurt Richter, der zum Film hinüber-
führt. Es hat sich hier eine eigene Provinz an-
gewandter Kunst gebildet, in der ein heiterer
und sicherer Geschmack regiert. Zum Dritten
endlich, im einstigen „Ehrensaal", eine Ge-
dächtnisfeier für Max Klinger, welche die gleich-
zeitigen Bemühungen der Akademie ergänzt,
die in ihre Schwarz-Weiß-Ausstellung eine groß-
artige Sammlung Klingerscher Zeichnungen ein-
gefügt hat. Hier in Moabit spricht vor allem
der Plastiker, und als Haupttrumpf enthält der
Saal den „Christus im Olymp", das Kolossalbild
der Wiener Galerie, das man in Berlin noch nie
gesehen hat. Auch ich habe es lange nicht vor
Augen gehabt und muß bekennen: die Wollust
des Wiedersehens ist gemenget mit Bitterkeit.
Sehr schöne Einzelheiten, aber das Ganze doch
von so konstruierter Gedanklichkeit, daß der
Rahmen eines malerischen Kunstwerks ge-
sprengt wird. Man begreift nur zu wohl, daß
ein Dichter wie Richard Dehmel sich von dieser
Komposition zu einem poetischen Hymnus fort-
VON DR. MAX OSBORN.
Äußerlichkeiten sind unwichtig, aber verräte-
. risch. Die sommerliche Kunstansammlung
am Lehrter Bahnhof zu Berlin hatte ein paar
Jahre das pompöse Eigenschaftswort abgelegt,
mit dem sie sich in der Kaiserzeit stolz brü-
stete — aber nun ist es wieder da. Der Titel
lautet wie vordem „Große" Berliner Kunst-
ausstellung, und das von Rechts wegen. Denn
die riesenhafte, übermäßige Ausdehnung ist ihre
hervorstechendste Eigenschaft. Das Prinzip,
das hier waltet, entspricht der einen der beiden
Methoden des verstorbenen Prokrustes: man
reckt den Mann mit Gewalt so lange, bis er in
das mächtige Bett paßt. Ja, dies merkwürdige
System wird nicht einmal, sondern dreimal
angewandt. Der gewaltige Raum ward wie in
den Vorjahren aufgeteilt. Zur Rechten die
Schafe, zur Linken die Böcke. Dort der „Ver-
ein Berliner Künstler", hier „Freie Sezession"
und „November-Gruppe" — und jede Vereini-
gung durfte so lange hängen, hängen, und noch
einmal hängen, bis die ganze gähnende Flucht
derverfügbarenSälezumRande vollgestopft war.
Daß bei solcher Planlosigkeit nichts Einheit-
liches herauskommen kann, liegt auf der Hand.
Die Zerklüftung in unserer Kunst und Künstler-
schaft (in der sich nur die allgemeine Zerklüftung
unseres Kulturzustandes treulich spiegelt) ist so
groß, daß gar nichts anderes übrig bleibt, als,
wie seit der Revolution üblich, die feindlichen
Brüder jeweils für sich wirtschaften zu lassen.
Man hält sich hinüber und herüber gegenseitig
für Idioten; wie soll man sich da zu einem Or-
ganismus zusammenschließen! Wunders genug,
daß sie es überhaupt unter einem Dache aus-
halten, ohne daß es zu handgreiflicheren Fami-
lienzwistigkeiten kommt.
Der Schwerpunkt des Interesses liegt selbst-
verständlich links. Aber es muß festgestellt
werden, daß die Gruppe der Rechten, der
Künstlerverein, noch am ehesten die Auf-
gabe löste, ihren Riesenräumen Charakter zu
wahren. Das Quantum des Kitsches, der sich
in den rückwärts gelegenen Sälen und Kabinet-
ten ansammelte, ist hier freilich besonders groß.
Manches sieht aus, als sei es seit dem Vorjahre
hängen geblieben. Aber in den Hauptsälen wird
das, was man sagen will, in den einmal gesteck-
ten Grenzen doch annehmbar dargelegt: Über-
blick über die Produktion. Hier werden keine
Probleme gewälzt noch Experimente gemacht.
Brav und anständig übt man sich vor der Wirk-
lichkeit der umgebenden Welt und pflegt über-
liefertes Handwerk. Dabei wird die Entwick-
lung der letzten Epoche ganz klar: die Aus-
stellung des Künstlervereins sieht jetzt ihrer
ganzen Haltung nach ungefähr so aus, wie die
Sezessionsausstellungen vor zwanzig Jahren.
Ja, man hat von diesen auch die Kunstgriffe
übernommen, Bilder und Skulpturen ruhig und
logisch anzuordnen. Zum Wertvollsten gehören
Kollektionen von Wilhelm Blanke, Paul Plontke
und Hans Looschen, der sich in letzter Zeit so
angenehm erfrischt und verjüngt hat. Auch
Dettmann erhielt einen ganzen Saal, dem er aber
nicht gewachsen ist; glänzend wirken nur auch
heute noch seine zeichnerischen und farbigen
Studien aus dem Kriege. Noch drei andere En-
klavenbilden stärkere Anziehungspunkte. Etwas
unvermittelt, und sonderbar an die Peripherie
gequetscht, taucht ein Saal der Berliner Por-
zellan-Manufaktur auf, in dem Gutes und Be-
denkliches unkritisch gemischt ist. Ausgezeich-
net dagegen, lustig und anregend, der zweite
Sonderraum: mit Szenenbildern und Figurinen
von den Berliner Theatern. Es ist eine be-
schwingte, prickelnde Sammlung, und ein Be-
weis, wie ernstlich die Bühne sich heute künst-
lerisch bemüht. Eine Fülle lebendigster Kräfte
ist hier an der Arbeit: Cesar Klein und Ernst
Stern, Krehan und Strohbach, Bengen und
Finetti, dazu die Künstler der Berliner Staats-
theater, Pirchan und der über Stuttgart aus
Griechenland eingewanderte Aravantinos,
schließlich Kurt Richter, der zum Film hinüber-
führt. Es hat sich hier eine eigene Provinz an-
gewandter Kunst gebildet, in der ein heiterer
und sicherer Geschmack regiert. Zum Dritten
endlich, im einstigen „Ehrensaal", eine Ge-
dächtnisfeier für Max Klinger, welche die gleich-
zeitigen Bemühungen der Akademie ergänzt,
die in ihre Schwarz-Weiß-Ausstellung eine groß-
artige Sammlung Klingerscher Zeichnungen ein-
gefügt hat. Hier in Moabit spricht vor allem
der Plastiker, und als Haupttrumpf enthält der
Saal den „Christus im Olymp", das Kolossalbild
der Wiener Galerie, das man in Berlin noch nie
gesehen hat. Auch ich habe es lange nicht vor
Augen gehabt und muß bekennen: die Wollust
des Wiedersehens ist gemenget mit Bitterkeit.
Sehr schöne Einzelheiten, aber das Ganze doch
von so konstruierter Gedanklichkeit, daß der
Rahmen eines malerischen Kunstwerks ge-
sprengt wird. Man begreift nur zu wohl, daß
ein Dichter wie Richard Dehmel sich von dieser
Komposition zu einem poetischen Hymnus fort-