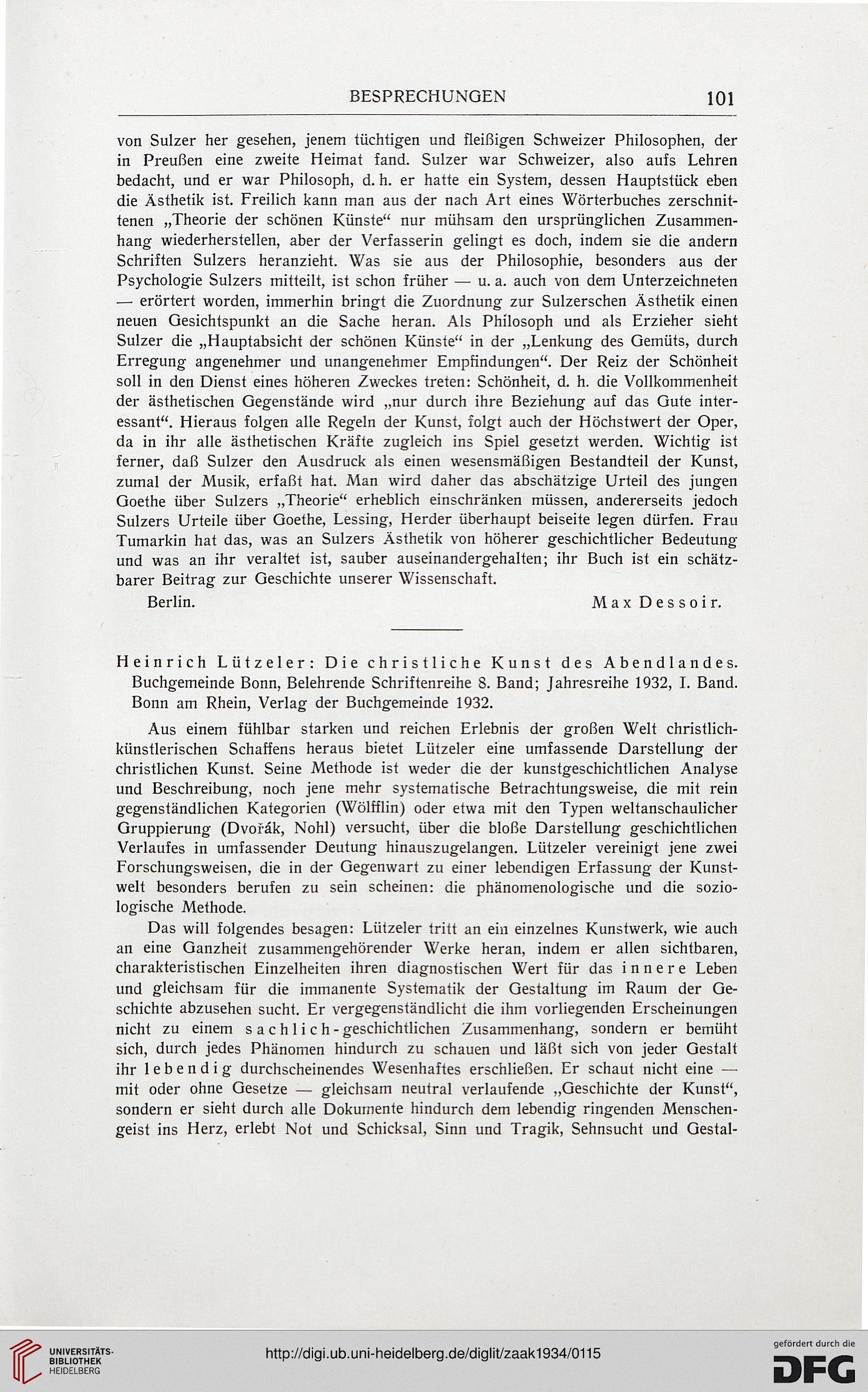BESPRECHUNGEN
101
von Sulzer her gesehen, jenem tüchtigen und fleißigen Schweizer Philosophen, der
in Preußen eine zweite Heimat fand. Sulzer war Schweizer, also aufs Lehren
bedacht, und er war Philosoph, d. h. er hatte ein System, dessen Hauptstück eben
die Ästhetik ist. Freilich kann man aus der nach Art eines Wörterbuches zerschnit-
tenen „Theorie der schönen Künste" nur mühsam den ursprünglichen Zusammen-
hang wiederherstellen, aber der Verfasserin gelingt es doch, indem sie die andern
Schriften Sulzers heranzieht. Was sie aus der Philosophie, besonders aus der
Psychologie Sulzers mitteilt, ist schon früher — u. a. auch von dem Unterzeichneten
— erörtert worden, immerhin bringt die Zuordnung zur Sulzerschen Ästhetik einen
neuen Gesichtspunkt an die Sache heran. Als Philosoph und als Erzieher sieht
Sulzer die „Hauptabsicht der schönen Künste" in der „Lenkung des Gemüts, durch
Erregung angenehmer und unangenehmer Empfindungen". Der Reiz der Schönheit
soll in den Dienst eines höheren Zweckes treten: Schönheit, d. h. die Vollkommenheit
der ästhetischen Gegenstände wird „nur durch ihre Beziehung auf das Gute inter-
essant". Hieraus folgen alle Regeln der Kunst, folgt auch der Höchstwert der Oper,
da in ihr alle ästhetischen Kräfte zugleich ins Spiel gesetzt werden. Wichtig ist
ferner, daß Sulzer den Ausdruck als einen wesensmäßigen Bestandteil der Kunst,
zumal der Musik, erfaßt hat. Man wird daher das abschätzige Urteil des jungen
Goethe über Sulzers „Theorie" erheblich einschränken müssen, andererseits jedoch
Sulzers Urteile über Goethe, Lessing, Herder überhaupt beiseite legen dürfen. Frau
Tumarkin hat das, was an Sulzers Ästhetik von höherer geschichtlicher Bedeutung
und was an ihr veraltet ist, sauber auseinandergehalten; ihr Buch ist ein schätz-
barer Beitrag zur Geschichte unserer Wissenschaft.
Berlin. Max Dessoir.
Heinrich Lützeler: Die christliche Kunst des Abendlandes.
Buchgemeinde Bonn, Belehrende Schriftenreihe 8. Band; Jahresreihe 1932, I. Band.
Bonn am Rhein, Verlag der Buchgemeinde 1932.
Aus einem fühlbar starken und reichen Erlebnis der großen Welt christlich-
künstlerischen Schaffens heraus bietet Lützeler eine umfassende Darstellung der
christlichen Kunst. Seine Methode ist weder die der kunstgeschichtlichen Analyse
und Beschreibung, noch jene mehr systematische Betrachtungsweise, die mit rein
gegenständlichen Kategorien (Wölfflin) oder etwa mit den Typen weltanschaulicher
Gruppierung (Dvorak, Nohl) versucht, über die bloße Darstellung geschichtlichen
Verlaufes in umfassender Deutung hinauszugelangen. Lützeler vereinigt jene zwei
Forschungsweisen, die in der Gegenwart zu einer lebendigen Erfassung der Kunst-
welt besonders berufen zu sein scheinen: die phänomenologische und die sozio-
logische Methode.
Das will folgendes besagen: Lützeler tritt an ein einzelnes Kunstwerk, wie auch
an eine Ganzheit zusammengehörender Werke heran, indem er allen sichtbaren,
charakteristischen Einzelheiten ihren diagnostischen Wert für das innere Leben
und gleichsam für die immanente Systematik der Gestaltung im Raum der Ge-
schichte abzusehen sucht. Er vergegenständlicht die ihm vorliegenden Erscheinungen
nicht zu einem sachlich- geschichtlichen Zusammenhang, sondern er bemüht
sich, durch jedes Phänomen hindurch zu schauen und läßt sich von jeder Gestalt
ihr lebendig durchscheinendes Wesenhaftes erschließen. Er schaut nicht eine —
mit oder ohne Gesetze — gleichsam neutral verlaufende „Geschichte der Kunst",
sondern er sieht durch alle Dokumente hindurch dem lebendig ringenden Menschen-
geist ins Herz, erlebt Not und Schicksal, Sinn und Tragik, Sehnsucht und Gestal-
101
von Sulzer her gesehen, jenem tüchtigen und fleißigen Schweizer Philosophen, der
in Preußen eine zweite Heimat fand. Sulzer war Schweizer, also aufs Lehren
bedacht, und er war Philosoph, d. h. er hatte ein System, dessen Hauptstück eben
die Ästhetik ist. Freilich kann man aus der nach Art eines Wörterbuches zerschnit-
tenen „Theorie der schönen Künste" nur mühsam den ursprünglichen Zusammen-
hang wiederherstellen, aber der Verfasserin gelingt es doch, indem sie die andern
Schriften Sulzers heranzieht. Was sie aus der Philosophie, besonders aus der
Psychologie Sulzers mitteilt, ist schon früher — u. a. auch von dem Unterzeichneten
— erörtert worden, immerhin bringt die Zuordnung zur Sulzerschen Ästhetik einen
neuen Gesichtspunkt an die Sache heran. Als Philosoph und als Erzieher sieht
Sulzer die „Hauptabsicht der schönen Künste" in der „Lenkung des Gemüts, durch
Erregung angenehmer und unangenehmer Empfindungen". Der Reiz der Schönheit
soll in den Dienst eines höheren Zweckes treten: Schönheit, d. h. die Vollkommenheit
der ästhetischen Gegenstände wird „nur durch ihre Beziehung auf das Gute inter-
essant". Hieraus folgen alle Regeln der Kunst, folgt auch der Höchstwert der Oper,
da in ihr alle ästhetischen Kräfte zugleich ins Spiel gesetzt werden. Wichtig ist
ferner, daß Sulzer den Ausdruck als einen wesensmäßigen Bestandteil der Kunst,
zumal der Musik, erfaßt hat. Man wird daher das abschätzige Urteil des jungen
Goethe über Sulzers „Theorie" erheblich einschränken müssen, andererseits jedoch
Sulzers Urteile über Goethe, Lessing, Herder überhaupt beiseite legen dürfen. Frau
Tumarkin hat das, was an Sulzers Ästhetik von höherer geschichtlicher Bedeutung
und was an ihr veraltet ist, sauber auseinandergehalten; ihr Buch ist ein schätz-
barer Beitrag zur Geschichte unserer Wissenschaft.
Berlin. Max Dessoir.
Heinrich Lützeler: Die christliche Kunst des Abendlandes.
Buchgemeinde Bonn, Belehrende Schriftenreihe 8. Band; Jahresreihe 1932, I. Band.
Bonn am Rhein, Verlag der Buchgemeinde 1932.
Aus einem fühlbar starken und reichen Erlebnis der großen Welt christlich-
künstlerischen Schaffens heraus bietet Lützeler eine umfassende Darstellung der
christlichen Kunst. Seine Methode ist weder die der kunstgeschichtlichen Analyse
und Beschreibung, noch jene mehr systematische Betrachtungsweise, die mit rein
gegenständlichen Kategorien (Wölfflin) oder etwa mit den Typen weltanschaulicher
Gruppierung (Dvorak, Nohl) versucht, über die bloße Darstellung geschichtlichen
Verlaufes in umfassender Deutung hinauszugelangen. Lützeler vereinigt jene zwei
Forschungsweisen, die in der Gegenwart zu einer lebendigen Erfassung der Kunst-
welt besonders berufen zu sein scheinen: die phänomenologische und die sozio-
logische Methode.
Das will folgendes besagen: Lützeler tritt an ein einzelnes Kunstwerk, wie auch
an eine Ganzheit zusammengehörender Werke heran, indem er allen sichtbaren,
charakteristischen Einzelheiten ihren diagnostischen Wert für das innere Leben
und gleichsam für die immanente Systematik der Gestaltung im Raum der Ge-
schichte abzusehen sucht. Er vergegenständlicht die ihm vorliegenden Erscheinungen
nicht zu einem sachlich- geschichtlichen Zusammenhang, sondern er bemüht
sich, durch jedes Phänomen hindurch zu schauen und läßt sich von jeder Gestalt
ihr lebendig durchscheinendes Wesenhaftes erschließen. Er schaut nicht eine —
mit oder ohne Gesetze — gleichsam neutral verlaufende „Geschichte der Kunst",
sondern er sieht durch alle Dokumente hindurch dem lebendig ringenden Menschen-
geist ins Herz, erlebt Not und Schicksal, Sinn und Tragik, Sehnsucht und Gestal-