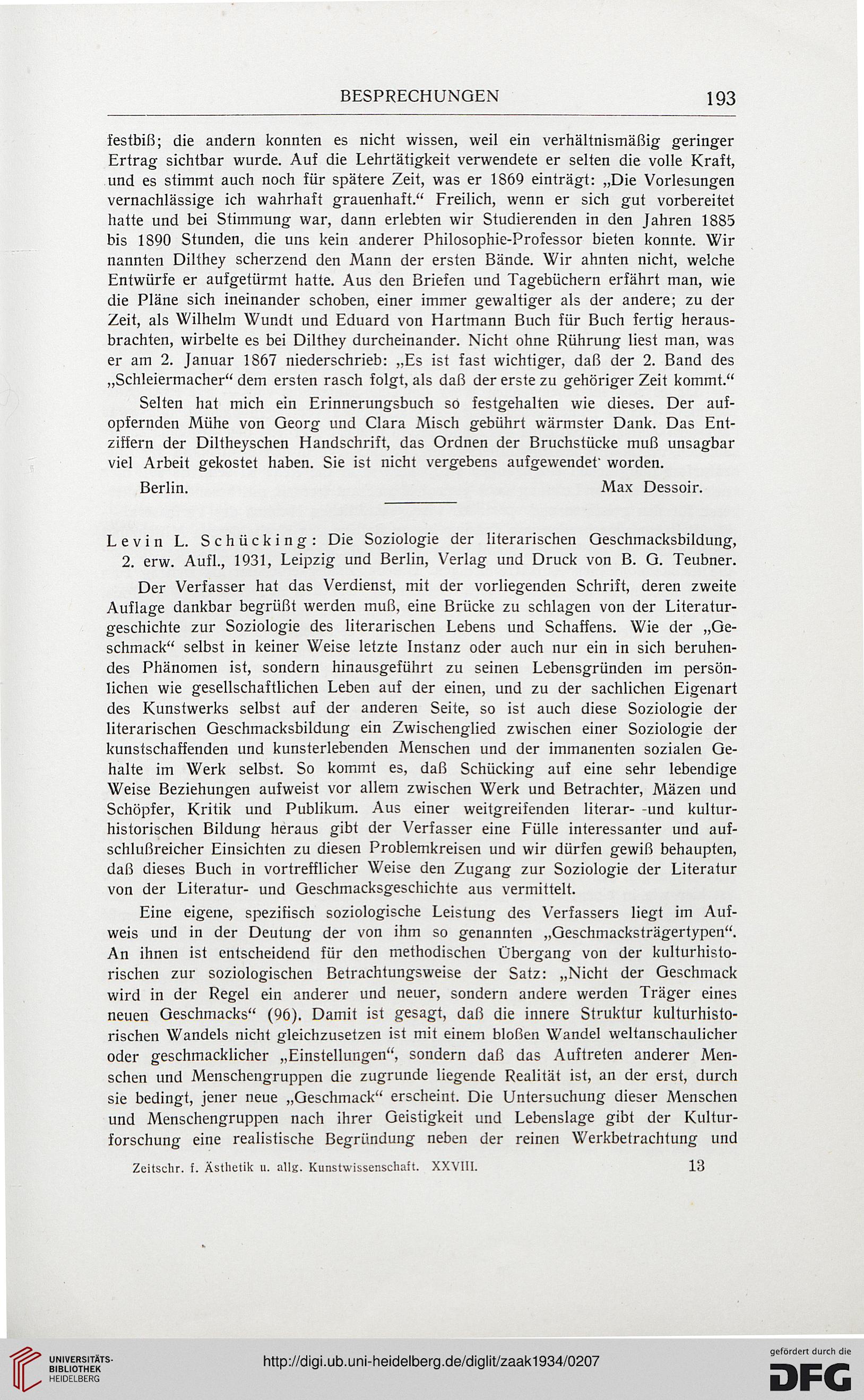BESPRECHUNGEN
193
i'estbiß; die andern konnten es nicht wissen, weil ein verhältnismäßig geringer
Ertrag sichtbar wurde. Auf die Lehrtätigkeit verwendete er selten die volle Kraft,
und es stimmt auch noch für spätere Zeit, was er 1869 einträgt: „Die Vorlesungen
vernachlässige ich wahrhaft grauenhaft." Freilich, wenn er sich gut vorbereitet
hatte und bei Stimmung war, dann erlebten wir Studierenden in den Jahren 1885
bis 1890 Stunden, die uns kein anderer Philosophie-Professor bieten konnte. Wir
nannten Dilthey scherzend den Mann der ersten Bände. Wir ahnten nicht, welche
Entwürfe er aufgetürmt hatte. Aus den Briefen und Tagebüchern erfährt man, wie
die Pläne sich ineinander schoben, einer immer gewaltiger als der andere; zu der
Zeit, als Wilhelm Wundt und Eduard von Hartmann Buch für Buch fertig heraus-
brachten, wirbelte es bei Dilthey durcheinander. Nicht ohne Rührung liest man, was
er am 2. Januar 1867 niederschrieb: „Es ist fast wichtiger, daß der 2. Band des
„Schleiermacher" dem ersten rasch folgt, als daß der erste zu gehöriger Zeit kommt."
Selten hat mich ein Erinnerungsbuch so festgehalten wie dieses. Der auf-
opfernden Mühe von Georg und Clara Misch gebührt wärmster Dank. Das Ent-
ziffern der Diltheyschen Handschrift, das Ordnen der Bruchstücke muß unsagbar
viel Arbeit gekostet haben. Sie ist nicht vergebens aufgewendet' worden.
Berlin. Max Dessoir.
Levin L. Schücking: Die Soziologie der literarischen Geschmacksbildung,
2. erw. Aufl., 1931, Leipzig und Berlin, Verlag und Druck von B. G. Teubner.
Der Verfasser hat das Verdienst, mit der vorliegenden Schrift, deren zweite
Auflage dankbar begrüßt werden muß, eine Brücke zu schlagen von der Literatur-
geschichte zur Soziologie des literarischen Lebens und Schaffens. Wie der „Ge-
schmack" selbst in keiner Weise letzte Instanz oder auch nur ein in sich beruhen-
des Phänomen ist, sondern hinausgeführt zu seinen Lebensgründen im persön-
lichen wie gesellschaftlichen Leben auf der einen, und zu der sachlichen Eigenart
des Kunstwerks selbst auf der anderen Seite, so ist auch diese Soziologie der
literarischen Geschmacksbildung ein Zwischenglied zwischen einer Soziologie der
kunstschaffenden und kunsterlebenden Menschen und der immanenten sozialen Ge-
halte im Werk selbst. So kommt es, daß Schücking auf eine sehr lebendige
Weise Beziehungen aufweist vor allem zwischen Werk und Betrachter, Mäzen und
Schöpfer, Kritik und Publikum. Aus einer weitgreifenden literar- -und kultur-
historischen Bildung heraus gibt der Verfasser eine Fülle interessanter und auf-
schlußreicher Einsichten zu diesen Problemkreisen und wir dürfen gewiß behaupten,
daß dieses Buch in vortrefflicher Weise den Zugang zur Soziologie der Literatur
von der Literatur- und Geschmacksgeschichte aus vermittelt.
Eine eigene, spezifisch soziologische Leistung des Verfassers liegt im Auf-
weis und in der Deutung der von ihm so genannten „Geschmacksträgertypen".
An ihnen ist entscheidend für den methodischen Übergang von der kulturhisto-
rischen zur soziologischen Betrachtungsweise der Satz: „Nicht der Geschmack
wird in der Regel ein anderer und neuer, sondern andere werden Träger eines
neuen Geschmacks" (96). Damit ist gesagt, daß die innere Struktur kulturhisto-
rischen Wandels nicht gleichzusetzen ist mit einem bloßen Wandel weltanschaulicher
oder geschmacklicher „Einstellungen", sondern daß das Auftreten anderer Men-
schen und Menschengruppen die zugrunde liegende Realität ist, an der erst, durch
sie bedingt, jener neue „Geschmack" erscheint. Die Untersuchung dieser Menschen
und Menschengruppen nach ihrer Geistigkeit und Lebenslage gibt der Kultur-
forschung eine realistische Begründung neben der reinen Werkbetrachtung und
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVIII. 13
193
i'estbiß; die andern konnten es nicht wissen, weil ein verhältnismäßig geringer
Ertrag sichtbar wurde. Auf die Lehrtätigkeit verwendete er selten die volle Kraft,
und es stimmt auch noch für spätere Zeit, was er 1869 einträgt: „Die Vorlesungen
vernachlässige ich wahrhaft grauenhaft." Freilich, wenn er sich gut vorbereitet
hatte und bei Stimmung war, dann erlebten wir Studierenden in den Jahren 1885
bis 1890 Stunden, die uns kein anderer Philosophie-Professor bieten konnte. Wir
nannten Dilthey scherzend den Mann der ersten Bände. Wir ahnten nicht, welche
Entwürfe er aufgetürmt hatte. Aus den Briefen und Tagebüchern erfährt man, wie
die Pläne sich ineinander schoben, einer immer gewaltiger als der andere; zu der
Zeit, als Wilhelm Wundt und Eduard von Hartmann Buch für Buch fertig heraus-
brachten, wirbelte es bei Dilthey durcheinander. Nicht ohne Rührung liest man, was
er am 2. Januar 1867 niederschrieb: „Es ist fast wichtiger, daß der 2. Band des
„Schleiermacher" dem ersten rasch folgt, als daß der erste zu gehöriger Zeit kommt."
Selten hat mich ein Erinnerungsbuch so festgehalten wie dieses. Der auf-
opfernden Mühe von Georg und Clara Misch gebührt wärmster Dank. Das Ent-
ziffern der Diltheyschen Handschrift, das Ordnen der Bruchstücke muß unsagbar
viel Arbeit gekostet haben. Sie ist nicht vergebens aufgewendet' worden.
Berlin. Max Dessoir.
Levin L. Schücking: Die Soziologie der literarischen Geschmacksbildung,
2. erw. Aufl., 1931, Leipzig und Berlin, Verlag und Druck von B. G. Teubner.
Der Verfasser hat das Verdienst, mit der vorliegenden Schrift, deren zweite
Auflage dankbar begrüßt werden muß, eine Brücke zu schlagen von der Literatur-
geschichte zur Soziologie des literarischen Lebens und Schaffens. Wie der „Ge-
schmack" selbst in keiner Weise letzte Instanz oder auch nur ein in sich beruhen-
des Phänomen ist, sondern hinausgeführt zu seinen Lebensgründen im persön-
lichen wie gesellschaftlichen Leben auf der einen, und zu der sachlichen Eigenart
des Kunstwerks selbst auf der anderen Seite, so ist auch diese Soziologie der
literarischen Geschmacksbildung ein Zwischenglied zwischen einer Soziologie der
kunstschaffenden und kunsterlebenden Menschen und der immanenten sozialen Ge-
halte im Werk selbst. So kommt es, daß Schücking auf eine sehr lebendige
Weise Beziehungen aufweist vor allem zwischen Werk und Betrachter, Mäzen und
Schöpfer, Kritik und Publikum. Aus einer weitgreifenden literar- -und kultur-
historischen Bildung heraus gibt der Verfasser eine Fülle interessanter und auf-
schlußreicher Einsichten zu diesen Problemkreisen und wir dürfen gewiß behaupten,
daß dieses Buch in vortrefflicher Weise den Zugang zur Soziologie der Literatur
von der Literatur- und Geschmacksgeschichte aus vermittelt.
Eine eigene, spezifisch soziologische Leistung des Verfassers liegt im Auf-
weis und in der Deutung der von ihm so genannten „Geschmacksträgertypen".
An ihnen ist entscheidend für den methodischen Übergang von der kulturhisto-
rischen zur soziologischen Betrachtungsweise der Satz: „Nicht der Geschmack
wird in der Regel ein anderer und neuer, sondern andere werden Träger eines
neuen Geschmacks" (96). Damit ist gesagt, daß die innere Struktur kulturhisto-
rischen Wandels nicht gleichzusetzen ist mit einem bloßen Wandel weltanschaulicher
oder geschmacklicher „Einstellungen", sondern daß das Auftreten anderer Men-
schen und Menschengruppen die zugrunde liegende Realität ist, an der erst, durch
sie bedingt, jener neue „Geschmack" erscheint. Die Untersuchung dieser Menschen
und Menschengruppen nach ihrer Geistigkeit und Lebenslage gibt der Kultur-
forschung eine realistische Begründung neben der reinen Werkbetrachtung und
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVIII. 13