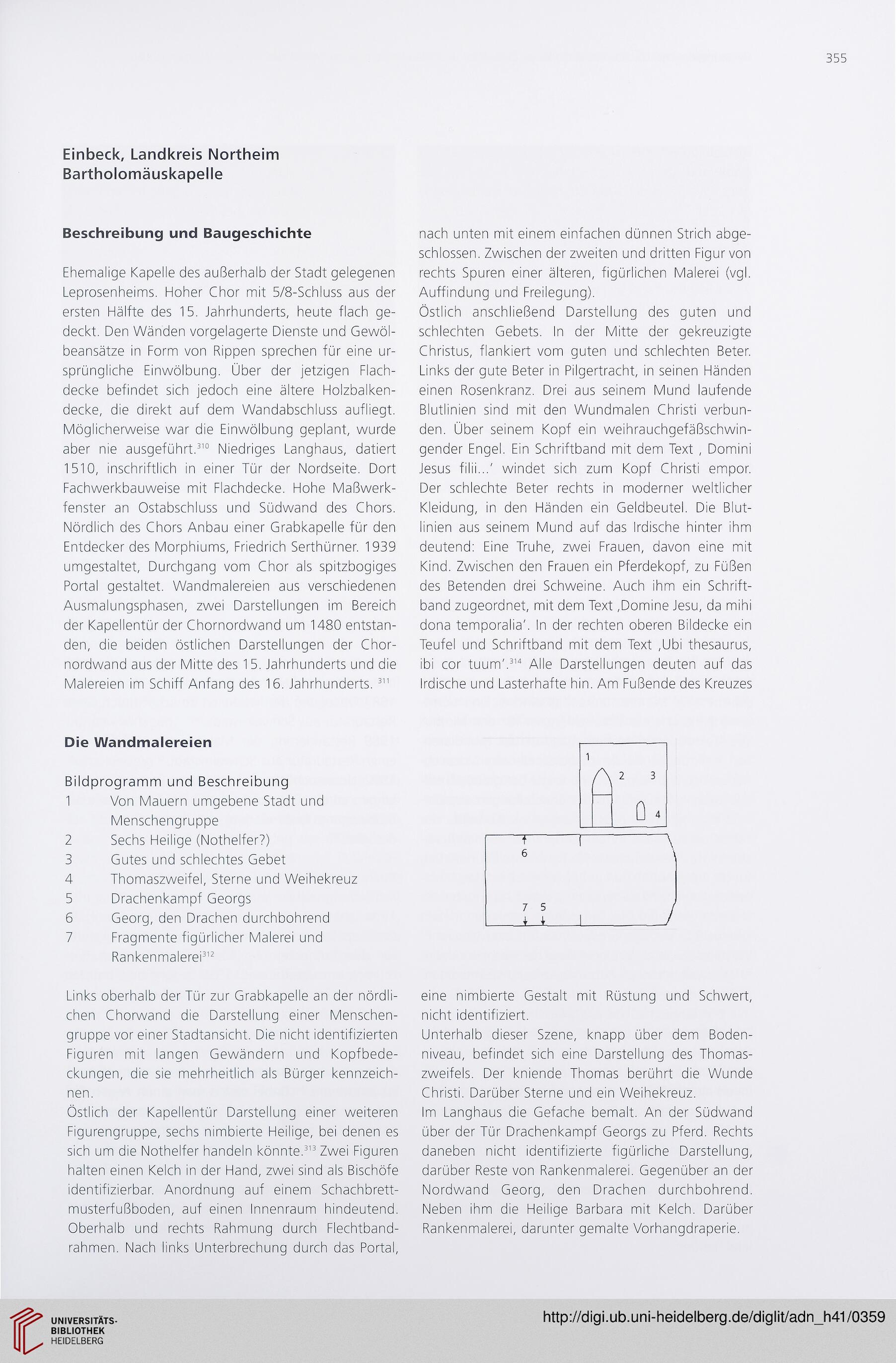355
Einbeck, Landkreis Northeim
Bartholomäuskapelle
Beschreibung und Baugeschichte
Ehemalige Kapelle des außerhalb der Stadt gelegenen
Leprosenheims. Hoher Chor mit 5/8-Schluss aus der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, heute flach ge-
deckt. Den Wänden vorgelagerte Dienste und Gewöl-
beansätze in Form von Rippen sprechen für eine ur-
sprüngliche Einwölbung. Über der jetzigen Flach-
decke befindet sich jedoch eine ältere Holzbalken-
decke, die direkt auf dem Wandabschluss aufliegt.
Möglicherweise war die Einwölbung geplant, wurde
aber nie ausgeführt.310 Niedriges Langhaus, datiert
1510, inschriftlich in einer Tür der Nordseite. Dort
Fachwerkbauweise mit Flachdecke. Hohe Maßwerk-
fenster an Ostabschluss und Südwand des Chors.
Nördlich des Chors Anbau einer Grabkapelle für den
Entdecker des Morphiums, Friedrich Serthürner. 1939
umgestaltet, Durchgang vom Chor als spitzbogiges
Portal gestaltet. Wandmalereien aus verschiedenen
Ausmalungsphasen, zwei Darstellungen im Bereich
der Kapellentür der Chornordwand um 1480 entstan-
den, die beiden östlichen Darstellungen der Chor-
nordwand aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und die
Malereien im Schiff Anfang des 16. Jahrhunderts.311
nach unten mit einem einfachen dünnen Strich abge-
schlossen. Zwischen der zweiten und dritten Figur von
rechts Spuren einer älteren, figürlichen Malerei (vgl.
Auffindung und Freilegung).
Östlich anschließend Darstellung des guten und
schlechten Gebets. In der Mitte der gekreuzigte
Christus, flankiert vom guten und schlechten Beter.
Links der gute Beter in Pilgertracht, in seinen Händen
einen Rosenkranz. Drei aus seinem Mund laufende
Blutlinien sind mit den Wundmalen Christi verbun-
den. Über seinem Kopf ein weihrauchgefäßschwin-
gender Engel. Ein Schriftband mit dem Text , Domini
Jesus filii...' windet sich zum Kopf Christi empor.
Der schlechte Beter rechts in moderner weltlicher
Kleidung, in den Händen ein Geldbeutel. Die Blut-
linien aus seinem Mund auf das Irdische hinter ihm
deutend: Eine Truhe, zwei Frauen, davon eine mit
Kind. Zwischen den Frauen ein Pferdekopf, zu Füßen
des Betenden drei Schweine. Auch ihm ein Schrift-
band zugeordnet, mit dem Text ,Domine Jesu, da mihi
dona temporalia'. In der rechten oberen Bildecke ein
Teufel und Schriftband mit dem Text ,Ubi thesaurus,
ibi cor tuum'.314 Alle Darstellungen deuten auf das
Irdische und Lasterhafte hin. Am Fußende des Kreuzes
Die Wandmalereien
Bildprogramm und Beschreibung
1 Von Mauern umgebene Stadt und
Menschengruppe
2 Sechs Heilige (Nothelfer?)
3 Gutes und schlechtes Gebet
4 Thomaszweifel, Sterne und Weihekreuz
5 Drachenkampf Georgs
6 Georg, den Drachen durchbohrend
7 Fragmente figürlicher Malerei und
Rankenmalerei312
Links oberhalb der Tür zur Grabkapelle an der nördli-
chen Chorwand die Darstellung einer Menschen-
gruppe vor einer Stadtansicht. Die nicht identifizierten
Figuren mit langen Gewändern und Kopfbede-
ckungen, die sie mehrheitlich als Bürger kennzeich-
nen.
Östlich der Kapellentür Darstellung einer weiteren
Figurengruppe, sechs nimbierte Heilige, bei denen es
sich um die Nothelfer handeln könnte.313 Zwei Figuren
halten einen Kelch in der Hand, zwei sind als Bischöfe
identifizierbar. Anordnung auf einem Schachbrett-
musterfußboden, auf einen Innenraum hindeutend.
Oberhalb und rechts Rahmung durch Flechtband-
rahmen. Nach links Unterbrechung durch das Portal,
eine nimbierte Gestalt mit Rüstung und Schwert,
nicht identifiziert.
Unterhalb dieser Szene, knapp über dem Boden-
niveau, befindet sich eine Darstellung des Thomas-
zweifels. Der kniende Thomas berührt die Wunde
Christi. Darüber Sterne und ein Weihekreuz.
Im Langhaus die Gefache bemalt. An der Südwand
über der Tür Drachenkampf Georgs zu Pferd. Rechts
daneben nicht identifizierte figürliche Darstellung,
darüber Reste von Rankenmalerei. Gegenüber an der
Nordwand Georg, den Drachen durchbohrend.
Neben ihm die Heilige Barbara mit Kelch. Darüber
Rankenmalerei, darunter gemalte Vorhangdraperie.
Einbeck, Landkreis Northeim
Bartholomäuskapelle
Beschreibung und Baugeschichte
Ehemalige Kapelle des außerhalb der Stadt gelegenen
Leprosenheims. Hoher Chor mit 5/8-Schluss aus der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, heute flach ge-
deckt. Den Wänden vorgelagerte Dienste und Gewöl-
beansätze in Form von Rippen sprechen für eine ur-
sprüngliche Einwölbung. Über der jetzigen Flach-
decke befindet sich jedoch eine ältere Holzbalken-
decke, die direkt auf dem Wandabschluss aufliegt.
Möglicherweise war die Einwölbung geplant, wurde
aber nie ausgeführt.310 Niedriges Langhaus, datiert
1510, inschriftlich in einer Tür der Nordseite. Dort
Fachwerkbauweise mit Flachdecke. Hohe Maßwerk-
fenster an Ostabschluss und Südwand des Chors.
Nördlich des Chors Anbau einer Grabkapelle für den
Entdecker des Morphiums, Friedrich Serthürner. 1939
umgestaltet, Durchgang vom Chor als spitzbogiges
Portal gestaltet. Wandmalereien aus verschiedenen
Ausmalungsphasen, zwei Darstellungen im Bereich
der Kapellentür der Chornordwand um 1480 entstan-
den, die beiden östlichen Darstellungen der Chor-
nordwand aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und die
Malereien im Schiff Anfang des 16. Jahrhunderts.311
nach unten mit einem einfachen dünnen Strich abge-
schlossen. Zwischen der zweiten und dritten Figur von
rechts Spuren einer älteren, figürlichen Malerei (vgl.
Auffindung und Freilegung).
Östlich anschließend Darstellung des guten und
schlechten Gebets. In der Mitte der gekreuzigte
Christus, flankiert vom guten und schlechten Beter.
Links der gute Beter in Pilgertracht, in seinen Händen
einen Rosenkranz. Drei aus seinem Mund laufende
Blutlinien sind mit den Wundmalen Christi verbun-
den. Über seinem Kopf ein weihrauchgefäßschwin-
gender Engel. Ein Schriftband mit dem Text , Domini
Jesus filii...' windet sich zum Kopf Christi empor.
Der schlechte Beter rechts in moderner weltlicher
Kleidung, in den Händen ein Geldbeutel. Die Blut-
linien aus seinem Mund auf das Irdische hinter ihm
deutend: Eine Truhe, zwei Frauen, davon eine mit
Kind. Zwischen den Frauen ein Pferdekopf, zu Füßen
des Betenden drei Schweine. Auch ihm ein Schrift-
band zugeordnet, mit dem Text ,Domine Jesu, da mihi
dona temporalia'. In der rechten oberen Bildecke ein
Teufel und Schriftband mit dem Text ,Ubi thesaurus,
ibi cor tuum'.314 Alle Darstellungen deuten auf das
Irdische und Lasterhafte hin. Am Fußende des Kreuzes
Die Wandmalereien
Bildprogramm und Beschreibung
1 Von Mauern umgebene Stadt und
Menschengruppe
2 Sechs Heilige (Nothelfer?)
3 Gutes und schlechtes Gebet
4 Thomaszweifel, Sterne und Weihekreuz
5 Drachenkampf Georgs
6 Georg, den Drachen durchbohrend
7 Fragmente figürlicher Malerei und
Rankenmalerei312
Links oberhalb der Tür zur Grabkapelle an der nördli-
chen Chorwand die Darstellung einer Menschen-
gruppe vor einer Stadtansicht. Die nicht identifizierten
Figuren mit langen Gewändern und Kopfbede-
ckungen, die sie mehrheitlich als Bürger kennzeich-
nen.
Östlich der Kapellentür Darstellung einer weiteren
Figurengruppe, sechs nimbierte Heilige, bei denen es
sich um die Nothelfer handeln könnte.313 Zwei Figuren
halten einen Kelch in der Hand, zwei sind als Bischöfe
identifizierbar. Anordnung auf einem Schachbrett-
musterfußboden, auf einen Innenraum hindeutend.
Oberhalb und rechts Rahmung durch Flechtband-
rahmen. Nach links Unterbrechung durch das Portal,
eine nimbierte Gestalt mit Rüstung und Schwert,
nicht identifiziert.
Unterhalb dieser Szene, knapp über dem Boden-
niveau, befindet sich eine Darstellung des Thomas-
zweifels. Der kniende Thomas berührt die Wunde
Christi. Darüber Sterne und ein Weihekreuz.
Im Langhaus die Gefache bemalt. An der Südwand
über der Tür Drachenkampf Georgs zu Pferd. Rechts
daneben nicht identifizierte figürliche Darstellung,
darüber Reste von Rankenmalerei. Gegenüber an der
Nordwand Georg, den Drachen durchbohrend.
Neben ihm die Heilige Barbara mit Kelch. Darüber
Rankenmalerei, darunter gemalte Vorhangdraperie.