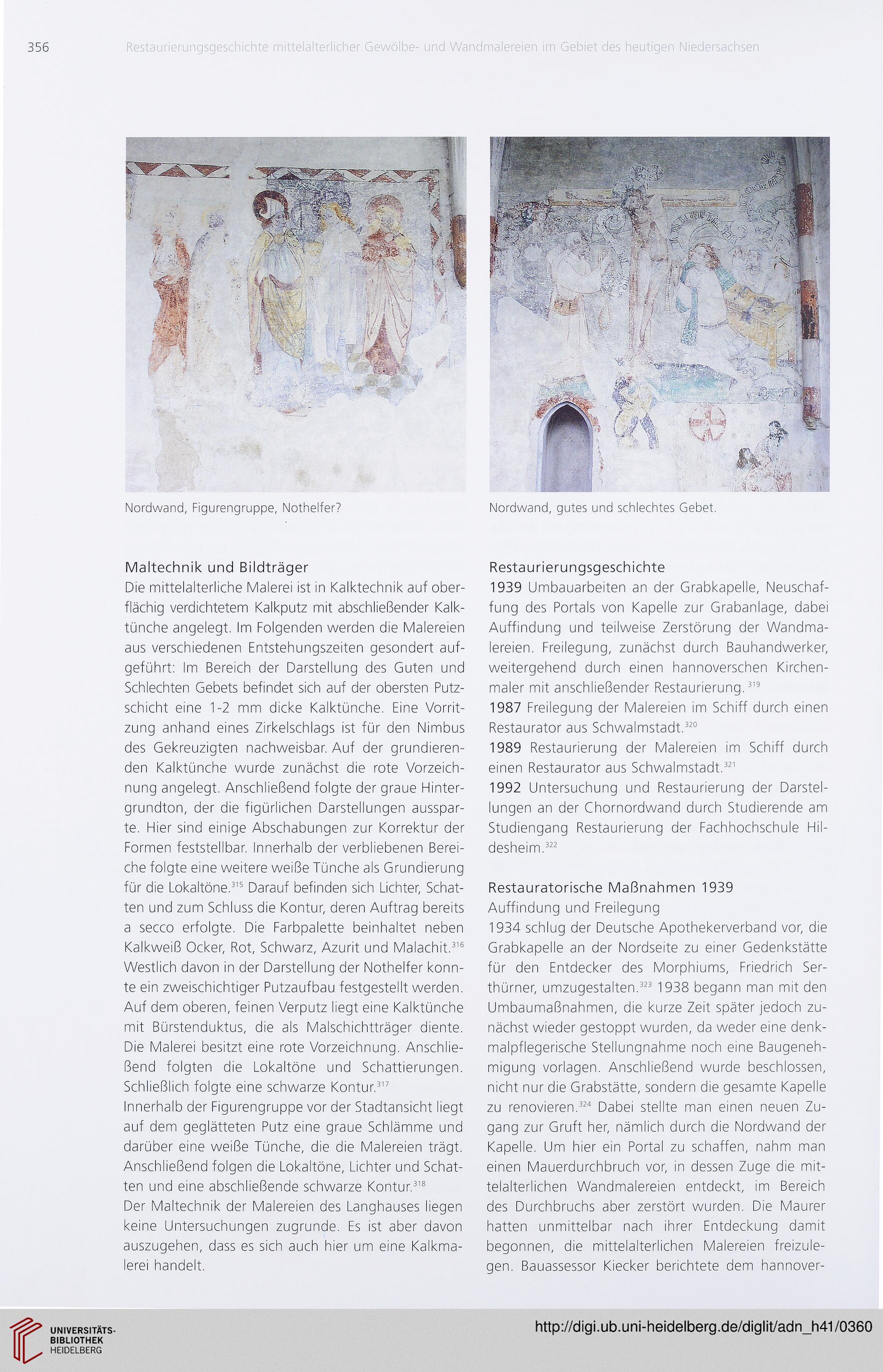356
Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen
Nordwand, Figurengruppe, Nothelfer?
Nordwand, gutes und schlechtes Gebet.
Maltechnik und Bildträger
Die mittelalterliche Malerei ist in Kalktechnik auf ober-
flächig verdichtetem Kalkputz mit abschließender Kalk-
tünche angelegt. Im Folgenden werden die Malereien
aus verschiedenen Entstehungszeiten gesondert auf-
geführt: Im Bereich der Darstellung des Guten und
Schlechten Gebets befindet sich auf der obersten Putz-
schicht eine 1-2 mm dicke Kalktünche. Eine Vorrit-
zung anhand eines Zirkelschlags ist für den Nimbus
des Gekreuzigten nachweisbar. Auf der grundieren-
den Kalktünche wurde zunächst die rote Vorzeich-
nung angelegt. Anschließend folgte der graue Hinter-
grundton, der die figürlichen Darstellungen ausspar-
te. Hier sind einige Abschabungen zur Korrektur der
Formen feststellbar. Innerhalb der verbliebenen Berei-
che folgte eine weitere weiße Tünche als Grundierung
für die Lokaltöne.315 Darauf befinden sich Lichter, Schat-
ten und zum Schluss die Kontur, deren Auftrag bereits
a secco erfolgte. Die Farbpalette beinhaltet neben
Kalkweiß Ocker, Rot, Schwarz, Azurit und Malachit.316
Westlich davon in der Darstellung der Nothelfer konn-
te ein zweischichtiger Putzaufbau festgestellt werden.
Auf dem oberen, feinen Verputz liegt eine Kalktünche
mit Bürstenduktus, die als Malschichtträger diente.
Die Malerei besitzt eine rote Vorzeichnung. Anschlie-
ßend folgten die Lokaltöne und Schattierungen.
Schließlich folgte eine schwarze Kontur.317
Innerhalb der Figurengruppe vor der Stadtansicht liegt
auf dem geglätteten Putz eine graue Schlämme und
darüber eine weiße Tünche, die die Malereien trägt.
Anschließend folgen die Lokaltöne, Lichter und Schat-
ten und eine abschließende schwarze Kontur.318
Der Maltechnik der Malereien des Langhauses liegen
keine Untersuchungen zugrunde. Es ist aber davon
auszugehen, dass es sich auch hier um eine Kalkma-
lerei handelt.
Restaurierungsgeschichte
1939 Umbauarbeiten an der Grabkapelle, Neuschaf-
fung des Portals von Kapelle zur Grabanlage, dabei
Auffindung und teilweise Zerstörung der Wandma-
lereien. Freilegung, zunächst durch Bauhandwerker,
weitergehend durch einen hannoverschen Kirchen-
maler mit anschließender Restaurierung.319
1987 Freilegung der Malereien im Schiff durch einen
Restaurator aus Schwalmstadt.320
1989 Restaurierung der Malereien im Schiff durch
einen Restaurator aus Schwalmstadt.321
1992 Untersuchung und Restaurierung der Darstel-
lungen an der Chornordwand durch Studierende am
Studiengang Restaurierung der Fachhochschule Hil-
desheim.322
Restauratorische Maßnahmen 1939
Auffindung und Freilegung
1934 schlug der Deutsche Apothekerverband vor, die
Grabkapelle an der Nordseite zu einer Gedenkstätte
für den Entdecker des Morphiums, Friedrich Ser-
thürner, umzugestalten.323 1 938 begann man mit den
Umbaumaßnahmen, die kurze Zeit später jedoch zu-
nächst wieder gestoppt wurden, da weder eine denk-
malpflegerische Stellungnahme noch eine Baugeneh-
migung vorlagen. Anschließend wurde beschlossen,
nicht nur die Grabstätte, sondern die gesamte Kapelle
zu renovieren.324 Dabei stellte man einen neuen Zu-
gang zur Gruft her, nämlich durch die Nordwand der
Kapelle. Um hier ein Portal zu schaffen, nahm man
einen Mauerdurchbruch vor, in dessen Zuge die mit-
telalterlichen Wandmalereien entdeckt, im Bereich
des Durchbruchs aber zerstört wurden. Die Maurer
hatten unmittelbar nach ihrer Entdeckung damit
begonnen, die mittelalterlichen Malereien freizule-
gen. Bauassessor Kiecker berichtete dem hannover-
Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen
Nordwand, Figurengruppe, Nothelfer?
Nordwand, gutes und schlechtes Gebet.
Maltechnik und Bildträger
Die mittelalterliche Malerei ist in Kalktechnik auf ober-
flächig verdichtetem Kalkputz mit abschließender Kalk-
tünche angelegt. Im Folgenden werden die Malereien
aus verschiedenen Entstehungszeiten gesondert auf-
geführt: Im Bereich der Darstellung des Guten und
Schlechten Gebets befindet sich auf der obersten Putz-
schicht eine 1-2 mm dicke Kalktünche. Eine Vorrit-
zung anhand eines Zirkelschlags ist für den Nimbus
des Gekreuzigten nachweisbar. Auf der grundieren-
den Kalktünche wurde zunächst die rote Vorzeich-
nung angelegt. Anschließend folgte der graue Hinter-
grundton, der die figürlichen Darstellungen ausspar-
te. Hier sind einige Abschabungen zur Korrektur der
Formen feststellbar. Innerhalb der verbliebenen Berei-
che folgte eine weitere weiße Tünche als Grundierung
für die Lokaltöne.315 Darauf befinden sich Lichter, Schat-
ten und zum Schluss die Kontur, deren Auftrag bereits
a secco erfolgte. Die Farbpalette beinhaltet neben
Kalkweiß Ocker, Rot, Schwarz, Azurit und Malachit.316
Westlich davon in der Darstellung der Nothelfer konn-
te ein zweischichtiger Putzaufbau festgestellt werden.
Auf dem oberen, feinen Verputz liegt eine Kalktünche
mit Bürstenduktus, die als Malschichtträger diente.
Die Malerei besitzt eine rote Vorzeichnung. Anschlie-
ßend folgten die Lokaltöne und Schattierungen.
Schließlich folgte eine schwarze Kontur.317
Innerhalb der Figurengruppe vor der Stadtansicht liegt
auf dem geglätteten Putz eine graue Schlämme und
darüber eine weiße Tünche, die die Malereien trägt.
Anschließend folgen die Lokaltöne, Lichter und Schat-
ten und eine abschließende schwarze Kontur.318
Der Maltechnik der Malereien des Langhauses liegen
keine Untersuchungen zugrunde. Es ist aber davon
auszugehen, dass es sich auch hier um eine Kalkma-
lerei handelt.
Restaurierungsgeschichte
1939 Umbauarbeiten an der Grabkapelle, Neuschaf-
fung des Portals von Kapelle zur Grabanlage, dabei
Auffindung und teilweise Zerstörung der Wandma-
lereien. Freilegung, zunächst durch Bauhandwerker,
weitergehend durch einen hannoverschen Kirchen-
maler mit anschließender Restaurierung.319
1987 Freilegung der Malereien im Schiff durch einen
Restaurator aus Schwalmstadt.320
1989 Restaurierung der Malereien im Schiff durch
einen Restaurator aus Schwalmstadt.321
1992 Untersuchung und Restaurierung der Darstel-
lungen an der Chornordwand durch Studierende am
Studiengang Restaurierung der Fachhochschule Hil-
desheim.322
Restauratorische Maßnahmen 1939
Auffindung und Freilegung
1934 schlug der Deutsche Apothekerverband vor, die
Grabkapelle an der Nordseite zu einer Gedenkstätte
für den Entdecker des Morphiums, Friedrich Ser-
thürner, umzugestalten.323 1 938 begann man mit den
Umbaumaßnahmen, die kurze Zeit später jedoch zu-
nächst wieder gestoppt wurden, da weder eine denk-
malpflegerische Stellungnahme noch eine Baugeneh-
migung vorlagen. Anschließend wurde beschlossen,
nicht nur die Grabstätte, sondern die gesamte Kapelle
zu renovieren.324 Dabei stellte man einen neuen Zu-
gang zur Gruft her, nämlich durch die Nordwand der
Kapelle. Um hier ein Portal zu schaffen, nahm man
einen Mauerdurchbruch vor, in dessen Zuge die mit-
telalterlichen Wandmalereien entdeckt, im Bereich
des Durchbruchs aber zerstört wurden. Die Maurer
hatten unmittelbar nach ihrer Entdeckung damit
begonnen, die mittelalterlichen Malereien freizule-
gen. Bauassessor Kiecker berichtete dem hannover-