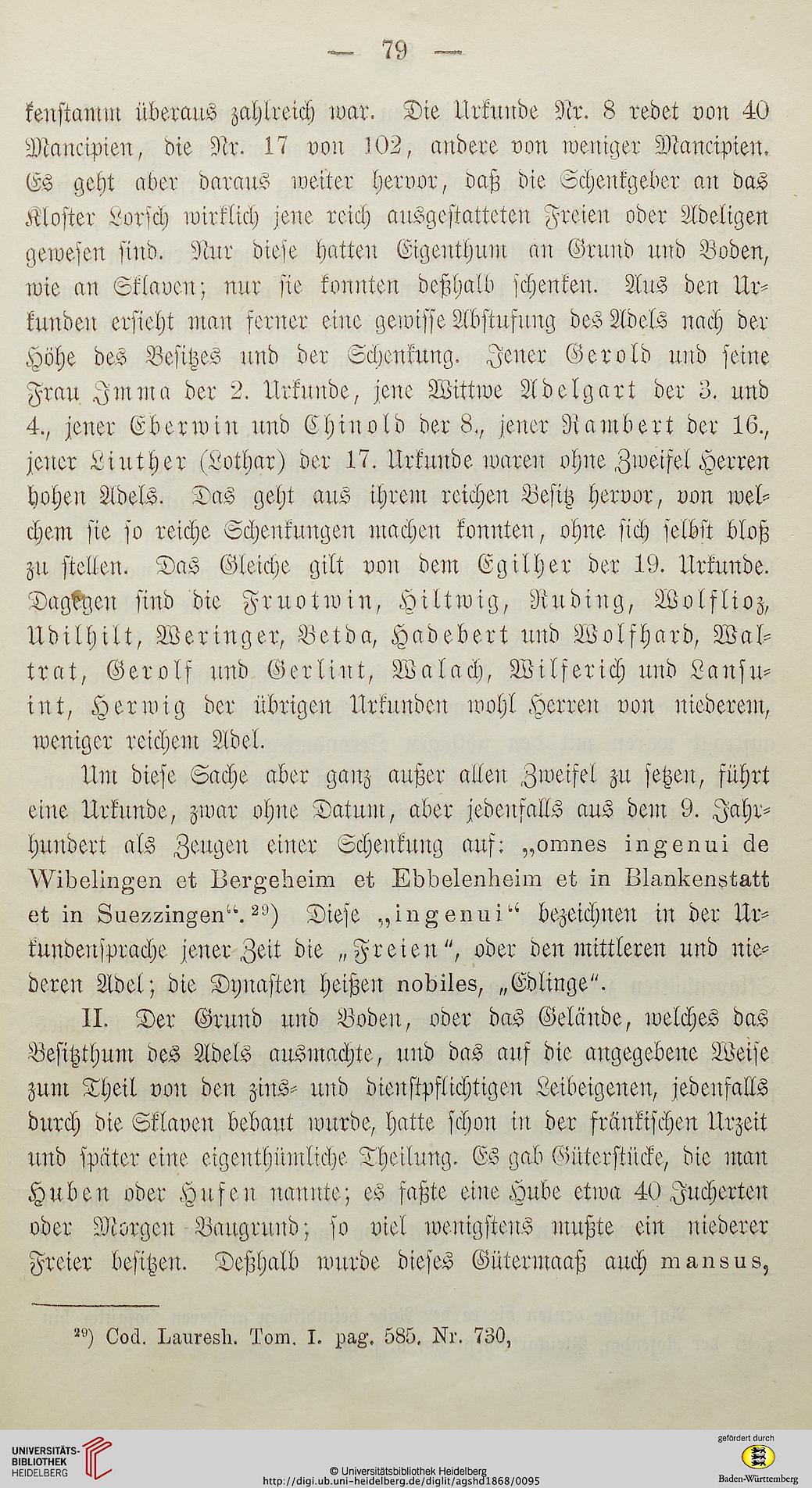79
kenstamm überaus zahlreich war. Die Urkunde Nr. 8 redet von 40
Maneipien, die Nr. 17 von 102, andere von weniger Maneipien.
Es geht aber daraus weiter hervor, daß die Schenkgeber an das
Kloster Lorsch wirklich jene reich ausgestatteten Freien oder Adeligen
gewesen sind. Nur diese hatten Eigenthum an Grund und Boden,
wie an Sklaven; nur sie konnten deßhalb schenken. Alls den Ur-
kunden ersieht man ferner eine geuüsse Abstufung des Adels nach der
Höhe des Besitzes und der Schenkung. Jener Gerold und seine
Frau Jmma der 2. Urkunde, jene Wittwe Adelgart der 3. und
4., jener Eberwin und CHinold der 8., jener Rambert der 16.,
jener Liuther (Lothar) der 17. Urkunde waren ohne Zweifel Herren
hohen Adels. Das geht aus ihrem reichen Besitz hervor, von wel-
chem sie so reiche Schenkungen machen konnten, ohne sich selbst bloß
zu stellen. Das Gleiche gilt voll dem Egilher der 19. Urkunde.
Dagegen sind die Fruotwin, Hiltwig, Ruding, Wolflioz,
Udilhilt, Weringer, Betda, Hadebert uud Wolfhard, Wal-
trat, Gerolf und Gerlint, Walach, Wilferich und Lansu-
int, Herwig der übrigen Urkunden wohl Herren von niederem,
weniger reichem Adel.
Um diese Sache aber ganz außer allen Zweifel zu setzeu, führt
eine Urkunde, zwar ohne Datum, aber jedenfalls aus dem 9. Jahr-
hundert als Zeugen einer Schenkung auf: ^omiws iu^onui da
LVidulino-tzn st et Dddelensteim et in Ulnnstenstatt
et in Lue-^ingenN20) Diese „in^enni" bezeichnen in der Ur-
kundensprache jener Zeit die „Freien", oder den mittleren und nie-
deren Adel; die Dynasten heißen nodileg, „Edlinge".
II. Der Grund und Boden, oder das Gelände, welches das
Besitzthum des Adels ausmachte, und das auf die angegebene Weise
zum Theil von den zins- und dieustpflichtigen Leibeigenen, jedenfalls
durch die Sklaven bebaut wurde, hatte schon in der fränkischen Urzeit
und später eine eigeuthümliche Theilung. Es gab Güterskücke, die man
Huben oder Hufen nannte; es faßte eine Hube etwa 40 Jucherten
oder Morgen Baugrund; so viel wenigstens mußte ein niederer
Freier besitzen. Deßhalb wurde dieses Gütermaaß auch man8u8,
2°) Ooä. lom. I. 585. Ur. 730,
kenstamm überaus zahlreich war. Die Urkunde Nr. 8 redet von 40
Maneipien, die Nr. 17 von 102, andere von weniger Maneipien.
Es geht aber daraus weiter hervor, daß die Schenkgeber an das
Kloster Lorsch wirklich jene reich ausgestatteten Freien oder Adeligen
gewesen sind. Nur diese hatten Eigenthum an Grund und Boden,
wie an Sklaven; nur sie konnten deßhalb schenken. Alls den Ur-
kunden ersieht man ferner eine geuüsse Abstufung des Adels nach der
Höhe des Besitzes und der Schenkung. Jener Gerold und seine
Frau Jmma der 2. Urkunde, jene Wittwe Adelgart der 3. und
4., jener Eberwin und CHinold der 8., jener Rambert der 16.,
jener Liuther (Lothar) der 17. Urkunde waren ohne Zweifel Herren
hohen Adels. Das geht aus ihrem reichen Besitz hervor, von wel-
chem sie so reiche Schenkungen machen konnten, ohne sich selbst bloß
zu stellen. Das Gleiche gilt voll dem Egilher der 19. Urkunde.
Dagegen sind die Fruotwin, Hiltwig, Ruding, Wolflioz,
Udilhilt, Weringer, Betda, Hadebert uud Wolfhard, Wal-
trat, Gerolf und Gerlint, Walach, Wilferich und Lansu-
int, Herwig der übrigen Urkunden wohl Herren von niederem,
weniger reichem Adel.
Um diese Sache aber ganz außer allen Zweifel zu setzeu, führt
eine Urkunde, zwar ohne Datum, aber jedenfalls aus dem 9. Jahr-
hundert als Zeugen einer Schenkung auf: ^omiws iu^onui da
LVidulino-tzn st et Dddelensteim et in Ulnnstenstatt
et in Lue-^ingenN20) Diese „in^enni" bezeichnen in der Ur-
kundensprache jener Zeit die „Freien", oder den mittleren und nie-
deren Adel; die Dynasten heißen nodileg, „Edlinge".
II. Der Grund und Boden, oder das Gelände, welches das
Besitzthum des Adels ausmachte, und das auf die angegebene Weise
zum Theil von den zins- und dieustpflichtigen Leibeigenen, jedenfalls
durch die Sklaven bebaut wurde, hatte schon in der fränkischen Urzeit
und später eine eigeuthümliche Theilung. Es gab Güterskücke, die man
Huben oder Hufen nannte; es faßte eine Hube etwa 40 Jucherten
oder Morgen Baugrund; so viel wenigstens mußte ein niederer
Freier besitzen. Deßhalb wurde dieses Gütermaaß auch man8u8,
2°) Ooä. lom. I. 585. Ur. 730,