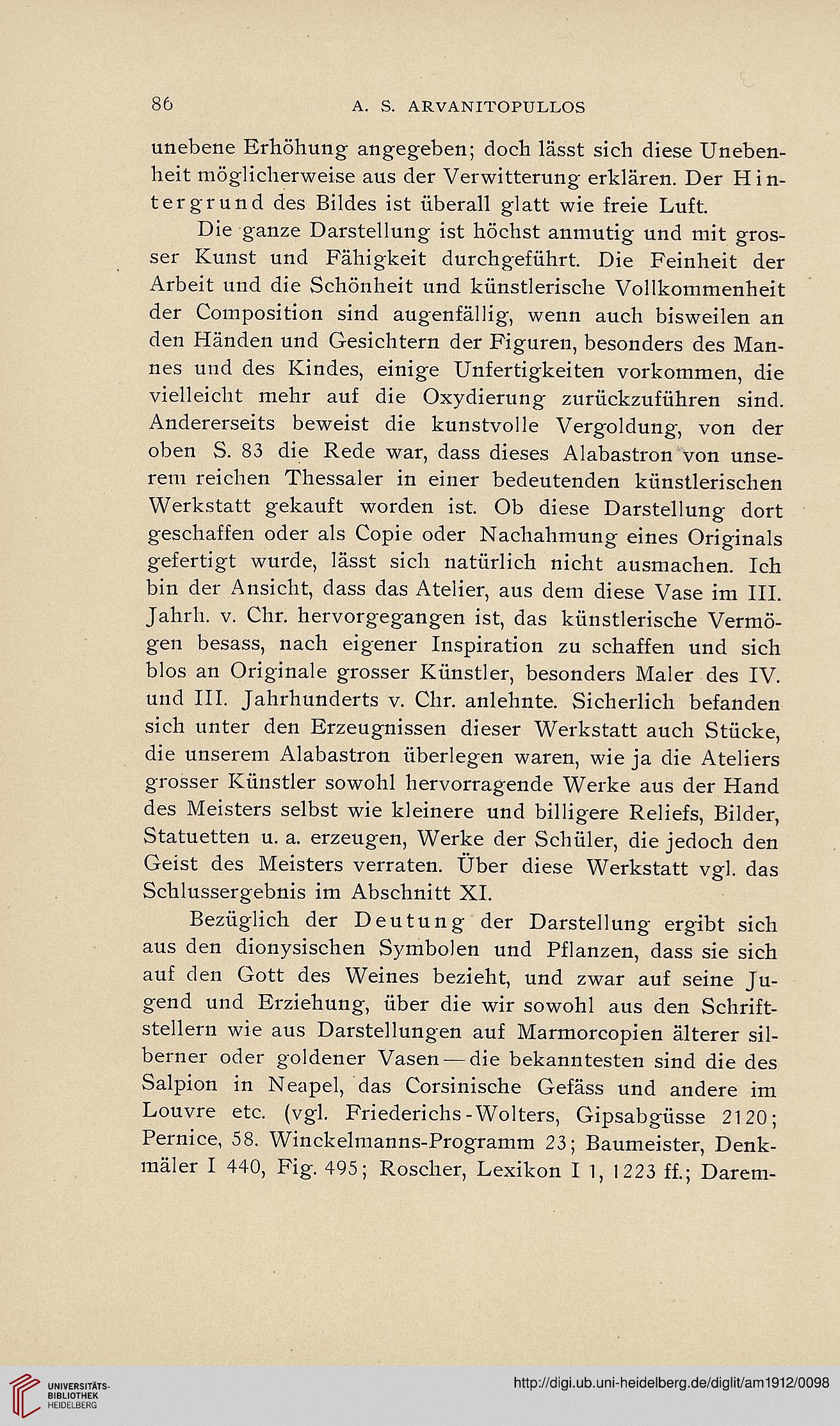86
A. S. ARVANITOPULLOS
unebene Erhöhung angegeben; doch lässt sich diese Uneben-
heit möglicherweise aus der Verwitterung erklären. Der H in-
tergrund des Bildes ist überall glatt wie freie Luft.
Die ganze Darstellung ist höchst anmutig und mit gros-
ser Kunst und Fähigkeit durchgeführt. Die Feinheit der
Arbeit und die Schönheit und künstlerische Vollkommenheit
der Composition sind augenfällig, wenn auch bisweilen an
den Händen und Gesichtern der Figuren, besonders des Man-
nes und des Kindes, einige Unfertigkeiten Vorkommen, die
vielleicht mehr auf die Oxydierung zurückzuführen sind.
Andererseits beweist die kunstvolle Vergoldung, von der
oben S. 83 die Rede war, dass dieses Alabastron von unse-
rem reichen Thessaler in einer bedeutenden künstlerischen
Werkstatt gekauft worden ist. Ob diese Darstellung dort
geschaffen oder als Copie oder Nachahmung eines Originals
gefertigt wurde, lässt sich natürlich nicht ausmachen. Ich
bin der Ansicht, dass das Atelier, aus dem diese Vase im III.
Jahrh. v. Chr. hervorgegangen ist, das künstlerische Vermö-
gen besass, nach eigener Inspiration zu schaffen und sich
blos an Originale grosser Künstler, besonders Maler des IV.
und III. Jahrhunderts v. Chr. anlehnte. Sicherlich befanden
sich unter den Erzeugnissen dieser Werkstatt auch Stücke,
die unserem Alabastron überlegen waren, wie ja die Ateliers
grosser Künstler sowohl hervorragende Werke aus der Hand
des Meisters selbst wie kleinere und billigere Reliefs, Bilder,
Statuetten u. a. erzeugen, Werke der Schüler, die jedoch den
Geist des Meisters verraten. Über diese Werkstatt vgl. das
Schlussergebnis im Abschnitt XI.
Bezüglich der Deutung der Darstellung ergibt sich
aus den dionysischen Symbolen und Pflanzen, dass sie sich
auf den Gott des Weines bezieht, und zwar auf seine Ju-
gend und Erziehung, über die wir sowohl aus den Schrift-
stellern wie aus Darstellungen auf Marmorcopien älterer sil-
berner oder goldener Vasen — die bekanntesten sind die des
Salpion in Neapel, das Corsinische Gefäss und andere im
Louvre etc. (vgl. Friederichs-Wolters, Gipsabgüsse 2120;
Pernice, 58. Winckelmanns-Programm 23; Baumeister, Denk-
mäler I 440, Fig. 495; Roscher, Lexikon I 1, 1223 ff.; Darem-
A. S. ARVANITOPULLOS
unebene Erhöhung angegeben; doch lässt sich diese Uneben-
heit möglicherweise aus der Verwitterung erklären. Der H in-
tergrund des Bildes ist überall glatt wie freie Luft.
Die ganze Darstellung ist höchst anmutig und mit gros-
ser Kunst und Fähigkeit durchgeführt. Die Feinheit der
Arbeit und die Schönheit und künstlerische Vollkommenheit
der Composition sind augenfällig, wenn auch bisweilen an
den Händen und Gesichtern der Figuren, besonders des Man-
nes und des Kindes, einige Unfertigkeiten Vorkommen, die
vielleicht mehr auf die Oxydierung zurückzuführen sind.
Andererseits beweist die kunstvolle Vergoldung, von der
oben S. 83 die Rede war, dass dieses Alabastron von unse-
rem reichen Thessaler in einer bedeutenden künstlerischen
Werkstatt gekauft worden ist. Ob diese Darstellung dort
geschaffen oder als Copie oder Nachahmung eines Originals
gefertigt wurde, lässt sich natürlich nicht ausmachen. Ich
bin der Ansicht, dass das Atelier, aus dem diese Vase im III.
Jahrh. v. Chr. hervorgegangen ist, das künstlerische Vermö-
gen besass, nach eigener Inspiration zu schaffen und sich
blos an Originale grosser Künstler, besonders Maler des IV.
und III. Jahrhunderts v. Chr. anlehnte. Sicherlich befanden
sich unter den Erzeugnissen dieser Werkstatt auch Stücke,
die unserem Alabastron überlegen waren, wie ja die Ateliers
grosser Künstler sowohl hervorragende Werke aus der Hand
des Meisters selbst wie kleinere und billigere Reliefs, Bilder,
Statuetten u. a. erzeugen, Werke der Schüler, die jedoch den
Geist des Meisters verraten. Über diese Werkstatt vgl. das
Schlussergebnis im Abschnitt XI.
Bezüglich der Deutung der Darstellung ergibt sich
aus den dionysischen Symbolen und Pflanzen, dass sie sich
auf den Gott des Weines bezieht, und zwar auf seine Ju-
gend und Erziehung, über die wir sowohl aus den Schrift-
stellern wie aus Darstellungen auf Marmorcopien älterer sil-
berner oder goldener Vasen — die bekanntesten sind die des
Salpion in Neapel, das Corsinische Gefäss und andere im
Louvre etc. (vgl. Friederichs-Wolters, Gipsabgüsse 2120;
Pernice, 58. Winckelmanns-Programm 23; Baumeister, Denk-
mäler I 440, Fig. 495; Roscher, Lexikon I 1, 1223 ff.; Darem-