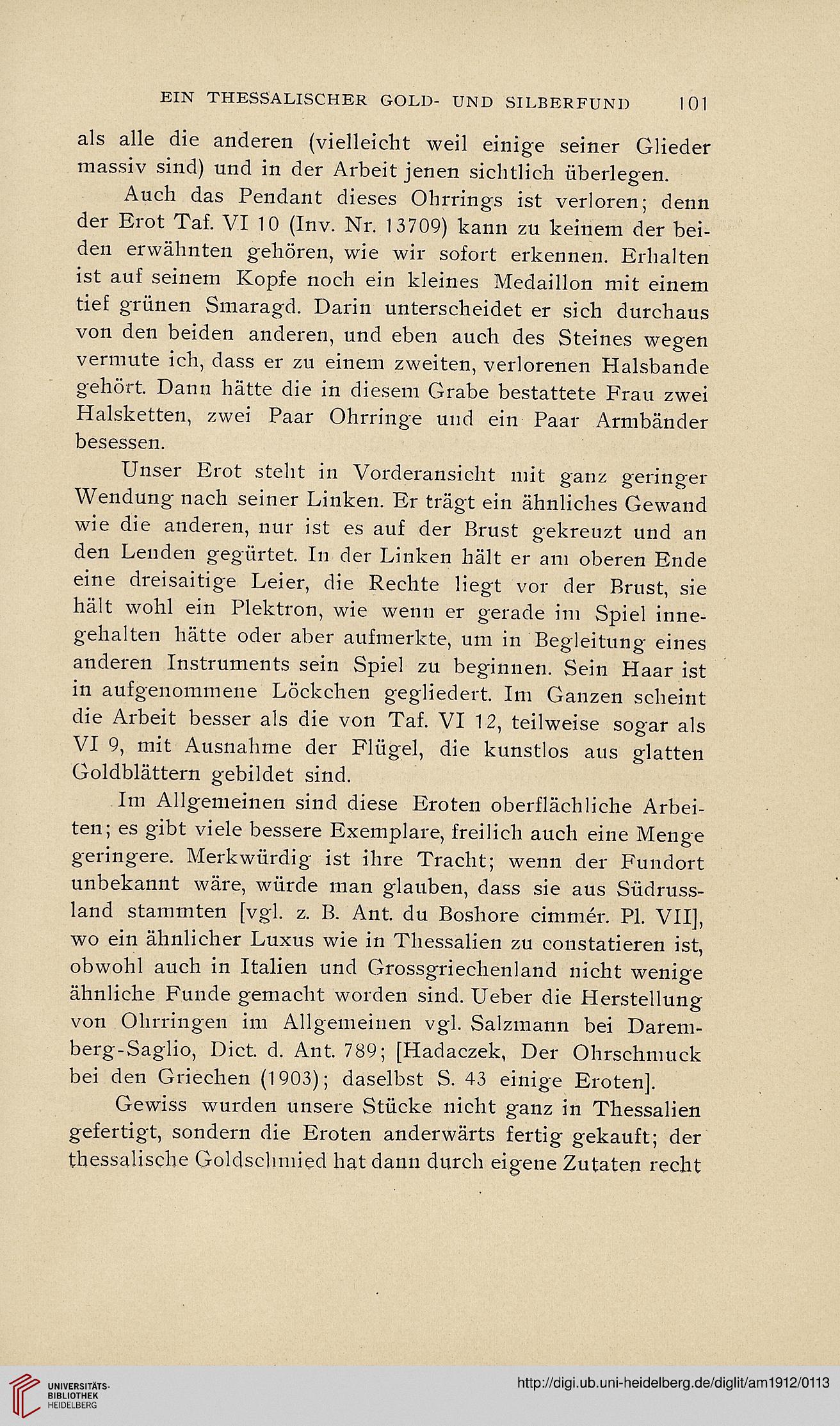EIN THESSALISCHER GOLD- UND SIEBERFUNI)
101
als alle die anderen (vielleicht weil einige seiner Glieder
massiv sind) und in der Arbeit jenen sichtlich überlegen.
Auch das Pendant dieses Ohrrings ist verloren; denn
der Erot Taf. VI 10 (Inv. Nr. 13709) kann zu keinem der bei-
den erwähnten gehören, wie wir sofort erkennen. Erhalten
ist auf seinem Kopfe noch ein kleines Medaillon mit einem
tief grünen Smaragd. Darin unterscheidet er sich durchaus
von den beiden anderen, und eben auch des Steines wegen
vermute ich, dass er zu einem zweiten, verlorenen Halsbande
gehört. Daun hätte die in diesem Grabe bestattete Frau zwei
Halsketten, zwei Paar Ohrringe und ein Paar Armbänder
besessen.
Unser Erot steht in Vorderansicht mit ganz geringer
Wendung nach seiner Linken. Er trägt ein ähnliches Gewand
wie die anderen, nur ist es auf der Brust gekreuzt und an
den Lenden gegürtet. In der Linken hält er am oberen Ende
eine dreisaitige Leier, die Rechte liegt vor der Brust, sie
hält wohl ein Plektron, wie wenn er gerade im Spiel inne-
gehalten hätte oder aber aufmerkte, um in Begleitung eines
anderen Instruments sein Spiel zu beginnen. Sein Haar ist
in aufgenommene Löckchen gegliedert. Im Ganzen scheint
die Arbeit besser als die von Taf. VI 12, teilweise sogar als
VI 9, mit Ausnahme der Flügel, die kunstlos aus glatten
Goldblättern gebildet sind.
Im Allgemeinen sind diese Eroten oberflächliche Arbei-
ten; es gibt viele bessere Exemplare, freilich auch eine Menge
geringere. Merkwürdig ist ihre Tracht; wenn der Fundort
unbekannt wäre, würde man glauben, dass sie aus Südruss-
land stammten [vgl. z. B. Ant. du Boshore cimmer. PI. VII],
wo ein ähnlicher Luxus wie in Thessalien zu coustatieren ist,
obwohl auch in Italien und Grossgriechenland nicht wenige
ähnliche Funde gemacht worden sind. Ueber die Herstellung
von Ohrringen im Allgemeinen vgl. Salzmann bei Darem-
berg-Saglio, Dict. d. Aut. 789; [Hadaczek, Der Ohrschmuck
bei den Griechen (1903); daselbst S. 43 einige Eroten],
Gewiss wurden unsere Stücke nicht ganz in Thessalien
gefertigt, sondern die Eroten anderwärts fertig gekauft; der
thessalische Goldschmied hat dann durch eigene Zutaten recht
101
als alle die anderen (vielleicht weil einige seiner Glieder
massiv sind) und in der Arbeit jenen sichtlich überlegen.
Auch das Pendant dieses Ohrrings ist verloren; denn
der Erot Taf. VI 10 (Inv. Nr. 13709) kann zu keinem der bei-
den erwähnten gehören, wie wir sofort erkennen. Erhalten
ist auf seinem Kopfe noch ein kleines Medaillon mit einem
tief grünen Smaragd. Darin unterscheidet er sich durchaus
von den beiden anderen, und eben auch des Steines wegen
vermute ich, dass er zu einem zweiten, verlorenen Halsbande
gehört. Daun hätte die in diesem Grabe bestattete Frau zwei
Halsketten, zwei Paar Ohrringe und ein Paar Armbänder
besessen.
Unser Erot steht in Vorderansicht mit ganz geringer
Wendung nach seiner Linken. Er trägt ein ähnliches Gewand
wie die anderen, nur ist es auf der Brust gekreuzt und an
den Lenden gegürtet. In der Linken hält er am oberen Ende
eine dreisaitige Leier, die Rechte liegt vor der Brust, sie
hält wohl ein Plektron, wie wenn er gerade im Spiel inne-
gehalten hätte oder aber aufmerkte, um in Begleitung eines
anderen Instruments sein Spiel zu beginnen. Sein Haar ist
in aufgenommene Löckchen gegliedert. Im Ganzen scheint
die Arbeit besser als die von Taf. VI 12, teilweise sogar als
VI 9, mit Ausnahme der Flügel, die kunstlos aus glatten
Goldblättern gebildet sind.
Im Allgemeinen sind diese Eroten oberflächliche Arbei-
ten; es gibt viele bessere Exemplare, freilich auch eine Menge
geringere. Merkwürdig ist ihre Tracht; wenn der Fundort
unbekannt wäre, würde man glauben, dass sie aus Südruss-
land stammten [vgl. z. B. Ant. du Boshore cimmer. PI. VII],
wo ein ähnlicher Luxus wie in Thessalien zu coustatieren ist,
obwohl auch in Italien und Grossgriechenland nicht wenige
ähnliche Funde gemacht worden sind. Ueber die Herstellung
von Ohrringen im Allgemeinen vgl. Salzmann bei Darem-
berg-Saglio, Dict. d. Aut. 789; [Hadaczek, Der Ohrschmuck
bei den Griechen (1903); daselbst S. 43 einige Eroten],
Gewiss wurden unsere Stücke nicht ganz in Thessalien
gefertigt, sondern die Eroten anderwärts fertig gekauft; der
thessalische Goldschmied hat dann durch eigene Zutaten recht