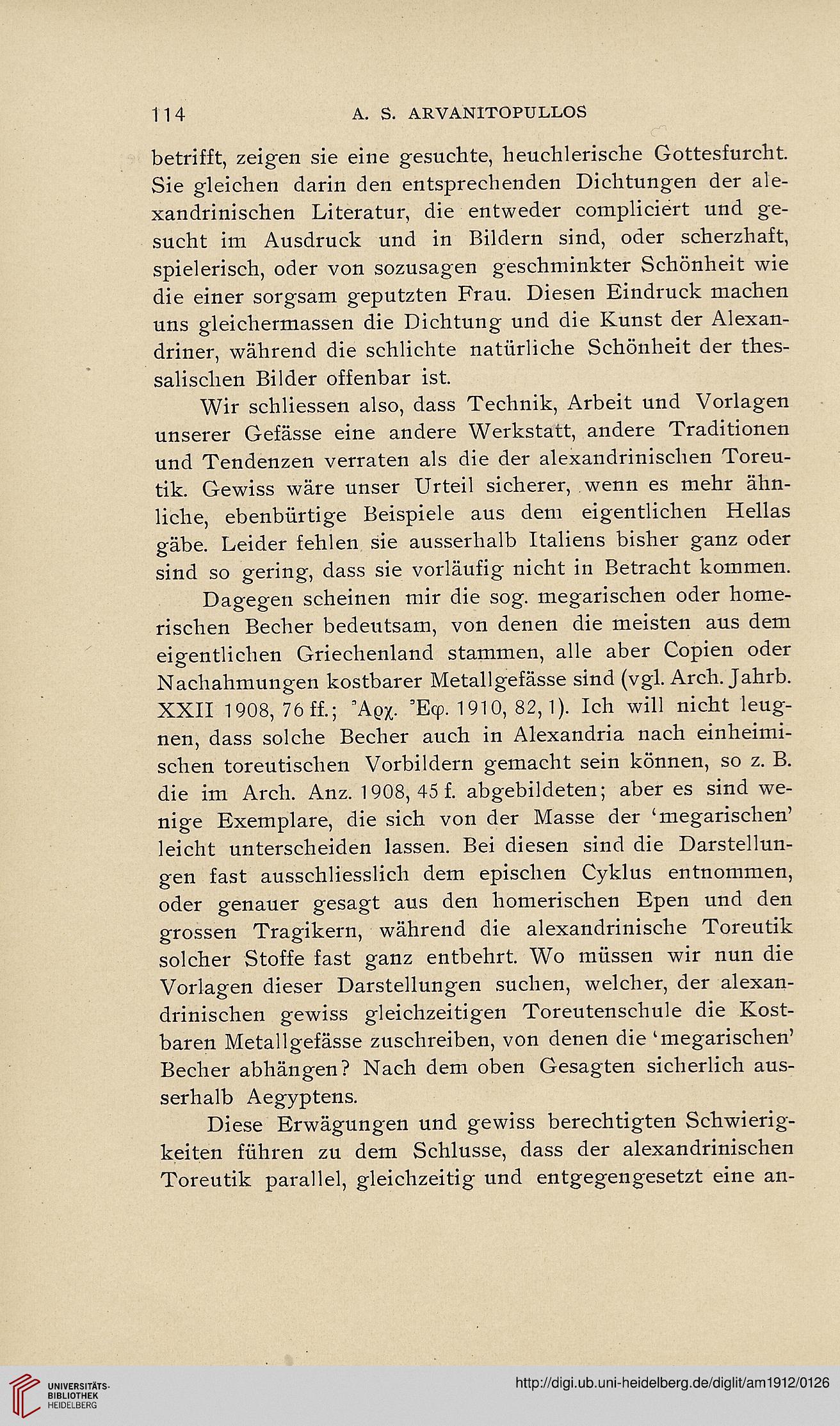114
A. S. ARVANITOPULLOS
betrifft, zeigen sie eine gesuchte, heuchlerische Gottesfurcht.
Sie gleichen darin den entsprechenden Dichtungen der ale-
xandrinischen Literatur, die entweder compliciert und ge-
sucht im Ausdruck und in Bildern sind, oder scherzhaft,
spielerisch, oder von sozusagen geschminkter Schönheit wie
die einer sorgsam geputzten Frau. Diesen Eindruck machen
uns gleichermassen die Dichtung und die Kunst der Alexan-
driner, während die schlichte natürliche Schönheit der thes-
salisclien Bilder offenbar ist.
Wir schliessen also, dass Technik, Arbeit und Vorlagen
unserer Gefässe eine andere Werkstatt, andere Traditionen
und Tendenzen verraten als die der alexandrinischen Toreu-
tik. Gewiss wäre unser Urteil sicherer, wenn es mehr ähn-
liche, ebenbürtige Beispiele aus dem eigentlichen Hellas
gäbe. Leider fehlen sie ausserhalb Italiens bisher ganz oder
sind so gering, dass sie vorläufig nicht in Betracht kommen.
Dagegen scheinen mir die sog. megarischen oder home-
rischen Becher bedeutsam, von denen die meisten aus dem
eigentlichen Griechenland stammen, alle aber Copien oder
Nachahmungen kostbarer Metallgefässe sind (vgl. Arch. Jahrb.
XXII 1908, 76 ff.; Άρχ. Έφ. 1910, 82,1). Ich will nicht leug-
nen, dass solche Becher auch in Alexandria nach einheimi-
schen toreutischen Vorbildern gemacht sein können, so z. B.
die im Arch. Anz. 1908, 45 f. abgebildeten; aber es sind we-
nige Exemplare, die sich von der Masse der ‘megarischen’
leicht unterscheiden lassen. Bei diesen sind die Darstellun-
gen fast ausschliesslich dem epischen Cyklus entnommen,
oder genauer gesagt aus den homerischen Epen und den
grossen Tragikern, während die alexandrinisclie Toreutik
solcher Stoffe fast ganz entbehrt. Wo müssen wir nun die
Vorlagen dieser Darstellungen suchen, welcher, der alexan-
drinischen gewiss gleichzeitigen Toreutenschule die Kost-
baren Metallgefässe zuschreiben, von denen die ‘megarischen’
Becher abhängen? Nach dem oben Gesagten sicherlich aus-
serhalb Aegyptens.
Diese Erwägungen und gewiss berechtigten Schwierig-
keiten führen zu dem Schlüsse, dass der alexandrinischen
Toreutik parallel, gleichzeitig und entgegengesetzt eine an-
A. S. ARVANITOPULLOS
betrifft, zeigen sie eine gesuchte, heuchlerische Gottesfurcht.
Sie gleichen darin den entsprechenden Dichtungen der ale-
xandrinischen Literatur, die entweder compliciert und ge-
sucht im Ausdruck und in Bildern sind, oder scherzhaft,
spielerisch, oder von sozusagen geschminkter Schönheit wie
die einer sorgsam geputzten Frau. Diesen Eindruck machen
uns gleichermassen die Dichtung und die Kunst der Alexan-
driner, während die schlichte natürliche Schönheit der thes-
salisclien Bilder offenbar ist.
Wir schliessen also, dass Technik, Arbeit und Vorlagen
unserer Gefässe eine andere Werkstatt, andere Traditionen
und Tendenzen verraten als die der alexandrinischen Toreu-
tik. Gewiss wäre unser Urteil sicherer, wenn es mehr ähn-
liche, ebenbürtige Beispiele aus dem eigentlichen Hellas
gäbe. Leider fehlen sie ausserhalb Italiens bisher ganz oder
sind so gering, dass sie vorläufig nicht in Betracht kommen.
Dagegen scheinen mir die sog. megarischen oder home-
rischen Becher bedeutsam, von denen die meisten aus dem
eigentlichen Griechenland stammen, alle aber Copien oder
Nachahmungen kostbarer Metallgefässe sind (vgl. Arch. Jahrb.
XXII 1908, 76 ff.; Άρχ. Έφ. 1910, 82,1). Ich will nicht leug-
nen, dass solche Becher auch in Alexandria nach einheimi-
schen toreutischen Vorbildern gemacht sein können, so z. B.
die im Arch. Anz. 1908, 45 f. abgebildeten; aber es sind we-
nige Exemplare, die sich von der Masse der ‘megarischen’
leicht unterscheiden lassen. Bei diesen sind die Darstellun-
gen fast ausschliesslich dem epischen Cyklus entnommen,
oder genauer gesagt aus den homerischen Epen und den
grossen Tragikern, während die alexandrinisclie Toreutik
solcher Stoffe fast ganz entbehrt. Wo müssen wir nun die
Vorlagen dieser Darstellungen suchen, welcher, der alexan-
drinischen gewiss gleichzeitigen Toreutenschule die Kost-
baren Metallgefässe zuschreiben, von denen die ‘megarischen’
Becher abhängen? Nach dem oben Gesagten sicherlich aus-
serhalb Aegyptens.
Diese Erwägungen und gewiss berechtigten Schwierig-
keiten führen zu dem Schlüsse, dass der alexandrinischen
Toreutik parallel, gleichzeitig und entgegengesetzt eine an-