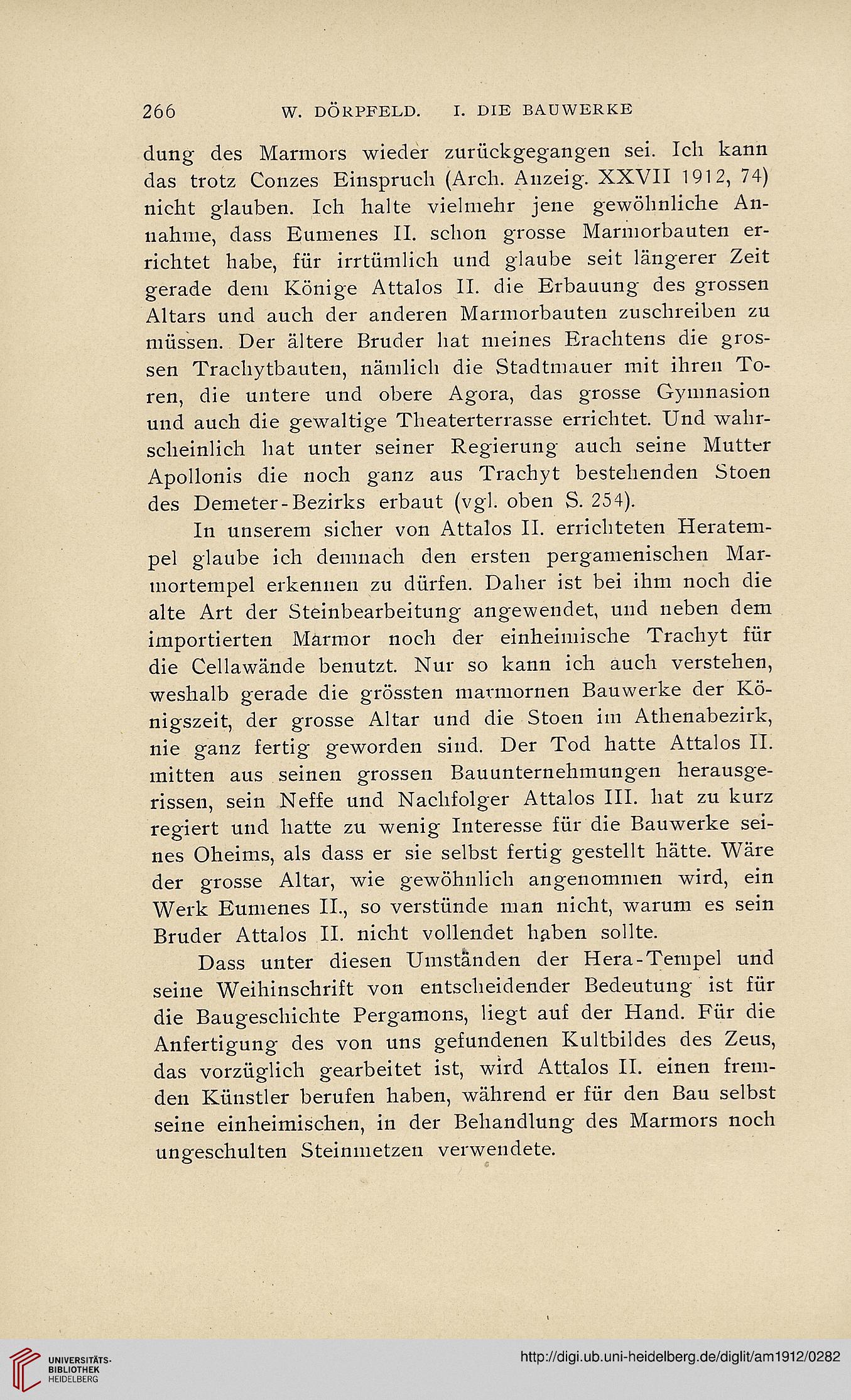266 W. DÖRPFELD. I. DIE BAUWERKE
düng des Marmors wieder zurückgegangen sei. Ich kann
das trotz Conzes Einspruch (Arch. Anzeig. XXVII 1912, 74)
nicht glauben. Ich halte vielmehr jene gewöhnliche An-
nahme, dass Eumenes II. schon grosse Marmorbauten er-
richtet habe, für irrtümlich und glaube seit längerer Zeit
gerade dem Könige Attalos II. die Erbauung des grossen
Altars und auch der anderen Marmorbauten zuschreiben zu
müssen. Der ältere Bruder hat meines Erachtens die gros-
sen Trachytbauten, nämlich die Stadtmauer mit ihren To-
ren, die untere und obere Agora, das grosse Gymnasion
und auch die gewaltige Theaterterrasse errichtet. Und wahr-
scheinlich hat unter seiner Regierung auch seine Mutter
Apollonis die noch ganz aus Trachyt bestehenden Stoen
des Demeter-Bezirks erbaut (vgl. oben S. 254).
In unserem sicher von Attalos II. errichteten Heratem-
pel glaube ich demnach den ersten pergamenischen Mar-
mortempel erkennen zu dürfen. Daher ist bei ihm noch die
alte Art der Steinbearbeitung angewendet, und neben dem
importierten Marmor noch der einheimische Trachyt für
die Cellawände benutzt. Nur so kann ich auch verstehen,
weshalb gerade die grössten marmornen Bauwerke der Kö-
nigszeit, der grosse Altar und die Stoen im Athenabezirk,
nie ganz fertig geworden sind. Der Tod hatte Attalos II.
mitten aus seinen grossen Bauunternehmungen herausge-
rissen, sein Neffe und Nachfolger Attalos III. hat zu kurz
regiert und hatte zu wenig Interesse für die Bauwerke sei-
nes Oheims, als dass er sie selbst fertig gestellt hätte. Wäre
der grosse Altar, wie gewöhnlich angenommen wird, ein
Werk Eumenes II., so verstünde man nicht, warum es sein
Bruder Attalos II. nicht vollendet haben sollte.
Dass unter diesen Umständen der Hera-Tempel und
seine Weihinschrift von entscheidender Bedeutung ist für
die Baugeschichte Pergamons, liegt auf der Hand. Für die
Anfertigung des von uns gefundenen Kultbildes des Zeus,
das vorzüglich gearbeitet ist, wird Attalos II. einen frem-
den Künstler berufen haben, während er für den Bau selbst
seine einheimischen, in der Behandlung des Marmors noch
ungeschulten Steinmetzen verwendete.
düng des Marmors wieder zurückgegangen sei. Ich kann
das trotz Conzes Einspruch (Arch. Anzeig. XXVII 1912, 74)
nicht glauben. Ich halte vielmehr jene gewöhnliche An-
nahme, dass Eumenes II. schon grosse Marmorbauten er-
richtet habe, für irrtümlich und glaube seit längerer Zeit
gerade dem Könige Attalos II. die Erbauung des grossen
Altars und auch der anderen Marmorbauten zuschreiben zu
müssen. Der ältere Bruder hat meines Erachtens die gros-
sen Trachytbauten, nämlich die Stadtmauer mit ihren To-
ren, die untere und obere Agora, das grosse Gymnasion
und auch die gewaltige Theaterterrasse errichtet. Und wahr-
scheinlich hat unter seiner Regierung auch seine Mutter
Apollonis die noch ganz aus Trachyt bestehenden Stoen
des Demeter-Bezirks erbaut (vgl. oben S. 254).
In unserem sicher von Attalos II. errichteten Heratem-
pel glaube ich demnach den ersten pergamenischen Mar-
mortempel erkennen zu dürfen. Daher ist bei ihm noch die
alte Art der Steinbearbeitung angewendet, und neben dem
importierten Marmor noch der einheimische Trachyt für
die Cellawände benutzt. Nur so kann ich auch verstehen,
weshalb gerade die grössten marmornen Bauwerke der Kö-
nigszeit, der grosse Altar und die Stoen im Athenabezirk,
nie ganz fertig geworden sind. Der Tod hatte Attalos II.
mitten aus seinen grossen Bauunternehmungen herausge-
rissen, sein Neffe und Nachfolger Attalos III. hat zu kurz
regiert und hatte zu wenig Interesse für die Bauwerke sei-
nes Oheims, als dass er sie selbst fertig gestellt hätte. Wäre
der grosse Altar, wie gewöhnlich angenommen wird, ein
Werk Eumenes II., so verstünde man nicht, warum es sein
Bruder Attalos II. nicht vollendet haben sollte.
Dass unter diesen Umständen der Hera-Tempel und
seine Weihinschrift von entscheidender Bedeutung ist für
die Baugeschichte Pergamons, liegt auf der Hand. Für die
Anfertigung des von uns gefundenen Kultbildes des Zeus,
das vorzüglich gearbeitet ist, wird Attalos II. einen frem-
den Künstler berufen haben, während er für den Bau selbst
seine einheimischen, in der Behandlung des Marmors noch
ungeschulten Steinmetzen verwendete.