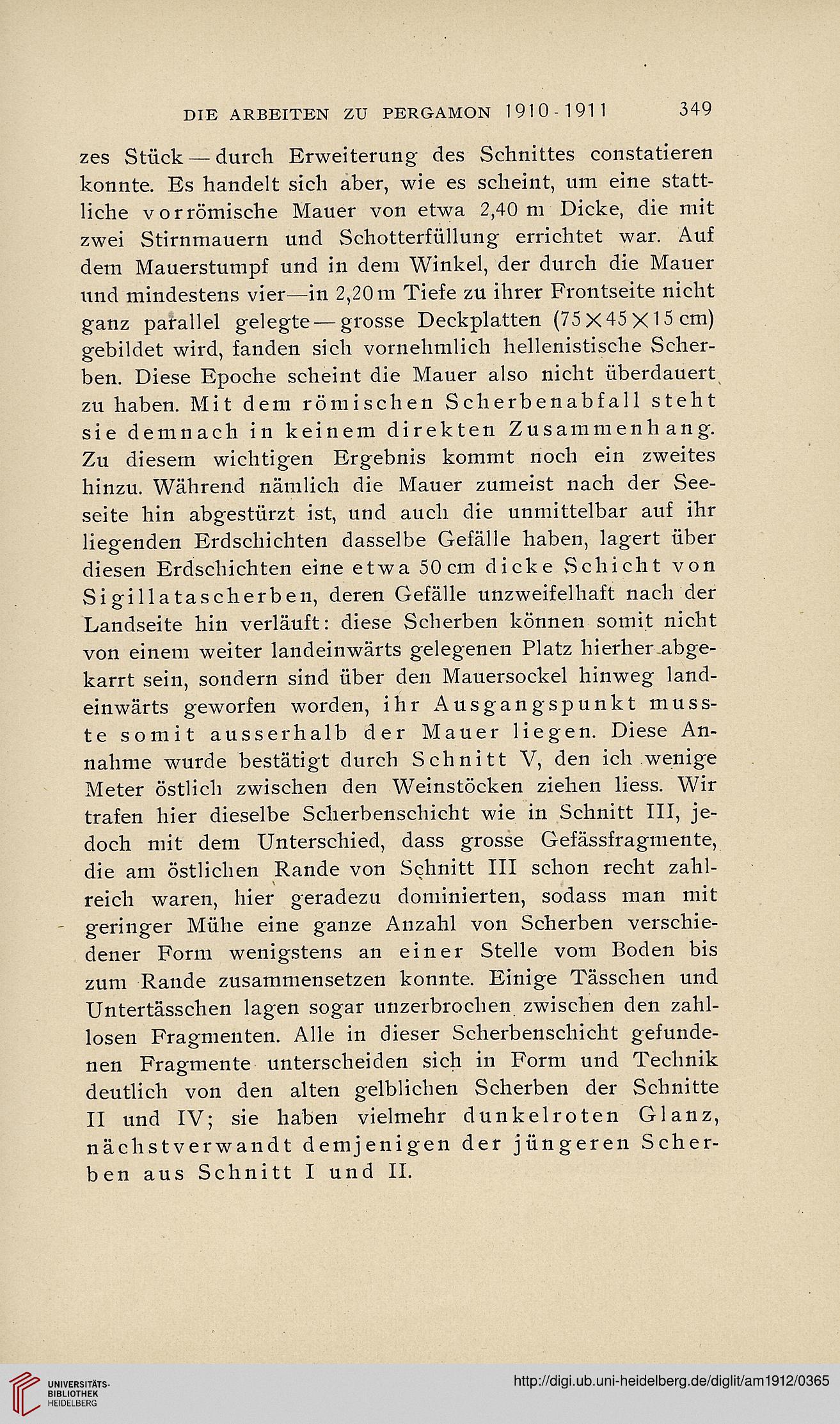DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1910-1911
349
zes Stück — durch Erweiterung des Schnittes constatieren
konnte. Es handelt sich aber, wie es scheint, um eine statt-
liche vorrömische Mauer von etwa 2,40 m Dicke, die mit
zwei Stirnmauern und Schotterfüllung errichtet war. Auf
dem Mauerstumpf und in dem Winkel, der durch die Mauer
und mindestens vier—in 2,20 m Tiefe zu ihrer Frontseite nicht
ganz parallel gelegte — grosse Deckplatten (75X45 χΐ5 cm)
gebildet wird, fanden sich vornehmlich hellenistische Scher-
ben. Diese Epoche scheint die Mauer also nicht überdauert
zu haben. Mit dem römischen Scherbenabfall steht
sie demnach in keinem direkten Zusammenhang.
Zu diesem wichtigen Ergebnis kommt noch ein zweites
hinzu. Während nämlich die Mauer zumeist nach der See-
seite hin abgestürzt ist, und auch die unmittelbar auf ihr
liegenden Erdschichten dasselbe Gefälle haben, lagert über
diesen Erdschichten eine etwa 50cm dicke »Schicht von
Sigillatascherben, deren Gefälle unzweifelhaft nach der
Landseite hin verläuft: diese Scherben können somit nicht
von einem weiter landeinwärts gelegenen Platz hierher abge-
karrt sein, sondern sind über den Mauersockel hinweg land-
einwärts geworfen worden, ihr Ausgangspunkt muss-
te somit ausserhalb der Mauer liegen. Diese An-
nahme wurde bestätigt durch Schnitt V, den ich wenige
Meter östlich zwischen den Weinstöcken ziehen liess. Wir
trafen hier dieselbe Scherbenschicht wie in Schnitt III, je-
doch mit dem Unterschied, dass grosse Gefässfragmente,
die am östlichen Rande von Schnitt III schon recht zahl-
reich waren, hier geradezu dominierten, sodass man mit
geringer Mühe eine ganze Anzahl von Scherben verschie-
dener Form wenigstens an einer Stelle vom Boden bis
zum Rande zusammensetzen konnte. Einige Tässchen und
Untertässchen lagen sogar unzerbrochen zwischen den zahl-
losen Fragmenten. Alle in dieser Scherbenschicht gefunde-
nen Fragmente unterscheiden sich in Form und Technik
deutlich von den alten gelblichen Scherben der Schnitte
II und IV; sie haben vielmehr dunkelroten Glanz,
nächst verwandt demjenigen der jüngeren Scher-
ben aus Schnitt I und II.
349
zes Stück — durch Erweiterung des Schnittes constatieren
konnte. Es handelt sich aber, wie es scheint, um eine statt-
liche vorrömische Mauer von etwa 2,40 m Dicke, die mit
zwei Stirnmauern und Schotterfüllung errichtet war. Auf
dem Mauerstumpf und in dem Winkel, der durch die Mauer
und mindestens vier—in 2,20 m Tiefe zu ihrer Frontseite nicht
ganz parallel gelegte — grosse Deckplatten (75X45 χΐ5 cm)
gebildet wird, fanden sich vornehmlich hellenistische Scher-
ben. Diese Epoche scheint die Mauer also nicht überdauert
zu haben. Mit dem römischen Scherbenabfall steht
sie demnach in keinem direkten Zusammenhang.
Zu diesem wichtigen Ergebnis kommt noch ein zweites
hinzu. Während nämlich die Mauer zumeist nach der See-
seite hin abgestürzt ist, und auch die unmittelbar auf ihr
liegenden Erdschichten dasselbe Gefälle haben, lagert über
diesen Erdschichten eine etwa 50cm dicke »Schicht von
Sigillatascherben, deren Gefälle unzweifelhaft nach der
Landseite hin verläuft: diese Scherben können somit nicht
von einem weiter landeinwärts gelegenen Platz hierher abge-
karrt sein, sondern sind über den Mauersockel hinweg land-
einwärts geworfen worden, ihr Ausgangspunkt muss-
te somit ausserhalb der Mauer liegen. Diese An-
nahme wurde bestätigt durch Schnitt V, den ich wenige
Meter östlich zwischen den Weinstöcken ziehen liess. Wir
trafen hier dieselbe Scherbenschicht wie in Schnitt III, je-
doch mit dem Unterschied, dass grosse Gefässfragmente,
die am östlichen Rande von Schnitt III schon recht zahl-
reich waren, hier geradezu dominierten, sodass man mit
geringer Mühe eine ganze Anzahl von Scherben verschie-
dener Form wenigstens an einer Stelle vom Boden bis
zum Rande zusammensetzen konnte. Einige Tässchen und
Untertässchen lagen sogar unzerbrochen zwischen den zahl-
losen Fragmenten. Alle in dieser Scherbenschicht gefunde-
nen Fragmente unterscheiden sich in Form und Technik
deutlich von den alten gelblichen Scherben der Schnitte
II und IV; sie haben vielmehr dunkelroten Glanz,
nächst verwandt demjenigen der jüngeren Scher-
ben aus Schnitt I und II.